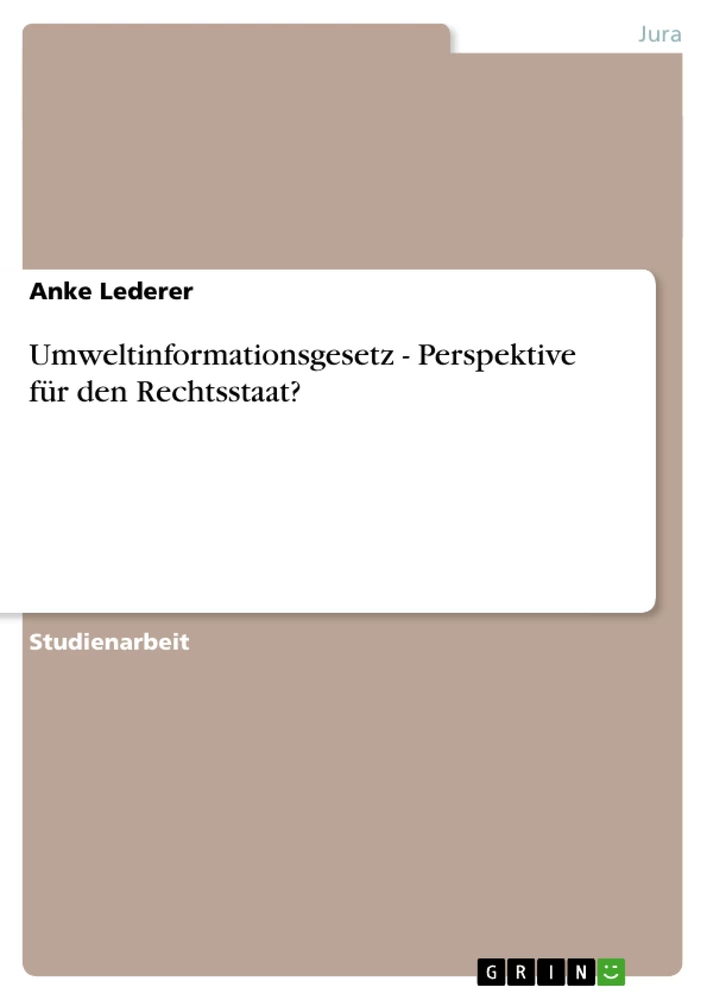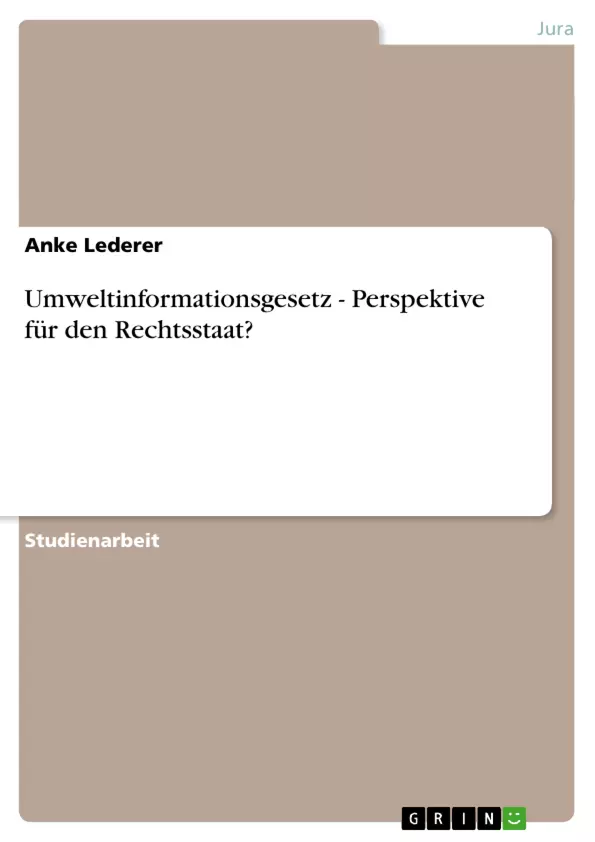Das Umweltinformationsgesetz (UIG) als solches ist eine kleine Revolution in deutschen Amtsstuben. Zum ersten mal ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern ein Recht auf Informationen einzufordern, ohne dass diese Gründe vorweisen müssten. Das bis dahin geltende Prinzip, dass ein Bürger einen Antrag auf Informationszugang begründen muss, wird hier umgekehrt und die Behörde dazu verpflichtet die Ablehnung eines Antrags zu begründen. Die vorliegende Arbeit gibt einen Einblick in das UIG. Dabei wird zunächst auf die Entstehung, Funktion und Ziele des Gesetzes eingegangen, z.B. welche Voraussetzungen nötig waren und aus welchen Gründen es entstand. Ebenfalls werden die erwarteten und die tatsächlichen Auswirkungen des UIGs anhand einer Untersuchung von Markus Schmillen vorgestellt. Den Abschluss bildet ein Ausblick in die Zukunft und die möglichen Perspektiven, die das Gesetz bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung und Funktion des Gesetzes
- Umweltinformationsrichtlinie vom 7. Juni 1990
- Umweltinformationsgesetz vom 8. Juli 1994.
- Kritik
- Änderung des UIGS.
- Übereinkommen von Aarhus vom 25. Juni 1998. .
- Umweltinformationsrichtlinie vom 28. Januar 2003
- Umweltinformationsgesetz vom 22. Dezember 2004.
- Auswirkungen
- Aktuelle Datenbanken
- Umweltdatenkatalog
- Umweltinformationsnetz Deutschland gein
- Umweltbundesamt
- Europäisches Schadstoffemissionsregister EPER
- Zusammenfassung
- Perspektiven und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das Umweltinformationsgesetz (UIG) und dessen Auswirkungen auf den Rechtsstaat. Ziel ist es, die Entstehung, Funktion und Ziele des Gesetzes zu beleuchten sowie die Erwartungen und die tatsächlichen Folgen zu untersuchen.
- Die Entstehung des UIG im Kontext europäischer Richtlinien und internationaler Abkommen
- Die Funktion des UIG als Instrument zur Förderung der Transparenz und Bürgerbeteiligung
- Die Auswirkungen des UIG auf den Zugang zu Umweltinformationen
- Die Bedeutung des UIG für den Rechtsstaat
- Die Zukunft des UIG und dessen Weiterentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Umweltinformationsgesetz (UIG) als eine Revolution in deutschen Amtsstuben vor, die Bürgerinnen und Bürgern ein Recht auf Informationszugang gewährt, ohne dass diese Gründe vorweisen müssen. Die Arbeit gibt einen Einblick in die Entstehung, Funktion und Ziele des Gesetzes sowie die erwarteten und tatsächlichen Auswirkungen.
- Entstehung und Funktion des Gesetzes: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des UIG im Kontext der Aktionsprogramme für den Umweltschutz der Europäischen Gemeinschaft und der Aarhus-Konvention. Es beschreibt die Umweltinformationsrichtlinie (UIR) als Grundlage für das UIG und erklärt die Zielsetzung der UIR, Umweltschutz durch Herausgabe, Veröffentlichung und Verbreitung von Informationen über die Umwelt zu verbessern. Außerdem werden die einzelnen Gegebenheiten, die zum aktuellen UIG geführt haben, chronologisch vorgestellt und erörtert.
- Umweltinformationsrichtlinie vom 7. Juni 1990: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Zielsetzung der UIR, den Umweltschutz durch die Bereitstellung von Umweltinformationen zu verbessern. Es beschreibt die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zur Veröffentlichung von regelmäßigen Zustandsberichten über den Zustand der Umwelt und die Definition von Umweltinformationen, die unter das Gesetz fallen.
- Umweltinformationsgesetz vom 8. Juli 1994: Dieses Kapitel untersucht die Umsetzung der UIR in nationales Recht durch das deutsche Umweltinformationsgesetz (UIG). Es betrachtet die Kritik am UIG, die Gebührenordnung und die Umsetzung der Forderungen der UIR in deutsches Recht.
- Auswirkungen: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Auswirkungen des UIG. Er analysiert die tatsächlichen Auswirkungen des UIG auf den Zugang zu Umweltinformationen und auf die Bürgerbeteiligung.
- Aktuelle Datenbanken: Hier werden wichtige Datenbanken vorgestellt, die Umweltinformationen bereitstellen, wie z.B. der Umweltdatenkatalog, das Umweltinformationsnetz Deutschland gein und das Europäische Schadstoffemissionsregister EPER.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter, die die Themen der Hausarbeit widerspiegeln, sind: Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltinformationsrichtlinie (UIR), Aarhus-Konvention, Zugang zu Informationen, Transparenz, Bürgerbeteiligung, Umweltschutz, Rechtsstaat, Datenbanken, Umweltinformationen.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt das Umweltinformationsgesetz (UIG)?
Das UIG gewährt Bürgern einen freien Zugang zu Umweltinformationen bei Behörden, ohne dass ein rechtliches Interesse oder eine Begründung dargelegt werden muss.
Was war die "Revolution" in deutschen Amtsstuben durch das UIG?
Die Beweislast kehrte sich um: Nicht mehr der Bürger muss seinen Antrag begründen, sondern die Behörde muss eine Ablehnung des Informationszugangs rechtfertigen.
Was ist das Übereinkommen von Aarhus?
Die Aarhus-Konvention von 1998 ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten stärkt.
Welche Datenbanken bieten Umweltinformationen an?
Wichtige Quellen sind der Umweltdatenkatalog, das Umweltinformationsnetz Deutschland (gein) und das Europäische Schadstoffemissionsregister (EPER).
Welche Kritik gab es am ersten UIG von 1994?
Kritisiert wurden unter anderem hohe Gebühren für Auskünfte und zu weitreichende Ausnahmetatbestände, die den Informationsfluss behinderten.
Wie fördert das UIG die Bürgerbeteiligung?
Durch Transparenz und den Zugang zu Daten werden Bürger in die Lage versetzt, Entscheidungsprozesse im Umweltschutz besser zu verstehen und aktiv mitzugestalten.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Inform. Anke Lederer (Autor:in), 2005, Umweltinformationsgesetz - Perspektive für den Rechtsstaat?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45497