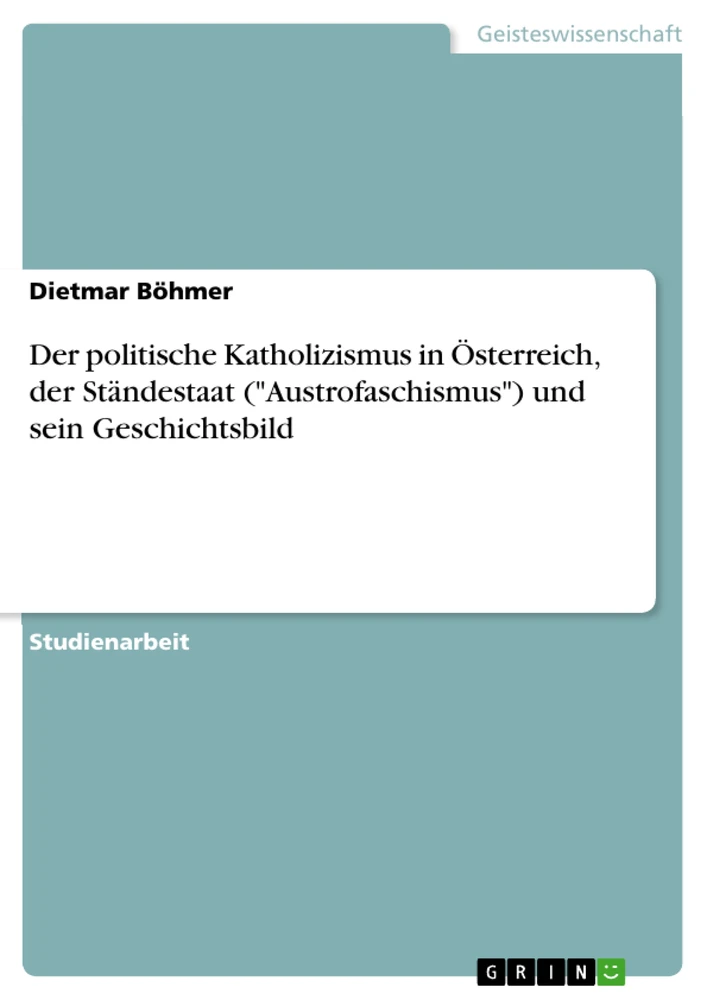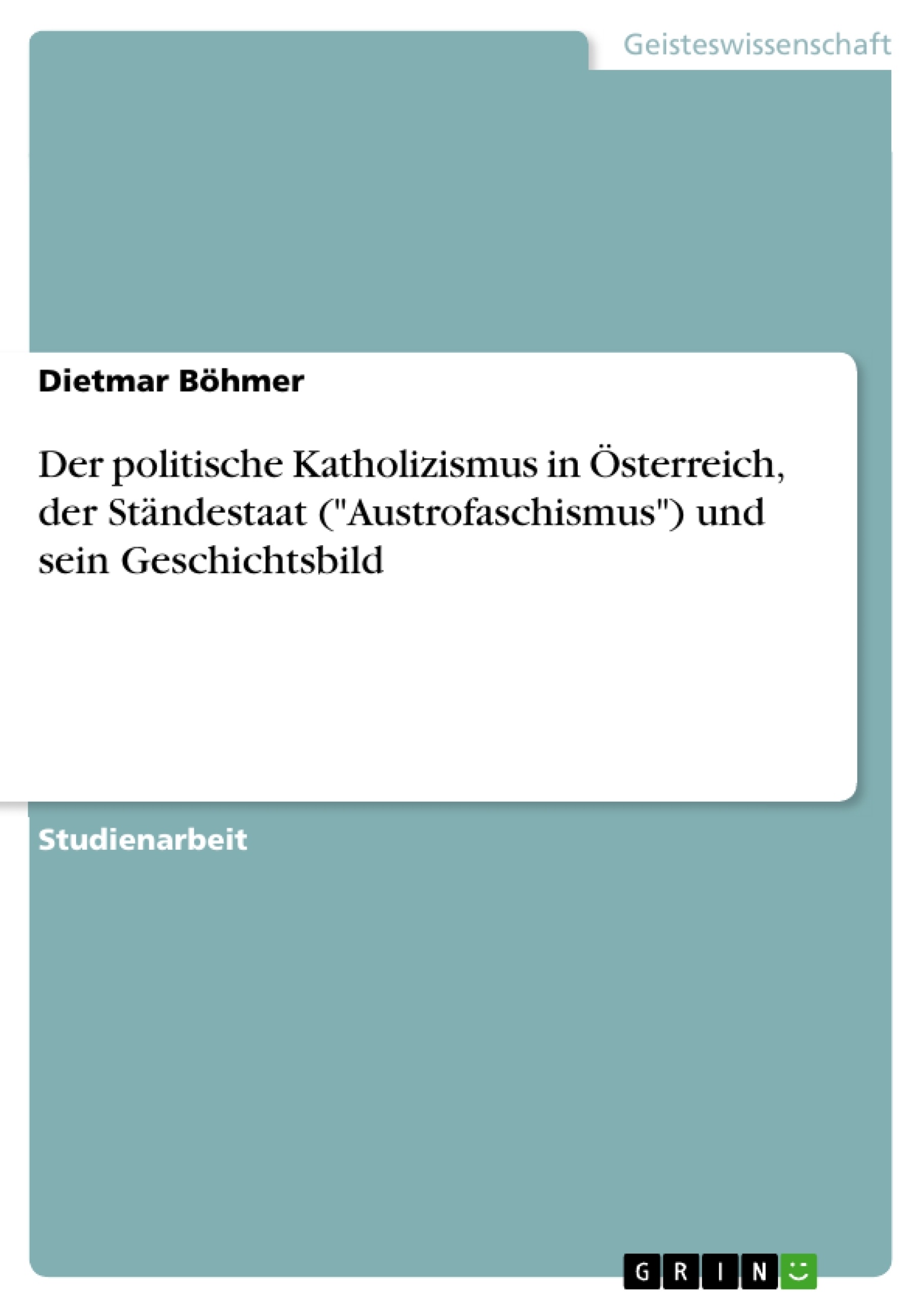Diese Arbeit stellt eine deskriptive Zusammenstellung des österreichischen Herrschaftssystems der Jahre 1933 bis 1938 dar. Es ist dies ein wissenschaftlich kontroverses Thema und selbst heute noch ein Politikum. Nicht nur die Bewertung der Protagonisten, sondern auch der Charakter des Systems insgesamt sind strittig.
Im Titel dieser Arbeit sind zudem drei Begriffe enthalten, die jedenfalls zur Beschreibung des Systems näher beleuchtet werden müssen. Zwar sind sie in der Diskussion über die Zeit von 1933–1938 in ‚aller Munde’, jedoch sind sie wissenschaftlich sehr umstritten. Das Zusammenfassen der österreichischen Geschichte dieser Zeit mit einem einzigen Begriff misslingt meist, denn eine allgemein anerkannte Definition ist nicht einfach. Das Ergebnis ist, dass die theoretische Einordnung des politischen Systems in Österreich für die Zeit von 1933–1938 mehr oder weniger stark diskutiert wird.
Im Rahmen dieser Arbeit werde ich zuerst dem Begriff des Faschismus nachgehen, um anschließend die österreichische Ausprägung – den ‚Austrofaschismus’ – zu besprechen. Über den politischen Katholizismus und den Ständestaat werde ich zu einer kurzen Darstellung der Situation für die Evangelischen Kirchen in Österreich kommen, bevor resümierend auch das Geschichtsbild – und es wird gezeigt werden, dass es „das“ Geschichtsbild nicht gibt – beschrieben wird.
Schwer fiel im Zusammenhang mit der Beschäftigung mit dem Stoff die begriffliche Verwirrung betreffend des Begriffs ‚Austrofaschismus’. Da ich letztlich zu dem Schluss gekommen bin, dass es sich nicht um einen faschistischen Staat handelt, habe ich den Terminus ‚Austrofaschismus’ immer unter Anführungszeichen geschrieben. Ich bin mir dessen bewusst, das ich damit wertend in die Beschreibung eingreife. Das scheint mir aber keine Verletzung der akademisch bedungenen Neutralität zu sein, da es in diesem Themenfeld – wie erwähnt – schlicht und ergreifend noch keinen Konsens über die Begrifflichkeit gibt. Es wird also immer noch um das Geschichtsbild der jüngsten österreichischen Vergangenheit gestritten. Das alleine ist schon interessant, da die Deutungen relativ exakt entlang der politischen Präferenzen zu gehen scheinen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Faschismus
- Etymologie
- Definitionsversuch
- Austrofaschismus
- Der Weg in die Diktatur
- Stützen des Systems
- Katholische Kirche
- Heimwehren
- Vaterländische Front
- Bewertung des „austrofaschistischen“ Systems
- Politischer Katholizismus und Ständestaat
- Situation für die Evangelischen Kirchen
- Geschichtsbild und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschreibt das österreichische Herrschaftssystem zwischen 1933 und 1938, ein wissenschaftlich kontroverses Thema. Die Arbeit untersucht die umstrittenen Begriffe „Austrofaschismus“, politischer Katholizismus und Ständestaat und deren Anwendung auf die österreichische Geschichte dieser Periode. Ziel ist es, eine deskriptive Zusammenstellung des Systems zu liefern und die unterschiedlichen Interpretationsansätze zu beleuchten.
- Der Begriff „Austrofaschismus“ und seine wissenschaftliche Kontroverse
- Die Rolle der Katholischen Kirche im Ständestaat
- Die Stützpfeiler des „austrofaschistischen“ Systems
- Die Situation der Evangelischen Kirchen in Österreich unter dem Ständestaat
- Das vielschichtige Geschichtsbild dieser Epoche
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Arbeit bietet eine deskriptive Darstellung des österreichischen Herrschaftssystems zwischen 1933 und 1938. Der Autor weist auf die wissenschaftliche und politische Kontroverse um die Bewertung des Systems und die verwendeten Begriffe wie „Austrofaschismus“ hin. Die Arbeit gliedert sich in die Analyse des Begriffs Faschismus, die Untersuchung des „Austrofaschismus“, die Rolle des politischen Katholizismus und des Ständestaates, die Situation der evangelischen Kirchen und schließlich eine Betrachtung des Geschichtsbildes dieser Zeit. Die begriffliche Unschärfe, insbesondere beim „Austrofaschismus“, wird explizit thematisiert und der Autor begründet seine Verwendung des Begriffs in Anführungszeichen.
Faschismus: Dieses Kapitel beginnt mit der Etymologie des Begriffs „Faschismus“, der vom lateinischen „fasces“ (Rutenbündel) abgeleitet ist. Die Arbeit betont, dass die bloße Etymologie jedoch wenig über das Wesen des Faschismus aussagt. Der Begriff wurde von Mussolini geprägt und auf verschiedene politische Bewegungen im Europa zwischen den Weltkriegen angewendet, oft ohne detaillierte Prüfung von Ähnlichkeiten zum italienischen Original. Der Fokus liegt hier auf der begrifflichen Unschärfe und den Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition.
Austrofaschismus: Dieses Kapitel behandelt den „Austrofaschismus“ als österreichische Ausprägung des Faschismus. Es wird der Weg in die Diktatur, die Stützen des Systems (Katholische Kirche, Heimwehren, Vaterländische Front) und eine Bewertung des Systems diskutiert. Die Zusammenfassung erläutert die verschiedenen Faktoren, die zum Aufbau und zur Stabilität des Systems beigetragen haben, und analysiert die politischen und sozialen Dynamiken dieser Zeit. Der Autor betont die Komplexität und Vielschichtigkeit des Systems und die schwierige Einordnung in gängige faschistische Modelle.
Politischer Katholizismus und Ständestaat: Dieser Abschnitt beleuchtet den Zusammenhang zwischen dem politischen Katholizismus und dem Ständestaat. Die Arbeit wird die Rolle der katholischen Kirche als Stütze des Systems und deren Einfluss auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung Österreichs untersuchen. Die Zusammenfassung wird die Interaktion zwischen Kirche und Staat analysieren und die Auswirkungen dieser Allianz auf die Bevölkerung aufzeigen.
Situation für die Evangelischen Kirchen: Die Zusammenfassung dieses Kapitels beschreibt die spezifischen Herausforderungen und die Situation der evangelischen Kirchen im Kontext des „austrofaschistischen“ Ständestaates. Sie wird die Unterschiede zu den Verhältnissen der katholischen Kirche beleuchten und die Strategien und Reaktionen der evangelischen Gemeinden auf die politische Lage analysieren.
Schlüsselwörter
Austrofaschismus, Politischer Katholizismus, Ständestaat, Katholische Kirche, Evangelische Kirchen in Österreich, Faschismus, Heimwehren, Vaterländische Front, Geschichtsbild, Benito Mussolini.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Austrofaschismus, Politischer Katholizismus und Ständestaat in Österreich (1933-1938)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit dem österreichischen Herrschaftssystem zwischen 1933 und 1938, insbesondere mit den Begriffen „Austrofaschismus“, politischer Katholizismus und Ständestaat. Sie analysiert diese Begriffe, untersucht deren Anwendung auf die österreichische Geschichte dieser Periode und beleuchtet unterschiedliche Interpretationsansätze.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die wissenschaftliche Kontroverse um den Begriff „Austrofaschismus“, die Rolle der katholischen Kirche im Ständestaat, die Stützpfeiler des Systems (Heimwehren, Vaterländische Front), die Situation der evangelischen Kirchen und das vielschichtige Geschichtsbild dieser Epoche.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Faschismus (inkl. Etymologie und Definitionsversuch), Austrofaschismus (inkl. Weg in die Diktatur und Bewertung des Systems), politischem Katholizismus und Ständestaat, der Situation der evangelischen Kirchen und ein Resümee mit geschichtswissenschaftlicher Betrachtung.
Was wird unter „Austrofaschismus“ verstanden und warum wird der Begriff in Anführungszeichen gesetzt?
„Austrofaschismus“ bezeichnet in dieser Arbeit die österreichische Variante des Faschismus. Die Anführungszeichen verdeutlichen die begriffliche Unschärfe und die wissenschaftliche Kontroverse um die Einordnung des österreichischen Systems in gängige faschistische Modelle. Die Arbeit untersucht die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition und die unterschiedlichen Interpretationsansätze.
Welche Rolle spielte die katholische Kirche im Ständestaat?
Die Arbeit untersucht die Rolle der katholischen Kirche als Stütze des „austrofaschistischen“ Systems und deren Einfluss auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung Österreichs. Die Interaktion zwischen Kirche und Staat und die Auswirkungen dieser Allianz auf die Bevölkerung werden analysiert.
Wie war die Situation der evangelischen Kirchen unter dem Ständestaat?
Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und die Situation der evangelischen Kirchen im Kontext des „austrofaschistischen“ Ständestaates. Sie vergleicht die Situation der evangelischen Kirchen mit der der katholischen Kirche und analysiert die Strategien und Reaktionen der evangelischen Gemeinden auf die politische Lage.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind Austrofaschismus, Politischer Katholizismus, Ständestaat, Katholische Kirche, Evangelische Kirchen in Österreich, Faschismus, Heimwehren, Vaterländische Front, Geschichtsbild und Benito Mussolini.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf eine deskriptive Darstellung des österreichischen Herrschaftssystems zwischen 1933 und 1938 ab und beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationsansätze bezüglich des Systems und der verwendeten Begriffe.
- Citar trabajo
- Mag.rer.soc.oec., MTh Dietmar Böhmer (Autor), 2017, Der politische Katholizismus in Österreich, der Ständestaat ("Austrofaschismus") und sein Geschichtsbild, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455051