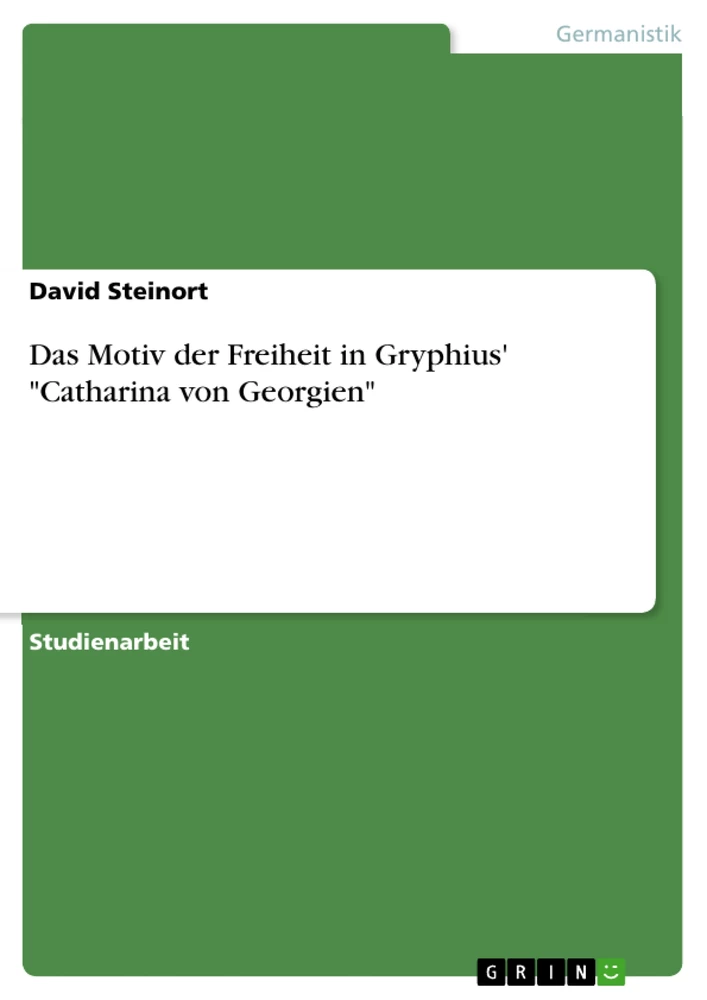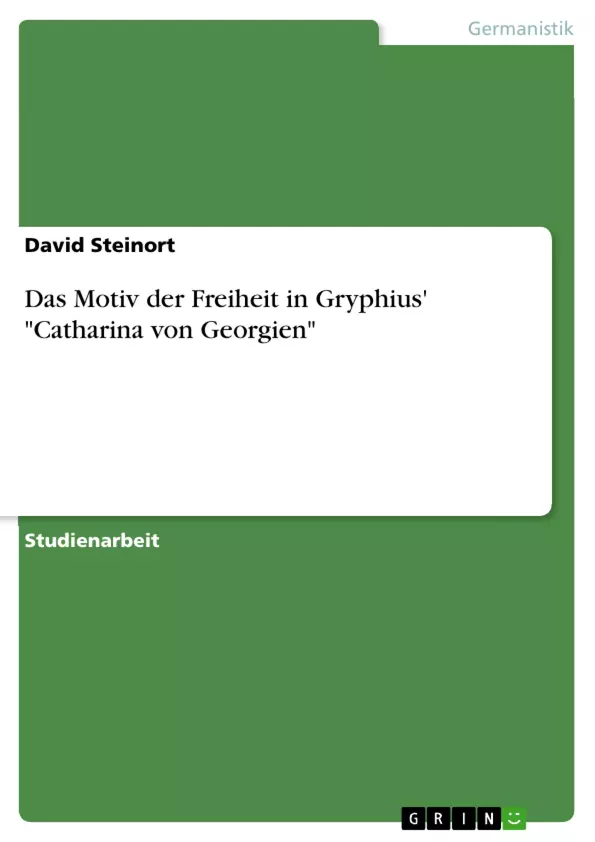Gryphius' Catharina von Georgien liefert ein Beispiel einer unumstößlichen Herrscherin. Es ist daher offensichtlich, warum das constantia-Motiv seit jeher bedeutender Gegenstand der Forschungsliteratur um Gryphius' Werk ist. Die Untersuchungen in dieser Arbeit konzentrieren sich jedoch auf einen anderen. Denn neben Ewigkeit und Zeit eröffnen im Trauerspiel noch zwei weitere Gegenpole ein ähnlich geartetes strukturelles Spannungsfeld: Jede Entscheidung, jedes menschliche Handeln und jeder dadurch offenbarte Charakterzug siedelt sich im Stück zischen Freiheit und Unfreiheit an. Die Freiheit bzw. ihre Abwesenheit definiert maßgebend die Hauptcharaktere, den Handlungsrahmen und die Struktur des Dramas. Diese Hausarbeit untersucht daher das Motiv der Freiheit in Andreas Gryphius' Catharina von Georgien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Motiv der Freiheit
- Freiheit im heilsgeschichtlichen und christlich-stoischen Kontext
- Auf dem Weg zur Märtyrerin
- Freiheit von weltlichen Makeln
- Die,,Freiheit eines Christenmenschen“
- Die stoisch-christliche Freiheit
- Freiheit im weltlichen Kontext
- Gewissensfreiheit und Freiheit des Individuums
- Handlungsunfähigkeit und Weltverlust
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Motiv der Freiheit in Andreas Gryphius' Trauerspiel Catharina von Georgien. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung von Freiheit und Unfreiheit im Kontext der Handlung des Stücks, der Charakterentwicklung der Hauptfiguren und der philosophisch-theologischen Grundlegung des Dramas.
- Die Freiheit als zentrales Motiv im Stück und ihre Darstellung in verschiedenen Kontexten
- Die Bedeutung der Freiheit für die Titelheldin Catharina und ihre Rolle im Kontext des Martyriums
- Die Freiheit im Spannungsfeld von Weltlichkeit und Ewigkeit
- Die Verbindung von christlich-stoischer Philosophie und Freiheitsideen im Stück
- Die Darstellung von Freiheit und Unfreiheit in den Charakteren Chach Abas und Catharina
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und setzt den Fokus auf die Analyse des Motivs der Freiheit im Stück. Das zweite Kapitel beleuchtet die Vielschichtigkeit des Motivs der Freiheit in Catharina von Georgien, indem es die verschiedenen Ausprägungen von Freiheit im Stück, wie politische und religiöse Freiheit, beleuchtet. Kapitel drei befasst sich mit der Freiheit im heilsgeschichtlichen und christlich-stoischen Kontext, analysiert Catharinas Weg zur Märtyrerin und beleuchtet die Rolle der Freiheit im stoisch-christlichen Verständnis. Die Analyse der Freiheit im weltlichen Kontext erfolgt im vierten Kapitel, wobei die Themen der Gewissensfreiheit und die Freiheit des Individuums im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Arbeit umfassen Freiheit, Unfreiheit, Martyrium, constantia, heilsgeschichtliche Deutung, christlich-stoische Philosophie, vanitas mundi, Catharina von Georgien, Andreas Gryphius, Chach Abas, politische Freiheit, religiöse Freiheit, Handlungsfreiheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Untersuchungsgegenstand dieser Hausarbeit?
Die Arbeit untersucht das Motiv der Freiheit in Andreas Gryphius' Trauerspiel "Catharina von Georgien".
In welchen Kontexten wird der Begriff der Freiheit analysiert?
Die Analyse erfolgt sowohl im heilsgeschichtlichen und christlich-stoischen Kontext als auch im weltlichen Kontext (z. B. Gewissensfreiheit).
Welche Rolle spielt die Hauptfigur Catharina in Bezug auf die Freiheit?
Catharinas Weg zur Märtyrerin wird als Prozess der Erlangung einer stoisch-christlichen Freiheit von weltlichen Makeln dargestellt.
Was bedeutet "constantia" im Zusammenhang mit Gryphius?
"Constantia" steht für die Unumstößlichkeit und Beständigkeit der Herrscherin, ein klassisches Motiv der Barockforschung, das hier durch das Motiv der Freiheit ergänzt wird.
Wie wird die Unfreiheit im Stück thematisiert?
Die Arbeit zeigt das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Unfreiheit auf, das sich in der Handlungsunfähigkeit und dem Weltverlust der Charaktere äußert.
Welche philosophischen Strömungen beeinflussen das Drama?
Das Stück ist stark von der christlich-stoischen Philosophie und dem Vanitas-Gedanken (Eitelkeit der Welt) geprägt.
- Quote paper
- David Steinort (Author), 2014, Das Motiv der Freiheit in Gryphius' "Catharina von Georgien", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455410