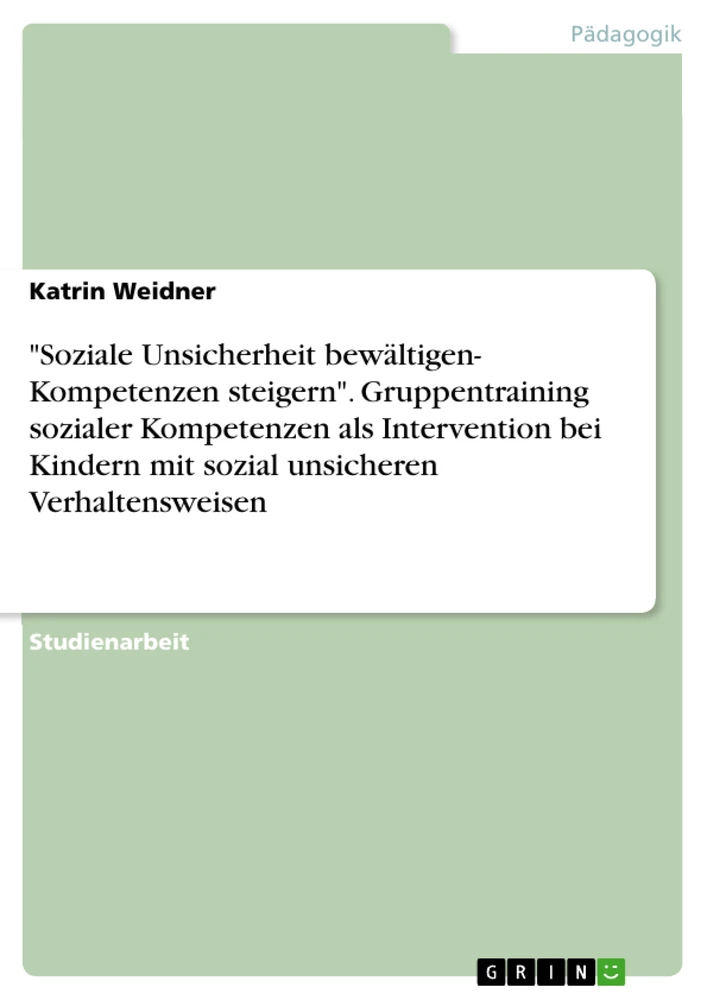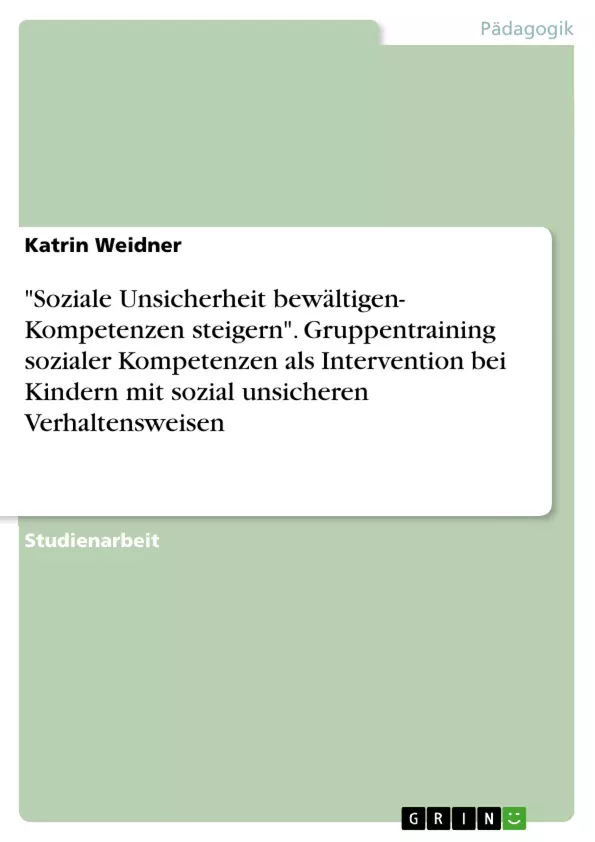Ziel dieser Hausarbeit ist die Darstellung des Gruppentrainings sozialer Kompetenzen als Intervention bei Kindern mit „Sozialer Unsicherheit“. Angesichts der Häufigkeit mit welcher subklinische „Soziale Ängste“ in der Kindheit und Jugend vorkommen, ist es naheliegend drohenden pathologischen Entwicklungen dieser durch präventive Programme vorzubeugen.
Der Intervention des sozialen Kompetenztrainings kommt in diesem Zuge eine besondere Bedeutung zu. Im Vordergrund dieser Betrachtung steht, neben der Bewältigung der sozialen Ängste, vor allem der präventive Charakter dieser Maßnahme sowie die Verbesserung der sozialen Kompetenzen.
Zunächst wird die Symptomatik der „Sozialen Unsicherheit“ dargestellt und anhand einer Klassifikation der „Sozialen Phobie“ als klinisches Störungsbild nach ICD-10 und DSM-IV von dieser abgegrenzt. Im Weiteren liegt der Schwerpunkt auf der Abbildung der Epidemiologie, der ätiologischen Entwicklung sowie dem Verlauf und der Prognose „Sozialer Unsicherheit“. Teil zwei beschäftigt sich einführend mit der Bedeutung sozialer Kompetenzen für die Zielgruppe der sozial unsicheren Kinder und Jugendlichen. Im Anschluss werden Zielsetzungen und Ansätze des Gruppentrainings sozialer Kompetenzen erläutert. Dies wird im Folgenden ergänzt durch eine exemplarische Ausführung von konzeptionellen Überlegungen und Hinweisen für die Umsetzung. Abschließend werden mögliche Wirkungen und der präventive Nutzen dargestellt und Bezug zur Bedeutung für das Tätigkeitsfeld der Sozialen Inklusion genommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Soziale Unsicherheit
- 2.1 Begriffsbestimmung und Differenzialdiagnosen
- 2.2 Epidemiologie
- 2.3 Ätiologie und Risikofaktoren
- 2.4 Verlauf und Prognose
- 3. Gruppentraining sozialer Kompetenzen
- 3.1 Bedeutung für die Zielgruppe
- 3.2 Zielsetzung
- 3.3 Konzeptionelle Überlegungen
- 4. Fazit
- 5. Literatur- und Quellennachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Hausarbeit ist die Darstellung des Gruppentrainings sozialer Kompetenzen als Intervention bei Kindern mit „Sozialer Unsicherheit“. Die Arbeit untersucht die Häufigkeit subklinischer Sozialer Ängste in der Kindheit und Jugend und die Möglichkeiten, drohenden pathologischen Entwicklungen durch präventive Programme vorzubeugen.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von "Sozialer Unsicherheit", "Sozialen Ängsten" und "Sozialer Phobie"
- Epidemiologie, Ätiologie, Verlauf und Prognose "Sozialer Unsicherheit"
- Bedeutung sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche mit "Sozialer Unsicherheit"
- Zielsetzungen und Ansätze des Gruppentrainings sozialer Kompetenzen
- Konzeptionelle Überlegungen und Hinweise für die Umsetzung des Gruppentrainings
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Gruppentraining sozialer Kompetenzen als Intervention bei Kindern mit "Sozialer Unsicherheit" vor. Sie betont die Bedeutung präventiver Programme angesichts der Häufigkeit subklinischer Sozialer Ängste in der Kindheit und Jugend.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Symptomatik der "Sozialen Unsicherheit" und grenzt diese anhand einer Klassifikation der "Sozialen Phobie" als klinisches Störungsbild nach ICD-10 und DSM-IV ab. Es werden die Epidemiologie, die ätiologische Entwicklung sowie der Verlauf und die Prognose "Sozialer Unsicherheit" dargestellt.
Kapitel 3 erörtert die Bedeutung sozialer Kompetenzen für die Zielgruppe der sozial unsicheren Kinder und Jugendlichen. Es werden Zielsetzungen und Ansätze des Gruppentrainings sozialer Kompetenzen erläutert, ergänzt durch konzeptionelle Überlegungen und Hinweise für die Umsetzung.
Schlüsselwörter
Soziale Unsicherheit, Soziale Ängste, Soziale Phobie, Gruppentraining sozialer Kompetenzen, Intervention, Prävention, Kinder, Jugendliche, ICD-10, DSM-IV, Epidemiologie, Ätiologie, Risikofaktoren, Verlauf, Prognose, soziale Kompetenzen, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen sozialer Unsicherheit und einer sozialen Phobie?
Soziale Unsicherheit beschreibt oft subklinische Ängste, während die soziale Phobie ein klinisch definiertes Störungsbild nach ICD-10 oder DSM-IV darstellt.
Welches Ziel verfolgt ein Gruppentraining sozialer Kompetenzen?
Das Training zielt darauf ab, soziale Ängste abzubauen, die soziale Interaktionsfähigkeit zu verbessern und pathologischen Entwicklungen präventiv vorzubeugen.
Warum ist Prävention bei Kindern mit sozialen Ängsten so wichtig?
Da soziale Ängste in der Kindheit häufig vorkommen, können präventive Programme verhindern, dass sich diese zu chronischen psychischen Störungen im Erwachsenenalter auswachsen.
Welche Rolle spielt die soziale Inklusion bei diesen Trainings?
Die Steigerung sozialer Kompetenzen ermöglicht es den betroffenen Kindern, besser am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und Ausgrenzung zu vermeiden.
Wie sieht die Prognose für sozial unsichere Kinder aus?
Mit frühzeitiger Intervention und gezieltem Kompetenztraining ist die Prognose gut, soziale Ängste erfolgreich zu bewältigen und die Lebensqualität zu steigern.
- Citation du texte
- Katrin Weidner (Auteur), 2010, "Soziale Unsicherheit bewältigen- Kompetenzen steigern". Gruppentraining sozialer Kompetenzen als Intervention bei Kindern mit sozial unsicheren Verhaltensweisen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455421