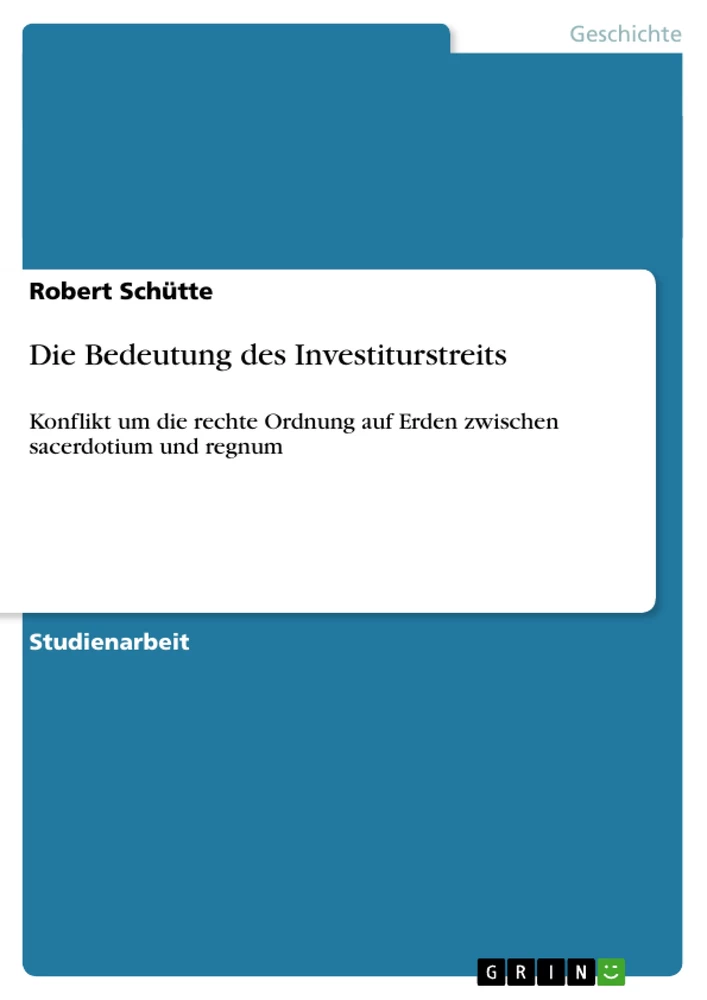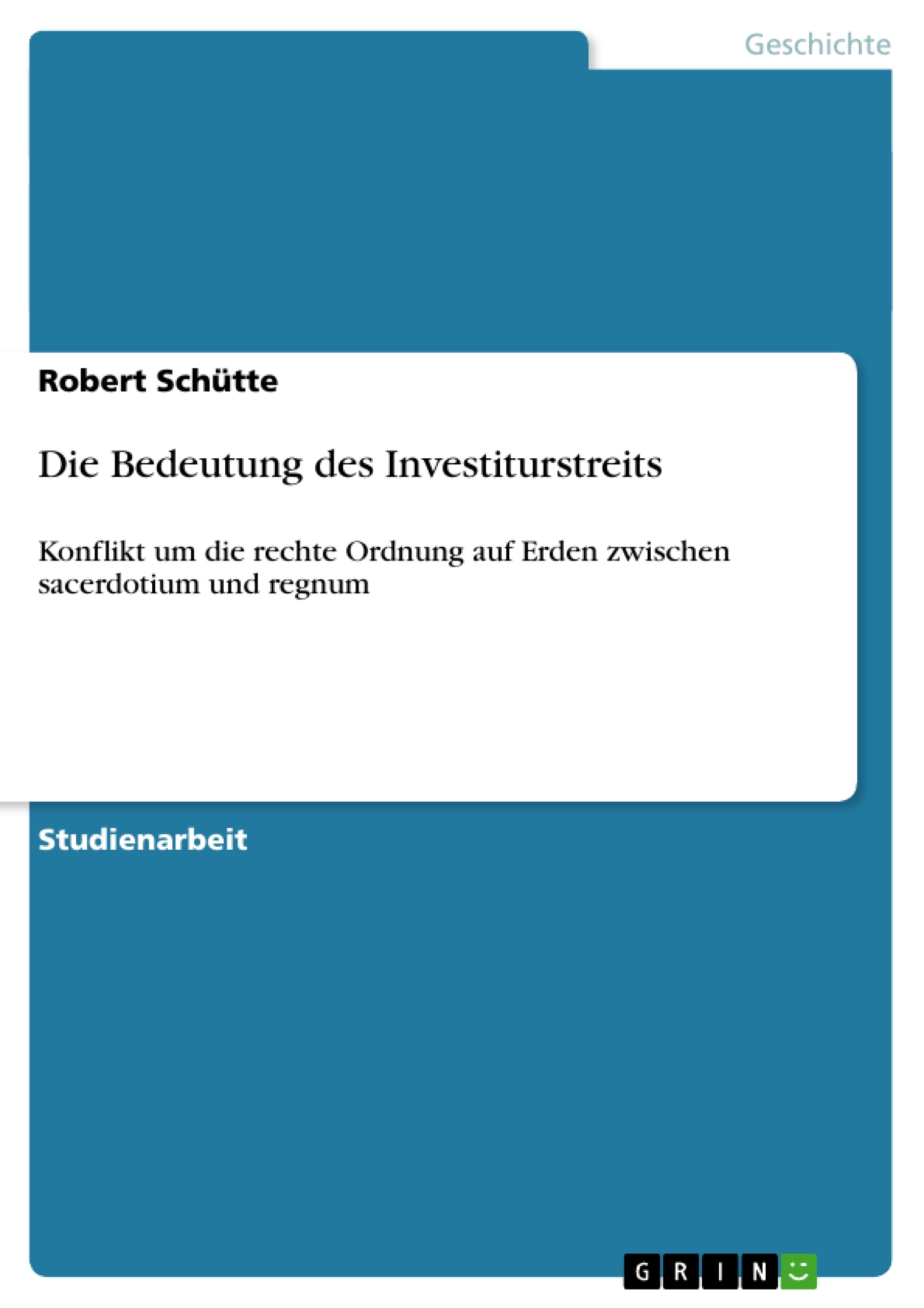Der Investiturstreit bezeichnet den vom Tod Heinrichs III. (1056) bis zum Ausgang der Regierung Heinrichs V. (1125) andauernden Konflikt zwischen Papsttum und Königtum, in dessen Verlauf es zu einer Neubestimmung des Verhältnisses der beiden Universalgewalten kam. Er entzündete sich ursprünglich an den Modalitäten der Einsetzung von Bischöfen und Reichsäbten, hatte jedoch darüber hinaus weit tiefergehende ideologisch-politische Ursachen. Die vorliegende Arbeit wird den im Investiturstreit zu Tage getretenen Ordnungskonflikt zwischen Regnum und Sacerdotium beleuchten und auf diesem Weg zu einer Einschätzung der Bedeutung des Investiturstreits gelangen. Hierzu wird zuerst das Selbstbild der beiden Universalgewalten vor dem Investiturstreit zu untersuchen und gegenüberzustellen sein. In einem zweiten Schritt wird die vorliegende Arbeit auf ausgesuchte Aspekte und Ereignisse des Investiturstreits eingehen, welche geeignet sind, ein adäquates Bild der Vorkommnisse, ihrer Perzeption und Bedeutung zu liefern. In diesem Zusammenhang wird die Arbeit den Wandel der gelasianischen Zweigewaltenlehre aus Sicht des Papsttums und des Königtums, das Dictatus Papae und den Gang nach Canossa behandeln. In einem letzten Schritt wird in der vorliegenden Abhandlung ein Resümee gezogen, in welchem die Ergebnisse der Arbeit und ihre Bedeutung für das Verhältnis von Sacerdotium und Regnum in Kürze erläutert werden. Auf Grund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit musste es im Vorhinein zu einer Selektion jener zu untersuchenden Aspekte des Investiturstreits kommen, welche dem Verfasser als für diese Themenstellung besonders aussagekräftig und bedeutend erschienen. Aus diesem Grund erhebt diese Arbeit auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstbilder der Universalgewalten vor dem Investiturstreit
- Selbstbild des Königtums vor dem Investiturstreit
- Selbstbild des Papsttums vor dem Investiturstreit
- Die Bedeutung des Dictatus Papae
- Die Bedeutung des Gangs nach Canossa
- Umwandlung der gelasianischen Zweigewaltenlehre
- Resümee und Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Investiturstreit, einen Konflikt zwischen Papsttum und Königtum, der zu einer Neubestimmung des Verhältnisses beider Universalgewalten führte. Sie analysiert die Selbstbilder beider Mächte vor dem Streit, beleuchtet wesentliche Ereignisse wie den Dictatus Papae und den Gang nach Canossa und zeigt die Wandlung der gelasianischen Zweigewaltenlehre auf. Schließlich wird ein Resümee der Ergebnisse gezogen.
- Das Selbstbild des Königtums vor dem Investiturstreit
- Das Selbstbild des Papsttums vor dem Investiturstreit
- Der Dictatus Papae und seine Bedeutung
- Der Gang nach Canossa als Wendepunkt
- Die Wandlung der gelasianischen Zweigewaltenlehre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Investiturstreit als Konflikt zwischen Papsttum und Königtum dar, der zu einer Neubestimmung des Verhältnisses beider Universalgewalten führte. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der Selbstbilder der beiden Mächte vor dem Streit, die Analyse der wichtigen Ereignisse des Investiturstreits sowie die Wandlung der gelasianischen Zweigewaltenlehre.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Selbstbilder des Königtums und des Papsttums vor dem Investiturstreit. Das Königtum sah sich als von Gott eingesetzt und betrachtete den König als mit einer besonderen Mission ausgestattet. Die Legitimation der Herrschergewalt wurde direkt von Gott hergeleitet, was sich in der mit der Salbung verbundenen Herrscherweihe und der Dei-gratia-Formel manifestierte.
Das Papsttum hingegen betrachtete die Kirche als „Braut Christi“ und sah sich dem Königtum überlegen. Dieser Glaube resultierte aus der Vorstellung, dass die Kirche vom Geist Christi durchwirkt sei und die Fähigkeit habe, Menschen zu neuem geistlichen Leben zu erwecken.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Dictatus Papae, einem Dokument, das die päpstliche Autorität unterstreicht und die Grenzen des königlichen Einflusses auf die Kirche definiert. Das vierte Kapitel behandelt den Gang nach Canossa, ein Schlüsselereignis des Investiturstreits, das die Machtverhältnisse zwischen Papst und Kaiser veränderte.
Das fünfte Kapitel analysiert die Wandlung der gelasianischen Zweigewaltenlehre. Diese Lehre besagt, dass Papst und Kaiser jeweils über unterschiedliche, aber gleichrangige Autorität verfügen. Der Investiturstreit führte jedoch zu einer Neuinterpretation dieser Lehre, die die Vorrangstellung des Papsttums in geistlichen Fragen stärker betonte.
Schlüsselwörter
Investiturstreit, Papsttum, Königtum, Universalgewalten, Sacerdotium, Regnum, Dictatus Papae, Gang nach Canossa, Gelasianische Zweigewaltenlehre, Selbstbild, Machtverhältnis, Herrschaft, Kirche, Glaube, Theologie, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern des Investiturstreits?
Es war ein Konflikt zwischen Papsttum (Sacerdotium) und Königtum (Regnum) über das Recht, Bischöfe und Äbte in ihre Ämter einzusetzen (Investitur).
Was ist das „Dictatus Papae“?
Ein Dokument von Papst Gregor VII., das die universale Vormachtstellung des Papstes über die gesamte Kirche und sogar über weltliche Herrscher postulierte.
Welche Bedeutung hat der Gang nach Canossa?
Der Bußgang Heinrichs IV. im Jahr 1077 markiert einen symbolischen Tiefpunkt der kaiserlichen Macht und einen Sieg der päpstlichen Autorität im Streit der Universalgewalten.
Was besagt die gelasianische Zweigewaltenlehre?
Ursprünglich besagte sie, dass geistliche und weltliche Macht getrennt und gleichrangig nebeneinander bestehen; im Investiturstreit wurde sie zugunsten des Papsttums neu interpretiert.
Wie sah sich das Königtum vor dem Streit selbst?
Der König sah sich als von Gott unmittelbar eingesetzt („Dei Gratia“), was ihm eine sakrale Stellung und das Recht zur Einsetzung von Geistlichen verlieh.
Wie endete der Investiturstreit?
Der Konflikt führte zu einer grundlegenden Neubestimmung des Verhältnisses von Staat und Kirche, die im Wormser Konkordat (1122) einen vorläufigen Abschluss fand.
- Quote paper
- Robert Schütte (Author), 2004, Die Bedeutung des Investiturstreits, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45546