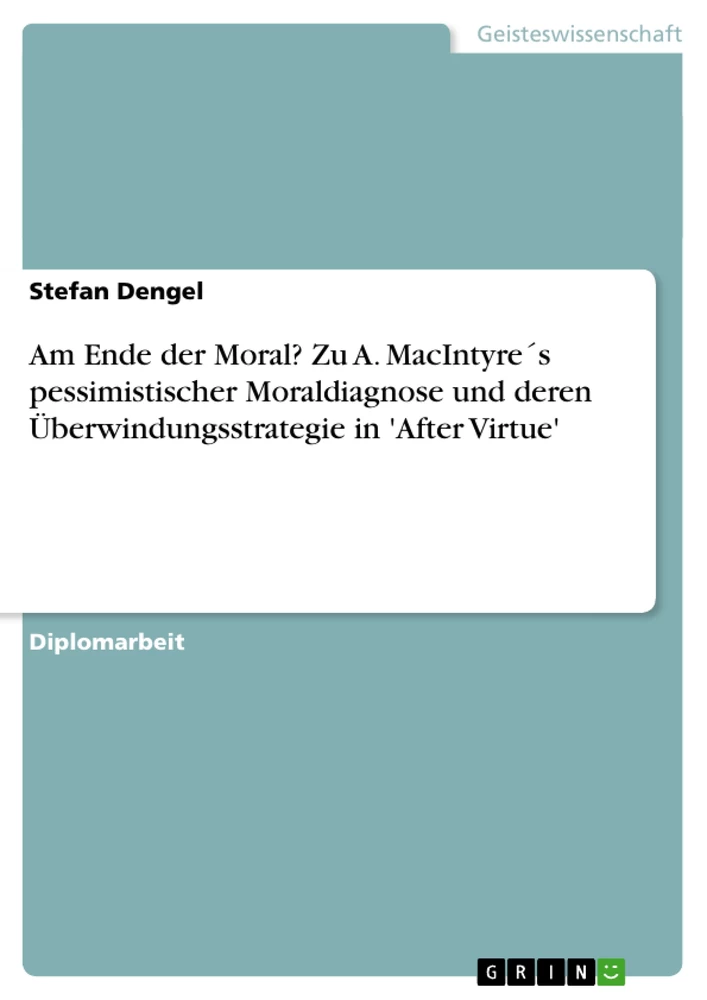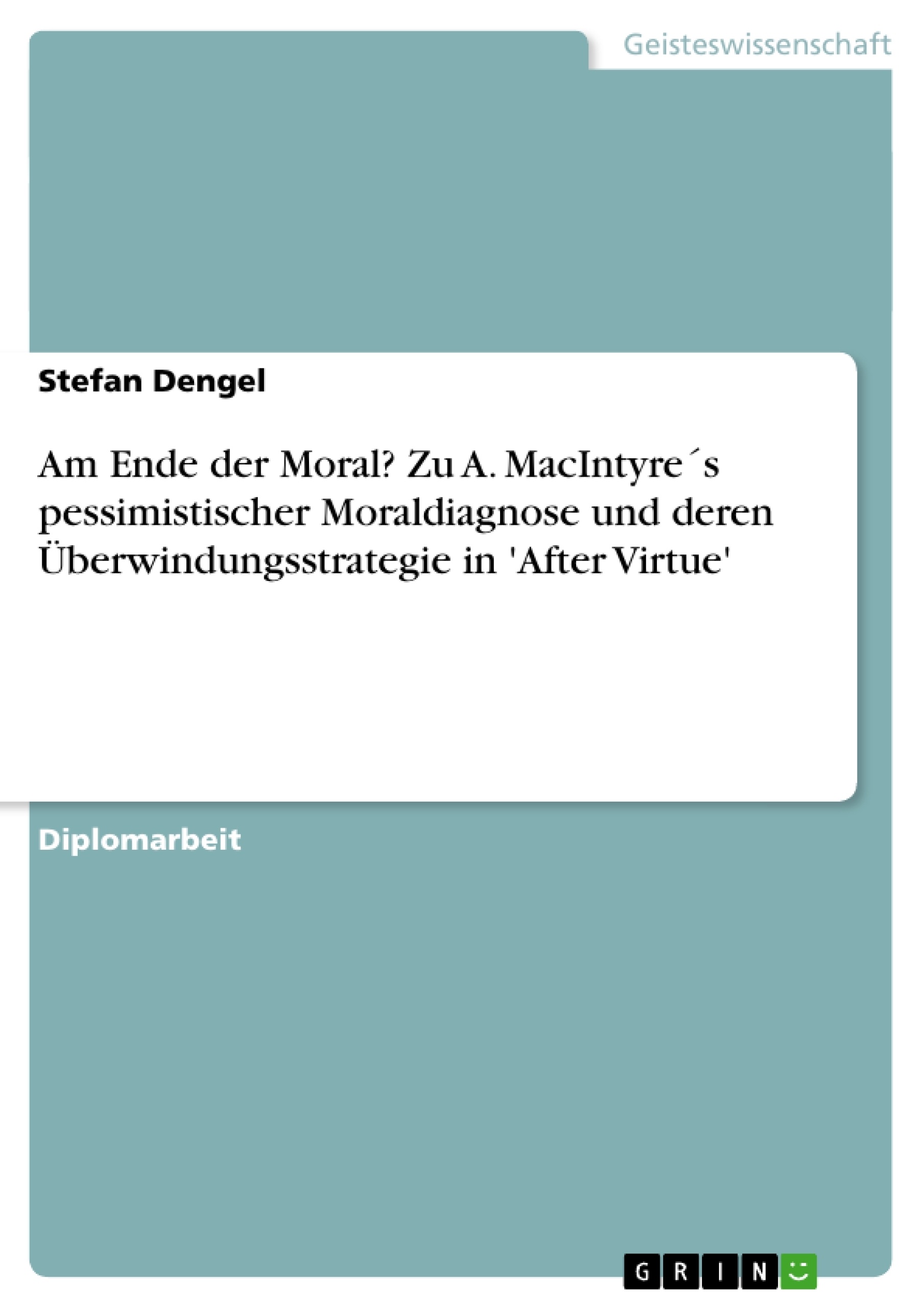Mit dem angeblichen Beweis dafür, daß die westlichen Gegenwartsgesellschaften ihre Moral unwiederbringlich verloren haben, hat „After Virtue“ seinem Autor Alasdair MacIntyre 1981 schlagartig einen exponierten Platz in der angelsächsischen Moralphilosophie beschert. Seine Untersuchung ist im Kontext der neoaristotelischen Versuche zur Revitalisierung einer Tugendethik (virtue ethics) zu sehen, deren Ziel es ist, die in der Neuzeit vergessene ethische Zentralkategorie der Tugend wieder zu einem moralischen Angelpunkt zu machen. Dementsprechend steht bei diesen Entwürfen der Charakter der Handelnden im Schlaglicht des Interesses. Vor dem Hintergrund eines gesteigerten Bewußtseins hinsichtlich der Probleme ausschließlich handlungsorientierter Ethiken entwickelten sich in den letzten 25 Jahren im nord-amerikanischen Raum verschiedene Tugendethikentwürfe, die im letzten Jahrzehnt auch im deutschsprachigen Raum auf ein großes Interesse stießen. „After Virtue“ kann zu den Initialwerken dieser Strömung gerechnet werden, wobei es aufgrund seiner Interdisziplinarität in einem bedeutenden Maße auch zum Aufschwung des Kommunitarismus beigetragen hat.
Allein daher ist es nicht verwunderlich, daß MacIntyre seine Analyse mit einer Kritik an der gegenwärtigen Moralität beginnt und dann die Ursachen dieses Zustandes zu analysieren versucht. Seiner Meinung nach besteht das Problem darin, daß spätestens nach Kant „der Verlust der Tugend“ die ganze Ethik in eine Orientierungskrise gestürzt hat. Zu seinem Ziel, der Begründung der Vorrangstellung der Tugend(en) in einer Ethik, gehört dementsprechend sowohl der Beweis, daß eine Normbegründung mit tugendausschließenden Theorien zwangsläufig scheitern müsse, als auch, daß mit einer Tugendethik alle ge- und verbotenen Normen schlüssig abgeleitet werden können.
In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob die Diagnose MacIntyres über den Zustand der Gegenwartsmoral zutreffend ist und ob sein Konzept zur Revitalisierung einer Tugendethik erfolgreich sein kann. Bei der Diskussion über die Möglichkeiten zur Verwirklichung und über die Konsequenzen von MacIntyres Konzeption stellt sich explizit die Frage nach dem Verhältnis zwischen tugendethischen und normenethischen Begründungsansätzen: Genügt eine tugendethische Reform der bisherigen normenethischen Ansätze oder bedarf es einer konsequenten Ablösung dieser Theorien durch eine tugendethische Revolution?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Reform oder Revolution?
- Eine Einführung in die Problemstellung
- 2. Philosophie oder Propaganda?
- Über Intentionen und Methoden
- 2.1 Der Erkenntnisweg zur Lebensaufgabe
- 2.2 Konzeption, Methode und Darstellungsweise
- 3. Die Demontage des „Projekts der Aufklärung“.
- Darstellung und Ursachenanalyse des jetzigen moralischen Verfallszustandes
- 3.1 Die emotivistische Gegenwartskultur
- 3.1.1 Das moralische Dilemma als Ansatzpunkt
- 3.1.2 Der Emotivismus als Ursachenanalyse
- 3.1.3 Die postmoderne Anthropologie als Fundierung
- 3.2 Die geschichtsphilosophische Darstellung der Aufklärung:
- 3.2.1 Der geschichtsphilosophische Ansatz als Untersuchungsmethode
- 3.2.1.1 Das Untersuchungsformat
- 3.2.1.2 Die rationale Aufklärung
- 3.2.1.3 Die sensualistische Aufklärung
- 3.2.2 Die neue Rationalität als Ursache und Systemfehler
- 3.2.2.1 Die These in der Diskussion
- 3.3 Das moralische Defizit der modernen Gegenwartsgesellschaften
- 3.3.1 Die vorherrschenden Ethiken als Katalysatoren des Dilemmas
- 3.3.2 Die Gesellschaftsordnung als soziologische Grundbedingung der Ethik
- 3.4 „Nietzsche oder Aristoteles?“ Eine kritische Zwischenbilanz
- 4. Ein völlig anderer Ansatz?
- Die Revitalisierung der aristotelischen Tugendethik
- 4.1 Die klassische Tradition der Tugendbegründung
- 4.2 Ein modernes Tugendkonzept
- 4.2.1 Die Kerndefinition der Tugenden durch den Begriff der Praxis
- 4.2.2 Die zweite Definitionsebene als das lebenslange Streben nach dem Guten
- 4.2.3 Die Rahmendefinition der Tradition
- 4.3 Kritische Anfragen
- 4.3.1 Die mangelnde Normativität der strukturellen Teleologie
- 4.3.2 Die Problematik der narrativen Struktur
- 4.3.3 Praxen, Tugenden und ihre Realitätsnähe
- 4.4 Eine überzeugende Alternative?
- 5. Licht am Ende des Tunnels?
- Das Ende von „After virtue“ zwischen Agonie und Konstruktivismus
- 5.1 Eine Degenerationsgeschichte als Traditionsvergleich
- 5.2 Die Soziologie als Grundlagenproblem
- 5.3 Ein konstruktiver Überwindungsversuch?
- 6. Moral am Ende?
- Standortbestimmung und Ausblick von „After Virtue“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der pessimistischen Moraldiagnose von Alasdair MacIntyre in seinem Werk „After Virtue“. MacIntyre argumentiert, dass die moderne Gesellschaft aufgrund des „Verlustes der Tugend“ in eine tiefe moralische Krise geraten ist. Ziel der Arbeit ist es, MacIntyres Diagnose zu analysieren und seine Überwindungsstrategie, die auf einer Revitalisierung der aristotelischen Tugendethik basiert, zu bewerten.
- Die Ursachen des moralischen Verfalls in der modernen Gesellschaft
- MacIntyres Kritik an der Aufklärung und ihren Folgen
- Die Relevanz der Tugend für eine funktionierende Moral
- Die Möglichkeiten und Grenzen einer tugendethischen Reform
- Die Rolle des Kommunitarismus in MacIntyres Konzept
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problematik, die von MacIntyre in „After Virtue“ aufgezeigt wird. Der Autor stellt die Grundthese des Buches vor, nämlich den Verlust der Tugend in der modernen Gesellschaft, und ordnet diese im Kontext der neoaristotelischen Versuche zur Revitalisierung der Tugendethik ein.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden die Intentionen und Methoden von MacIntyre analysiert. Es wird auf den Erkenntnisweg des Autors zur Lebensaufgabe sowie auf die Konzeption, Methode und Darstellungsweise von „After Virtue“ eingegangen.
- Kapitel 3: Hier werden MacIntyres Thesen zur Demontage des „Projekts der Aufklärung“ dargestellt. Die Analyse umfasst die emotivistische Gegenwartskultur, die geschichtsphilosophische Darstellung der Aufklärung und die Ursachen des moralischen Defizits der modernen Gesellschaften. Des Weiteren wird auf die vorherrschenden Ethiken als Katalysatoren des Dilemmas und die Gesellschaftsordnung als soziologische Grundbedingung der Ethik eingegangen. Das Kapitel schließt mit einer kritischen Zwischenbilanz, in der MacIntyres Argumentation mit den Positionen von Nietzsche und Aristoteles verglichen wird.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit der Revitalisierung der aristotelischen Tugendethik als alternativer Ansatz zur Lösung der moralischen Krise. MacIntyres Konzeption eines modernen Tugendkonzepts wird dargestellt und kritisch beleuchtet.
- Kapitel 5: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf MacIntyres Überwindungsstrategie. Die Analyse umfasst die Degenerationsgeschichte als Traditionsvergleich, die Soziologie als Grundlagenproblem und den konstruktiven Überwindungsversuch des Autors.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Moralphilosophie, Tugendethik, Kommunitarismus, Aufklärung, Postmoderne, Geschichte der Moral und die Analyse des Werks "After Virtue" von Alasdair MacIntyre. Weitere wichtige Begriffe sind Emotivismus, Rationalität, Tugendbegriff, Praxis und Überwindungsstrategien für die moralische Krise der modernen Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These von Alasdair MacIntyres „After Virtue“?
MacIntyre argumentiert, dass die westliche Gesellschaft ihre moralische Sprache und Tradition unwiederbringlich verloren hat und sich in einer tiefen Orientierungskrise befindet, die er als „Verlust der Tugend“ bezeichnet.
Warum kritisiert MacIntyre die Aufklärung?
Er behauptet, dass das „Projekt der Aufklärung“ gescheitert ist, weil es versuchte, moralische Normen rein rational zu begründen, ohne den sozialen und teleologischen Kontext der Tugenden zu berücksichtigen.
Was versteht MacIntyre unter „Emotivismus“?
Emotivismus ist die Lehre, dass alle moralischen Urteile nichts anderes als Ausdruck von persönlichen Gefühlen oder Einstellungen sind, was laut MacIntyre den heutigen moralischen Verfallszustand prägt.
Wie will MacIntyre die Tugendethik revitalisieren?
Er schlägt eine Rückkehr zu einer aristotelisch geprägten Ethik vor, die auf den Begriffen der „Praxis“, der „narrativen Einheit des Lebens“ und der „Tradition“ basiert.
Was ist der Unterschied zwischen Tugendethik und Normenethik?
Während die Normenethik sich auf Regeln und Gebote konzentriert, stellt die Tugendethik den Charakter des Handelnden in den Mittelpunkt. Die Arbeit fragt, ob eine Reform der Normenethik ausreicht oder eine tugendethische Revolution nötig ist.
- Arbeit zitieren
- Stefan Dengel (Autor:in), 2004, Am Ende der Moral? Zu A. MacIntyre´s pessimistischer Moraldiagnose und deren Überwindungsstrategie in 'After Virtue', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45552