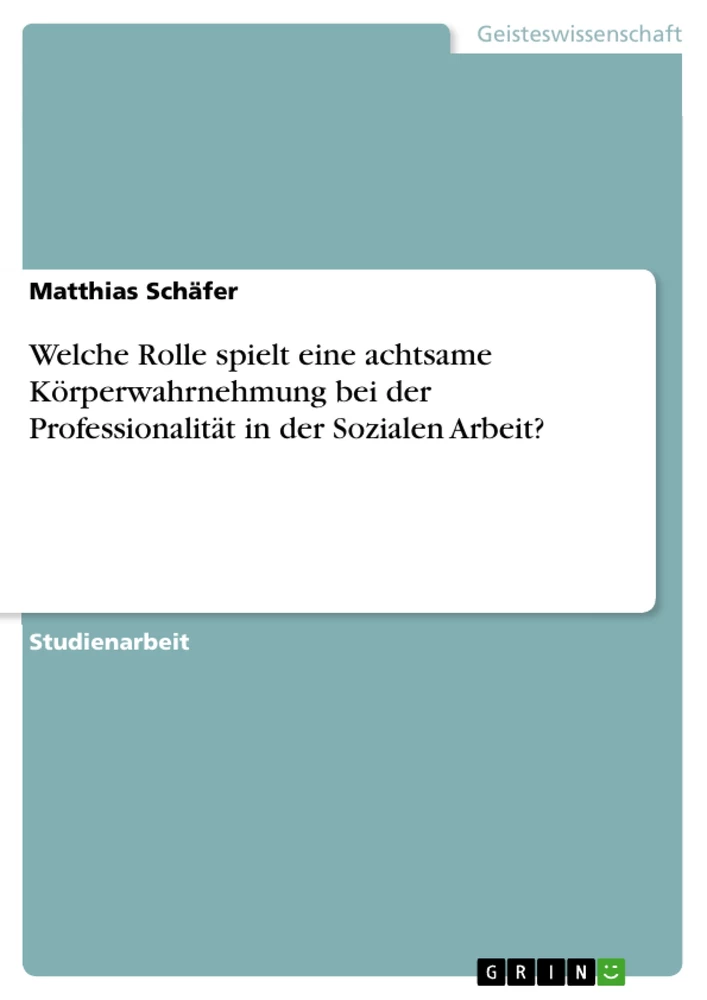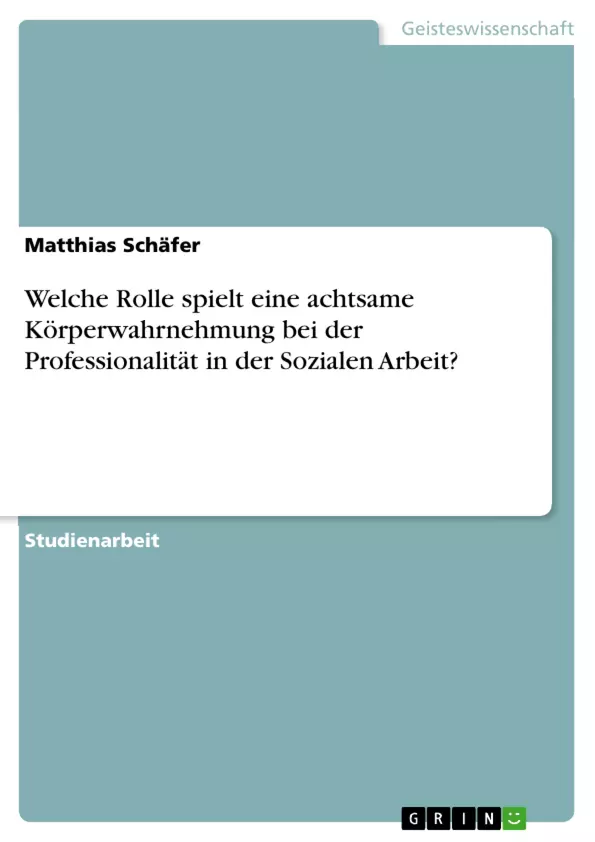Welche Bedeutung hat der Umgang mit dem eigenen Körper für die Professionalität von Arbeitern im sozialen Bereich? Besonders in diesem Arbeitsfeld ist es oft schwierig, stets professionell zu handeln. Eine Überforderung in manchen Situationen kann oft körperliche Auswirkungen zur Folge haben. Inwiefern kann ein gewisses Maß an Achtsamkeit dem Körper gegenüber diesem Missstand vorbeugen?
Diese Arbeit gibt einen theoretischen Überblick über die Themengebiete Professionalität in der Sozialen Arbeit, achtsame Körperwahrnehmung und Supervision. Schließlich werden anhand einer eigenen Fragebogenstudie Daten zur Thematik erhoben und ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Professionalität in der Sozialen Arbeit
- 2.1.1 Verständnis von professionellem Handeln in der Sozialen Arbeit
- 2.1.2 Leibliche Identitätsbildung und Professioneller Habitus
- 2.2 Achtsame Körperwahrnehmung und professionelles Handeln
- 2.3 Supervision als professionelle Reflexionsform
- 3 Empirische Studie
- 3.1 Forschungsfrage und Hypothesen
- 3.2 Untersuchungsziel und Untersuchungsmethode
- 3.3 Beschreibung der Stichprobe
- 4 Ergebnisse
- 5 Diskussion
- 5.1 Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung achtsamer Körperwahrnehmung in der Supervision für die Entwicklung von Professionalität in der Sozialen Arbeit. Die Arbeit zielt darauf ab, durch eine empirische Studie den Zusammenhang zwischen achtsamer Körperwahrnehmung und Professionalität in der Sozialen Arbeit zu untersuchen.
- Professionalität in der Sozialen Arbeit
- Achtsame Körperwahrnehmung
- Supervision als professionelle Reflexionsform
- Empirische Untersuchung zur Bedeutung von achtsamer Körperwahrnehmung in der Supervision
- Zusammenhang zwischen achtsamer Körperwahrnehmung und Professionalität in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Zunächst wird das Konzept der Professionalität in der Sozialen Arbeit betrachtet, wobei das Verständnis von professionellem Handeln und der Einfluss der leiblichen Identitätsbildung auf den professionellen Habitus beleuchtet werden. Anschließend wird die Bedeutung achtsamer Körperwahrnehmung für professionelles Handeln diskutiert. Das Kapitel schließt mit einer Betrachtung der Supervision als professionelle Reflexionsform.
Kapitel 3 beschreibt die empirische Studie. Es werden die Forschungsfrage und die Hypothesen, die Untersuchungsziele und -methoden sowie die Stichprobenerhebung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Sozialen Arbeit, darunter Professionalität, achtsame Körperwahrnehmung, Supervision, empirische Forschung, Professionalitätsentwicklung und die Rolle des Körpers in der sozialen Arbeit.
- Citar trabajo
- Matthias Schäfer (Autor), 2017, Welche Rolle spielt eine achtsame Körperwahrnehmung bei der Professionalität in der Sozialen Arbeit?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455656