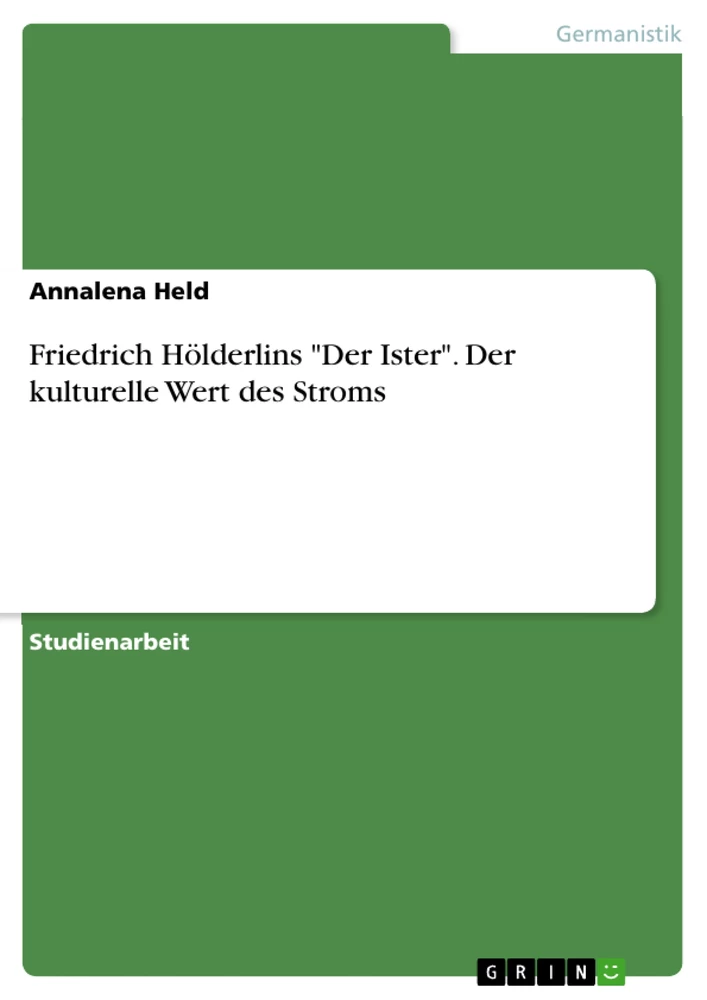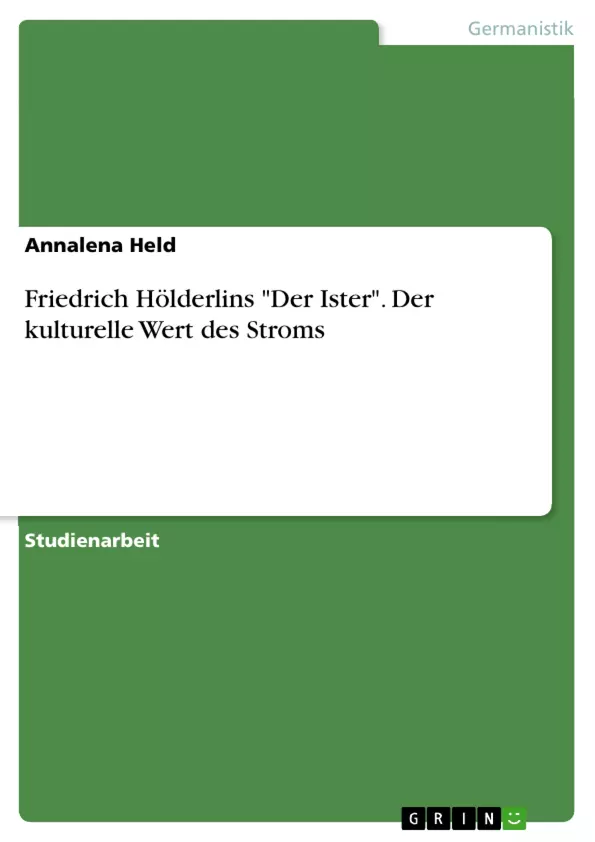Die Hymne vom Ister von Friedrich Hölderlin wurde von ihm nie veröffentlicht und hat im Entwurf noch keine Überschrift. Norbert von Hellingrath veröffentlichte es und gab dem Gedicht den Titel "Der Ister", da dieser auch direkt im Text benannt wird. Das Gedicht besteht aus vier Strophen, wobei die vierte vermutlich unvollendet ist. Ebenso ist unklar, ob sie die Schlussstrophe sein soll. "Der Ister" gehört zu den Stromgesängen wie zum Beispiel auch "Der Rhein". Außerdem gehört das Gedicht zusammen mit Die Wanderung und Am Quell der Donau zu den Donauhymnen. Es ist das späteste der Stromgedichte. Sattler datiert es auf den Herbst 1804, Uffhausen auf den Herbst 1805 und Beissner auf den Sommer 1803.2 Die Donauhymnen enthalten die Leitvorstellung, dass die Kultur aus dem Osten, aus Asien über Griechenland nach Deutschland kam. Das möchte ich anhand einzelner Punkte im Gedicht "Der Ister" erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Metapher des Feuers
- Die Bedeutung des Gesangs
- Der ökonomische Wert des Stroms
- Der Strom als Richtungsgeber
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Analyse von Hölderlins „Der Ister“ zielt darauf ab, den kulturellen Wert des Stroms in der Dichtung des Autors zu untersuchen. Das Gedicht, ein spätes Stromgedicht, befasst sich mit der Verbindung zwischen antiker und germanischer Kultur, wobei der Ister als Metapher für den Fluss der Geschichte und der kulturellen Entwicklung dient.
- Die Metapher des Feuers und ihre Verbindung zur griechischen Leidenschaft
- Die Bedeutung des Gesangs als Ausdruck von Kultur und nationale Identität
- Die Rolle des Stroms als Richtungsgeber und Symbol für den kulturellen Austausch
- Der Kontrast zwischen der „allzugeduldigen“ Donau und der Dynamik der griechischen Kultur
- Die Suche nach dem „Schiklichen“ als Ausdruck der deutschen Kulturleistung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Gedicht „Der Ister“ vor und erläutert seine Entstehungsgeschichte und seinen Kontext innerhalb der Stromgedichte Hölderlins. Außerdem wird der Bezug zu den Donauhymnen und die Leitvorstellung von der kulturellen Entwicklung aus dem Osten nach Deutschland hergestellt.
Die Metapher des Feuers
Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung des Feuers als Metapher für die griechische Leidenschaft, die im Gedicht als notwendiges Element für die Entstehung des vaterländischen Gesangs dargestellt wird. Der Kontrast zwischen Feuer und Strom wird hier bereits deutlich.
Die Bedeutung des Gesangs
Der Gesang wird als Ausdruck von Kultur und nationaler Identität interpretiert. Die Rolle der Dichter wird beleuchtet und ihre Aufgabe, die Völker durch ihre Worte zu wecken und zu verändern, beschrieben.
Der ökonomische Wert des Stroms
Dieser Abschnitt behandelt die ökonomische Bedeutung des Stroms und seine Rolle als Verkehrsader. Der Ister wird als Symbol für die Verbindung zwischen verschiedenen Kulturen und Regionen verstanden.
Der Strom als Richtungsgeber
Der Strom wird als Metapher für die kulturelle Entwicklung und den Austausch zwischen verschiedenen Kulturen interpretiert. Der Kontrast zwischen der „allzugeduldigen“ Donau und der Dynamik der griechischen Kultur wird weiter ausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen des Textes sind: Hölderlin, „Der Ister“, Stromgedichte, Donauhymnen, kultureller Wert, Metapher, Feuer, Gesang, Nationalität, Kultur, Antike, Germanistik, Leidenschaft, Vernunft, Schikliches.
- Quote paper
- Annalena Held (Author), 2017, Friedrich Hölderlins "Der Ister". Der kulturelle Wert des Stroms, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455712