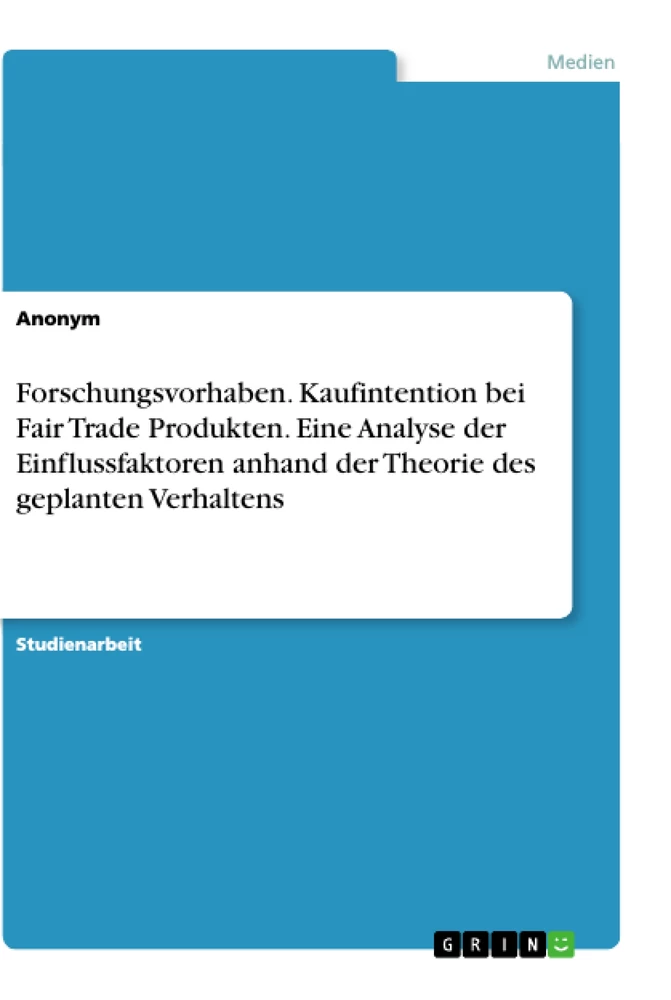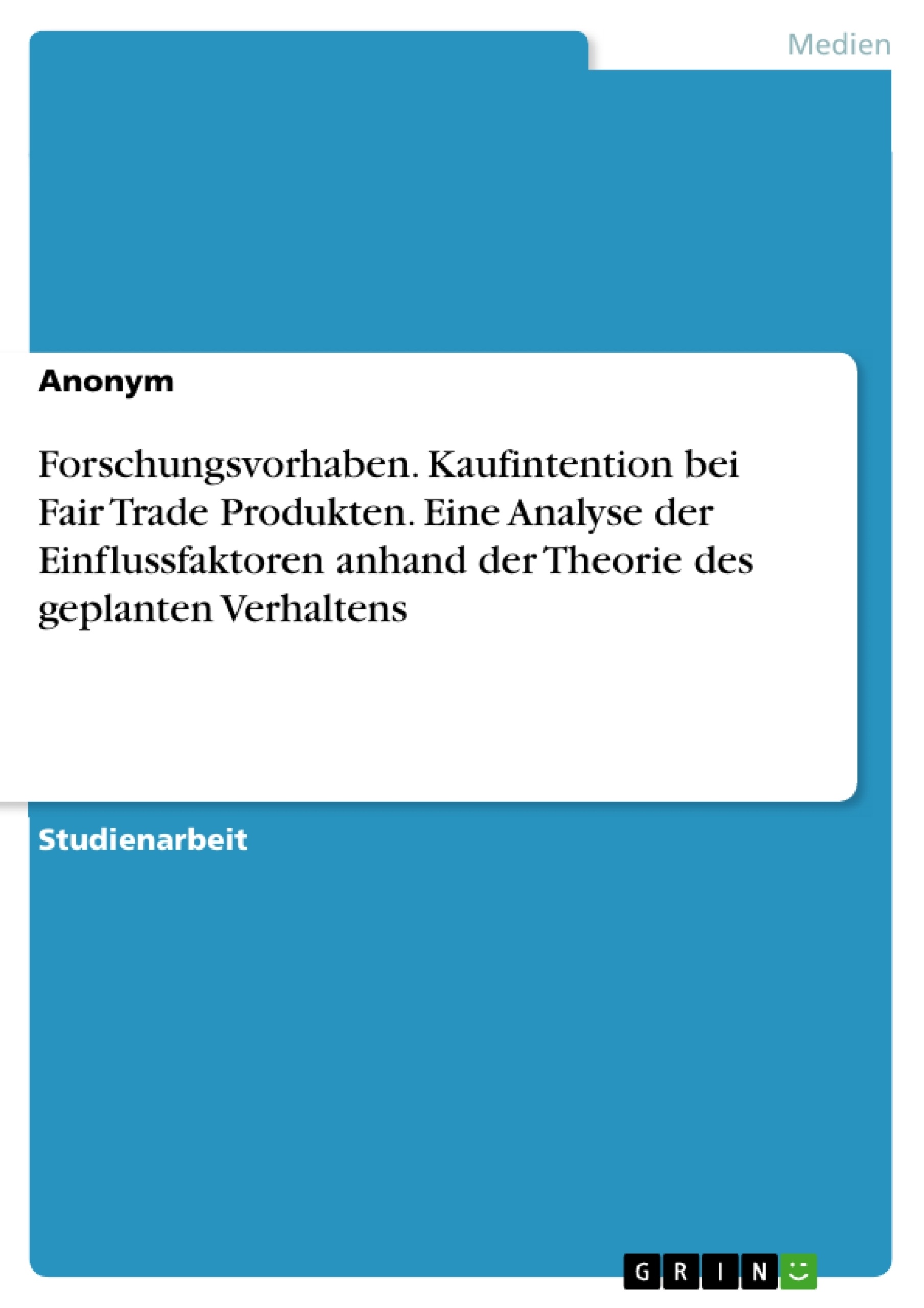Der Umsatz von Fair Trade Produkten in Deutschland ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz konnten beispielsweise im Jahr 2016 durch den Verkauf von Fair Trade Produkten erzielt werden (TransFair e.V., 2016). In der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse 2017 gaben 14% der Befragten an, dass sie beim Einkauf darauf achten, ob die Produkte aus fairem Handel stammen (Institut für Demoskopie Allensbach, 2017).
Die World Fair Trade Organization definiert Fair Trade als „a trading partnership, based on dialogue, transparency and respect, that seeks greater equity in international trade. It contributes to sustainable development by offering better trading conditions to, and securing the rights of, marginalized producers and workers“ (World Fair Trade Organization, 2015).
Bei fair gehandelten Produkten soll also unter Einbezug der Rechte und Arbeitsbedingungen von wirtschaftlich benachteiligten Erzeugern Nachhaltigkeit gefördert werden. Das Prinzip der Nachhaltigkeit vereint wiederum ökonomische, ökologische und soziale Perspektiven: Während sich der ökonomische Aspekt auf faire Preise für Erzeuger und Konsumenten bezieht, steht beim ökologischen Aspekt der Schutz von Umwelt und Tieren im Vordergrund. Die soziale Komponente kann als eine Form sozialer Akzeptanz beschrieben werden, da es hier um eine Übereinstimmung von Produktionsprozessen mit den Bedürfnissen und Prioritäten der Gesellschaft geht (Vermeir & Verbeke, 2008).
In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass auch wenn Konsumenten eine positive Einstellung gegenüber nachhaltigen Produkten aufweisen, es dennoch zu einer Abweichung des Verhaltens kommen kann: Robinson und Smith (2002) identifizierten in ihrer Studie mangelnde Verfügbarkeit, Gewohnheit, Misstrauen, Kosten und Bequemlichkeit als mögliche Kaufbarrieren. Die Diskrepanz zwischen der Einstellung einer Person und ihrem tatsächlichen Verhalten wird auch als Einstellungs-Verhaltenslücke bezeichnet: Einstellungen allein sagen das Verhalten in speziellen Situationen nur schlecht vorher (Ajzen, 1991), weshalb weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen.
Ziel der vorliegenden Hausarbeit soll es daher sein, unter Rückbezug auf die Theorie des geplanten Verhaltens ein Forschungsdesign zur Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Kaufintention von Fair Trade Lebensmitteln zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie und Forschungsstand
- Ziel und Vorgehen des Forschungsvorhabens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Untersuchung der Kaufintention von Fair Trade Produkten, insbesondere von Fair Trade Kaffee. Die Arbeit zielt darauf ab, ein Forschungsdesign zu entwickeln, das die Einflussfaktoren auf die Kaufintention von Studierenden anhand der Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) untersucht.
- Einflussfaktoren auf die Kaufintention von Fair Trade Produkten
- Anwendbarkeit der Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) auf den Kontext von Fair Trade Produkten
- Rolle von moralischen Normen bei der Kaufentscheidung von Fair Trade Produkten
- Entwicklung eines Forschungsdesigns zur Untersuchung der Kaufintention von Fair Trade Kaffee
- Analyse der Schlüsselvariablen der TPB im Kontext von Fair Trade Produkten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet den steigenden Umsatz von Fair Trade Produkten in Deutschland und stellt die Bedeutung des Fair Trade Konzepts im Kontext von Nachhaltigkeit und sozialer Akzeptanz dar.
Theorie und Forschungsstand
Dieser Abschnitt stellt die Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) als theoretischen Rahmen für die Untersuchung der Kaufintention vor. Er erläutert die Schlüsselfaktoren der TPB, wie Einstellung, subjektive Norm und wahrgenommene Verhaltenskontrolle, und beleuchtet deren Einfluss auf die Intention und das Verhalten. Weiterhin wird der Forschungsstand hinsichtlich der Anwendbarkeit der TPB auf verschiedene Verhaltensbereiche beleuchtet, wobei der Fokus auf die Bedeutung moralischer Normen für die Kaufentscheidung liegt.
Ziel und Vorgehen des Forschungsvorhabens
Hier werden das Ziel des Forschungsvorhabens, die Untersuchung der Kaufintention von Studierenden bei Fair Trade Kaffee, und die Vorgehensweise des Forschungsdesigns vorgestellt. Die Auswahl des Fair Trade Produkts Kaffee wird begründet und die Relevanz der TPB für die Untersuchung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokus-Themen dieser Arbeit sind Fair Trade, Kaufintention, Theorie des geplanten Verhaltens (TPB), moralische Normen, Nachhaltigkeit, soziale Akzeptanz, Einstellung, subjektive Norm, wahrgenommene Verhaltenskontrolle, Forschungsdesign.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Forschungsvorhaben. Kaufintention bei Fair Trade Produkten. Eine Analyse der Einflussfaktoren anhand der Theorie des geplanten Verhaltens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456103