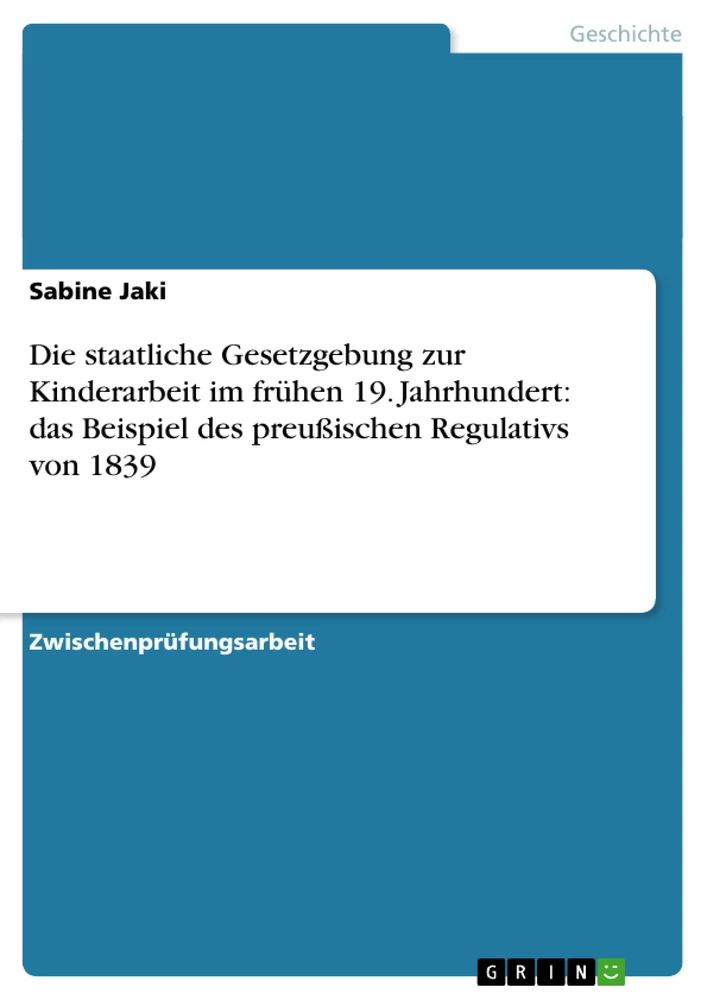Mit dem aufsteigenden Kapitalismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde es erstmals möglich, Kinder massenhaft auszubeuten. Zuvor arbeiteten sie weitgehend im Heimgewerbe, in der familiären Hauswirtschaft und der Landwirtschaft. Dort erlernten sie elementare Produktionsweisen und arbeiteten unter der Aufsicht ihrer Eltern, jedoch noch nicht als Lohnarbeiter.
Kinderarbeit gab es also schon vor dem 19. Jahrhundert, doch hier hatte sie ihren Höhepunkt. Industrielle Kinderarbeit wurde damals, aus verschiedenen Gründen, als selbstverständlich angesehen. Diese Gründe werde ich als Einstieg in das Thema meiner Arbeit beschreiben, da sie die Grundlage für das späte Einsetzen einer staatlichen Gesetzgebung sind.
Ausgehend von den verschiedenen Ansichten zur Kinderarbeit, welche in diesen Erläuterungen deutlich werden, werde ich, im anschließenden Kapitel, auf Bemühungen einiger Unternehmer und Staatsmänner eingehen. Hier wird deutlich, dass das erste Kinderschutzgesetz nicht allein von staatlicher Seite initiiert wurde, sondern durch die Unternehmungen einzelner Industrieller und des Rheinischen Provinziallandtages. Ich beschreibe des Weiteren den Verlauf der ersten Kinderschutz Debatte dieses Landtages näher, da hier das Gesetz zum Schutze jugendlicher Arbeiter vorformuliert wurde. Die kontroversen Ansichten der einzelnen Teilnehmer spiegeln das Denken der Gesellschaft wieder.
Ich werde in meiner Arbeit auch die Verhandlungen in den Berliner Ministerien beschreiben, durch welche schließlich am 21.12.1838, in einer Staatsministerialsitzung , ein Gesetzesentwurf verabschiedet wurde, der zum Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabrikenwurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gründe für die Selbstverständlichkeit industrieller Kinderarbeit
- 3. Die Zustände der arbeitenden Kinder
- 4. Die Genese des ersten Kinderschutzgesetzes
- 4.1. Der Verlauf der Kinderschutzdebatte im Rheinischen Provinziallandtag 1837
- 4.2. Die Verhandlungen in den Berliner Ministerien 1838/1839
- 5. Das Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die staatliche Gesetzgebung zur Kinderarbeit im frühen 19. Jahrhundert am Beispiel des preußischen Regulativs von 1839. Sie beleuchtet die Gründe für die lange Zeit als selbstverständlich angesehene industrielle Kinderarbeit und analysiert den Entstehungsprozess des ersten Kinderschutzgesetzes, unter Berücksichtigung der Debatten im Rheinischen Provinziallandtag und den Verhandlungen in den Berliner Ministerien.
- Die Gründe für die Akzeptanz industrieller Kinderarbeit im frühen 19. Jahrhundert.
- Die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen, die zur Kinderarbeit führten.
- Der politische Prozess der Gesetzgebung zum Schutz minderjähriger Arbeiter.
- Die Rolle verschiedener Akteure (Staat, Unternehmer, Eltern) in der Debatte um Kinderarbeit.
- Der Inhalt und die Bedeutung des preußischen Regulativs von 1839.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der staatlichen Gesetzgebung zur Kinderarbeit im frühen 19. Jahrhundert ein und skizziert den Fokus der Arbeit auf das preußische Regulativ von 1839. Sie betont die zuvor verbreitete Akzeptanz von Kinderarbeit und kündigt die Untersuchung der Gründe hierfür und den Prozess der Gesetzesfindung an.
2. Gründe für die Selbstverständlichkeit industrieller Kinderarbeit: Dieses Kapitel erörtert die vielfältigen Faktoren, die zur weitverbreiteten und lange Zeit akzeptierten Kinderarbeit im frühen 19. Jahrhundert beitrugen. Es werden wirtschaftliche Aspekte wie Massenarmut, billige Arbeitskräfte und der Konkurrenzkampf der Industrie mit sozialen und ideologischen Aspekten wie der vermeintlichen pädagogischen Wert der Arbeit und dem Mangel an sozialer Frage im Bewusstsein der Zeit verbunden. Die Kapitel unterstreicht, wie diese Faktoren dazu beitrugen, dass Staat, Industrie und selbst Eltern die Kinderarbeit lange tolerierten, trotz der bestehenden Gesetze, die als unzureichend galten.
3. Die Zustände der arbeitenden Kinder: Dieses Kapitel beschreibt die schwierigen Bedingungen, unter denen Kinder in Fabriken arbeiteten. Es stützt sich auf historische Berichte, die das Leid der Kinder detailliert schildern und aufzeigen, welche physischen und moralischen Schäden die Kinder durch die Arbeit erlitten. Der Mangel an Aufmerksamkeit auf diese Berichte unterstreicht die damalige gesellschaftliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der arbeitenden Kinder.
4. Die Genese des ersten Kinderschutzgesetzes: Dieses Kapitel schildert den Entstehungsprozess des ersten Kinderschutzgesetzes, indem es die Debatten im Rheinischen Provinziallandtag von 1837 und die Verhandlungen in den Berliner Ministerien 1838/1839 detailliert beschreibt. Es beleuchtet die kontroversen Meinungen der Beteiligten und zeigt, wie verschiedene Interessen und Perspektiven zum Prozess der Gesetzgebung beitrugen. Der Fokus liegt auf der Vorformulierung des Gesetzes im Landtag und den schlussendlichen Verhandlungen, die zur Verabschiedung eines Gesetzesentwurfs führten.
5. Das Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter: Dieses Kapitel wird den Inhalt und die Bedeutung des Regulativs von 1839 detailliert analysieren, seinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen von Kindern untersuchen und seine Stärken und Schwächen im Hinblick auf den Kinderschutz beleuchten. Es wird die Bedeutung des Regulativs als ersten Schritt in Richtung eines umfassenderen Kinderschutzes und die damit verbundenen sozialen und politischen Implikationen diskutieren.
Schlüsselwörter
Kinderarbeit, Industrielle Revolution, Preußen, Gesetzgebung, Kinderschutz, Regulativ 1839, Rheinischer Provinziallandtag, Berliner Ministerien, soziale Frage, Massenarmut, Industriearbeit, Arbeitsschutz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über die Genese des ersten preußischen Kinderschutzgesetzes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die staatliche Gesetzgebung zur Kinderarbeit im frühen 19. Jahrhundert in Preußen, insbesondere die Entstehung des Regulativs von 1839. Sie analysiert die Gründe für die lange Zeit als selbstverständlich angesehene industrielle Kinderarbeit und den politischen Prozess der Gesetzesfindung, einschließlich der Debatten im Rheinischen Provinziallandtag und in den Berliner Ministerien.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Gründe für die Akzeptanz industrieller Kinderarbeit (wirtschaftliche und soziale Faktoren, Ideologien), die Zustände der arbeitenden Kinder, den politischen Prozess der Gesetzgebung (Rolle verschiedener Akteure), den Inhalt und die Bedeutung des preußischen Regulativs von 1839 und dessen Auswirkungen auf den Kinderschutz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem einzelnen Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung: Einführung in das Thema und die Forschungsfrage. 2. Gründe für die Selbstverständlichkeit industrieller Kinderarbeit: Analyse der wirtschaftlichen, sozialen und ideologischen Faktoren. 3. Die Zustände der arbeitenden Kinder: Beschreibung der Arbeitsbedingungen und des Leids der Kinder. 4. Die Genese des ersten Kinderschutzgesetzes: Detaillierte Darstellung der Debatten im Rheinischen Provinziallandtag und in den Berliner Ministerien. 5. Das Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter: Analyse des Inhalts und der Bedeutung des Regulativs von 1839. 6. Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Rolle spielten der Rheinische Provinziallandtag und die Berliner Ministerien bei der Entstehung des Gesetzes?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Debatten und Verhandlungen im Rheinischen Provinziallandtag (1837) und den Berliner Ministerien (1838/1839), die zu der Entstehung des Kinderschutzgesetzes führten. Sie beleuchtet die kontroversen Meinungen und die verschiedenen Interessen der Beteiligten.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit zeigt die komplexen Ursachen für die lange Akzeptanz von Kinderarbeit auf und analysiert den mühsamen Prozess der Gesetzgebung als ersten Schritt zum Kinderschutz in Preußen. Sie beleuchtet die Bedeutung des Regulativs von 1839 als Meilenstein, unterstreicht aber auch dessen Grenzen und Schwächen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Kinderarbeit, Industrielle Revolution, Preußen, Gesetzgebung, Kinderschutz, Regulativ 1839, Rheinischer Provinziallandtag, Berliner Ministerien, soziale Frage, Massenarmut, Industriearbeit, Arbeitsschutz.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die sich mit der Geschichte der Kinderarbeit, der Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts und der Entwicklung des Kinderschutzes beschäftigen.
Wo finde ich mehr Informationen zu diesem Thema?
(Hier könnten Sie weitere Quellen oder Literaturhinweise hinzufügen)
- Quote paper
- Sabine Jaki (Author), 2005, Die staatliche Gesetzgebung zur Kinderarbeit im frühen 19. Jahrhundert: das Beispiel des preußischen Regulativs von 1839, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45624