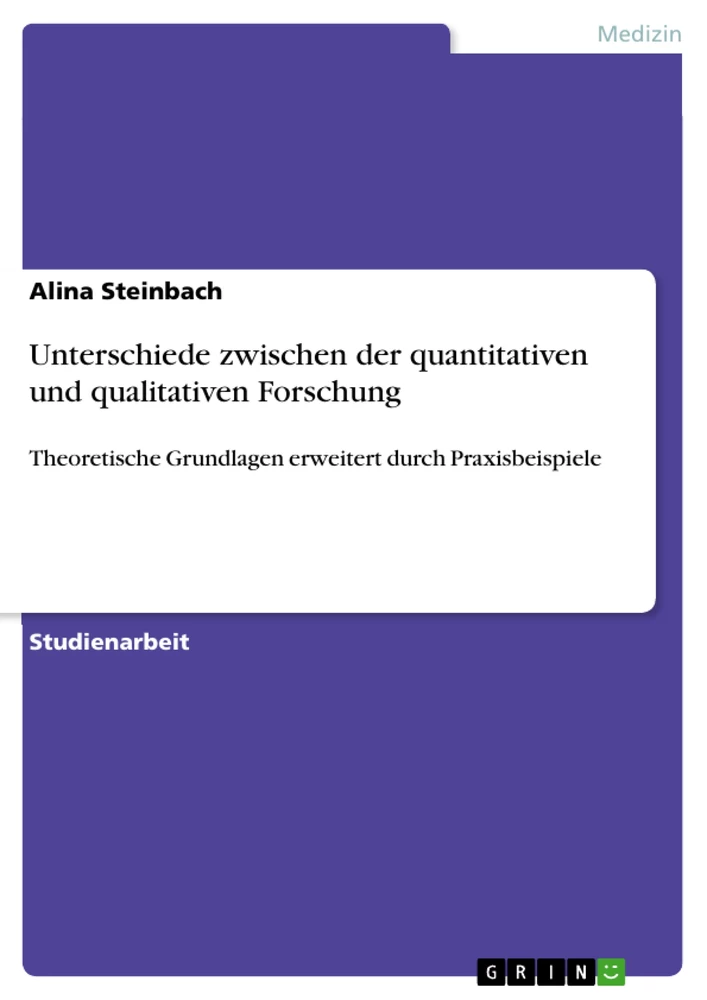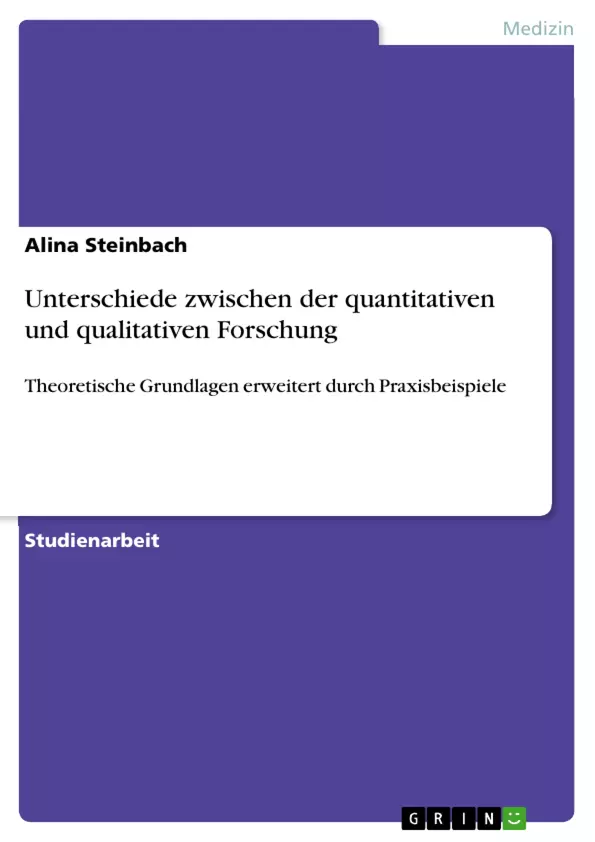Zu Beginn der Arbeit beschäftigt sich die Autorin mit der Begriffsdefinition der qualitativen und quantitativen Forschung.
Anschließend vergleicht sie die beiden Forschungen miteinander, bevor sie jeweils eine Forschungsstudie vorstellt. Die Autorin legt den Schwerpunkt auf die Forschungsstudien, da diese ihr Interesse besonders geweckt haben und hier die Forschungen in die Praxis umgesetzt werden. Somit werden für den Leser die Unterschiede zwischen der quantitativen und qualitativen Forschung verdeutlicht.
Das Fazit beschreibt die Ausarbeitung des Vergleichs der Forschungsmethoden und den Studien, sowie einen Ausblick auf weitergehende Fragestellungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Thematik
- Qualitative und quantitative Forschung
- Qualitative Forschung
- Quantitative Forschung
- Gegenüberstellung der Forschungen
- Vorstellung von Forschungsstudien
- Qualitative Studie: Wissen und Wissensvermittlung von Öko-Landwirten
- Fragestellung der Studie
- Methode und Auswertung der Studie
- Ergebnisse der Studie
- Quantitative Studie: Namensgebung im kulturellen Wandel
- Fragestellung der Studie
- Methode und Auswertung der Studie
- Ergebnisse der Studie
- Qualitative Studie: Wissen und Wissensvermittlung von Öko-Landwirten
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich mit den Unterschieden zwischen quantitativer und qualitativer Forschung auseinander. Ziel ist es, die beiden Forschungsansätze zu definieren, ihre jeweiligen Stärken und Schwächen aufzuzeigen und anhand von Praxisbeispielen die Anwendung in konkreten Forschungsprojekten zu veranschaulichen.
- Definition und Abgrenzung von qualitativer und quantitativer Forschung
- Vergleich der beiden Forschungsansätze hinsichtlich Methoden, Datenerhebung und -analyse
- Anwendung von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden in Praxisstudien
- Bewertung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Forschungsansätze
- Die Rolle der Kombination von quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die historische und philosophische Debatte über die Gleichwertigkeit von qualitativer und quantitativer Forschung. Die Kapitel zwei und drei widmen sich der detaillierten Beschreibung und Gegenüberstellung der beiden Forschungsansätze. Kapitel zwei behandelt die qualitative Forschung, die sich mit dem menschlichen Erleben, Denken und Handeln sowie der subjektiven Bedeutung befasst. Es werden verschiedene qualitative Methoden wie Interviews, Gruppendiskussionen und Beobachtungen vorgestellt. Kapitel drei beleuchtet die quantitative Forschung, die sich mit der Messung und Analyse von Daten beschäftigt. Es werden die Prinzipien der Datenerhebung und -analyse sowie die Anwendung statistischer Methoden erläutert. Die Kapitel zwei und drei werden durch konkrete Beispiele aus der Praxis illustriert. Kapitel zwei behandelt eine qualitative Studie über das Wissen und die Wissensvermittlung von Öko-Landwirten, während Kapitel drei eine quantitative Studie zur Namensgebung im kulturellen Wandel vorstellt.
Schlüsselwörter
Qualitative Forschung, quantitative Forschung, Methodenvergleich, Datenerhebung, Datenauswertung, Praxisbeispiele, Wissen, Wissensvermittlung, Namensgebung, kultureller Wandel.
- Quote paper
- Alina Steinbach (Author), 2018, Unterschiede zwischen der quantitativen und qualitativen Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456264