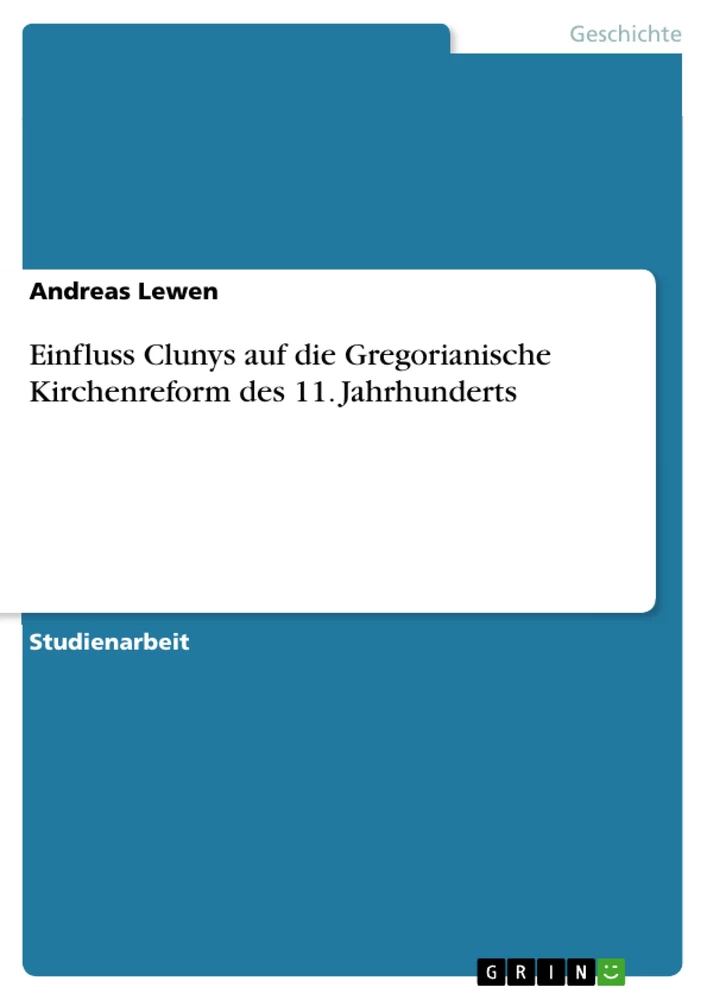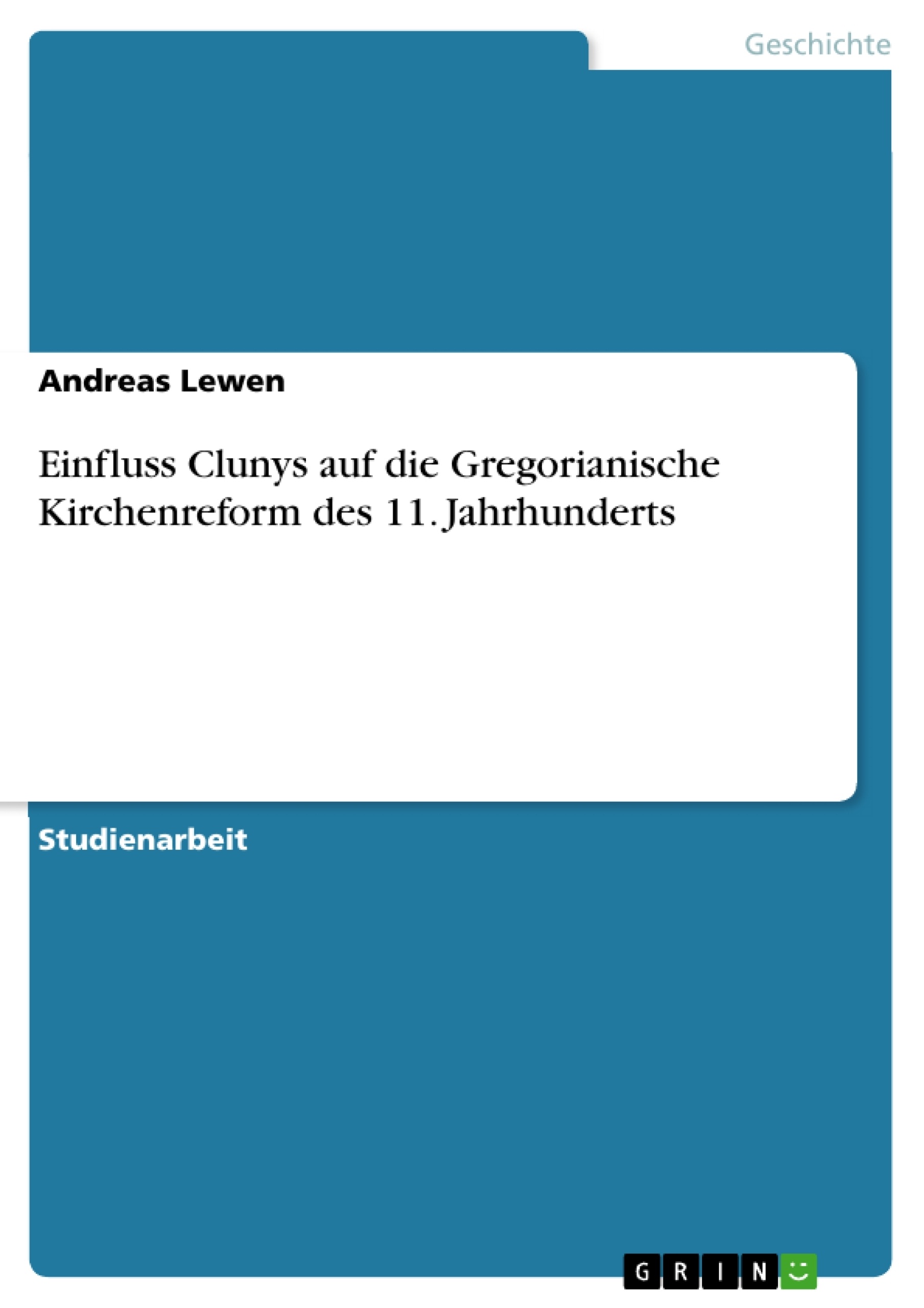Die Gregorianischen Reformen – benannt nach ihrem einflussreichsten Verfechter Papst Gregor VII (1073-1085) – waren der Gipfel jener Prozesse, die zur Überwindung des europäischen Frühmittelalters und zur Gestaltung der institutionellen Kirche führten, die sich zumindest in ihrem Kern das kommende Jahrtausend nicht verändern sollte. Die Trennung zwischen Staat und Kirche erscheint heute als etwas Selbstverständliches; doch war es für lange Zeit üblich, dass sich weltliche Herrscher (Laien) für die Vergabe kirchlicher Ämter verantwortlich sahen, ja sogar daraus Profit schlugen, indem sie linientreue Bischöfe oder Äbte erhoben, um ihre politische Machtbasis dadurch abzusichern. In den Fünfzigerjahren des 11. Jahrhunderts wurden nun mehr und mehr Stimmen laut, welche diese „frühmittelalterliche Verflechtung von geistlicher und weltlicher Rechtssphäre“ als einen untragbaren Zustand anprangerten. Freilich teilten weltliche Herrscher, allen voran der Kaiser, diesen Unmut nicht; im Gegenteil: Es kam zum berühmten Investiturstreit, der zumindest vor dem Hintergrund des Hauptziels der „Gregorianer“ (der Aufhebung der Laieninvestitur) zu Gunsten der Kirche entschieden wurde, und somit fortan weltliche Fürsten kaum mehr Einfluss auf die Besetzung kirchlicher Ämter hatten.
Ungefähr zur gleichen Zeit wuchs eine im französischen Burgund entsprossene monastische Reformbewegung zu einem der mächtigsten und einflussreichsten Klöstern des Mittelalters heran, die sich von vornherein seit ihrer Gründung jedwedem weltlichen Einfluss entzog und auf die Gründung eines autonomen, mehr oder minder zentralistischen Klostersystems aus war. Jedes cluniazensische Kloster war allein dem Papst unterstellt; somit waren Kaiser und König jegliches
Mitspracherecht bei personellen Entscheidungen des Klosters entzogen. Plakativ formuliert: Cluny hatte und verteidigte von Anfang an das, wofür gregorianische Reformer so verbissen kämpften – Autonomie.
Nun drängen sich unweigerlich Fragen nach gewissen Einflussnahmen der einen auf die andere Reformbewegung auf. Beteiligten sich Clunys Äbte aktiv nicht nur an der Agitation für die libertas ecclesiae (Kirchenfreiheit), sondern auch an den übrigen, innerkirchlichen Reformideen jener Zeit, namentlich der Kampf gegen Simonie und Nikolaitismus? Oder bleibt der cluniazensische Einfluss auf die Kirchenreformer des 11. Jhd. nur passiver bzw. indirekter Natur?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die monastischen Reformen aus Cluny
- Zeit des Reformpapsttums – Die Gregorianische Reform
- Von Burgund nach Rom? - Ein Fazit
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der monastischen Reformen aus Cluny auf die Gregorianische Kirchenreform des 11. Jahrhunderts. Sie analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Reformbewegungen und untersucht, inwieweit Cluny die Gregorianer in ihrem Streben nach Kirchenfreiheit und der Reform innerkirchlicher Missstände beeinflusste.
- Die cluniazensische Reformbewegung und ihre Ziele
- Die Gregorianische Reform und ihre zentralen Aspekte
- Die Rolle des Papstes und der weltlichen Herrscher
- Die Bedeutung des Konzepts der Kirchenfreiheit (libertas ecclesiae)
- Der Einfluss von Cluny auf die Gregorianer
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Gregorianischen Reformen und die Bedeutung der Kirchenfreiheit ein. Sie beschreibt die Situation der Kirche im 11. Jahrhundert, die von einem Machtverfall des Papsttums und einer starken Verflechtung von Kirche und Staat geprägt war. Die Einleitung beleuchtet zudem die Entstehung der Gregorianischen Reformen und den Investiturstreit als zentrale Konfliktlinie.
2. Die monastischen Reformen aus Cluny
Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der cluniazensischen Reformbewegung. Es beschreibt die Gründung des Klosters Cluny im 9. Jahrhundert und die Ausweitung zu einem mächtigen Klosterverband. Das Kapitel beleuchtet die spezifische Lebensart der Cluniazenser-Mönche, ihre Strenge Askese und ihre Abgrenzung von weltlichem Einfluss. Es wird zudem die Bedeutung der Exemtionsprivilegien für die Unabhängigkeit des cluniazensischen Klosterverbandes analysiert.
3. Zeit des Reformpapsttums – Die Gregorianische Reform
Dieses Kapitel widmet sich der Gregorianischen Reform und den Reformen unter Papst Gregor VII. Es beleuchtet die zentralen Ziele der Reformen, die sich auf die Reform des Papsttums und die Durchsetzung der Kirchenfreiheit fokussierten. Der Kampf gegen Simonie und Nikolaitismus sowie die Konflikte mit dem Kaiser werden ausführlich diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Cluniazensische Reform, Gregorianische Reform, Kirchenfreiheit, Investiturstreit, Simonie, Nikolaitismus, Papsttum, Kirchenstaat, Cluny, Frankreich, Italien, Europa, 11. Jahrhundert.
- Quote paper
- Andreas Lewen (Author), 2017, Einfluss Clunys auf die Gregorianische Kirchenreform des 11. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456340