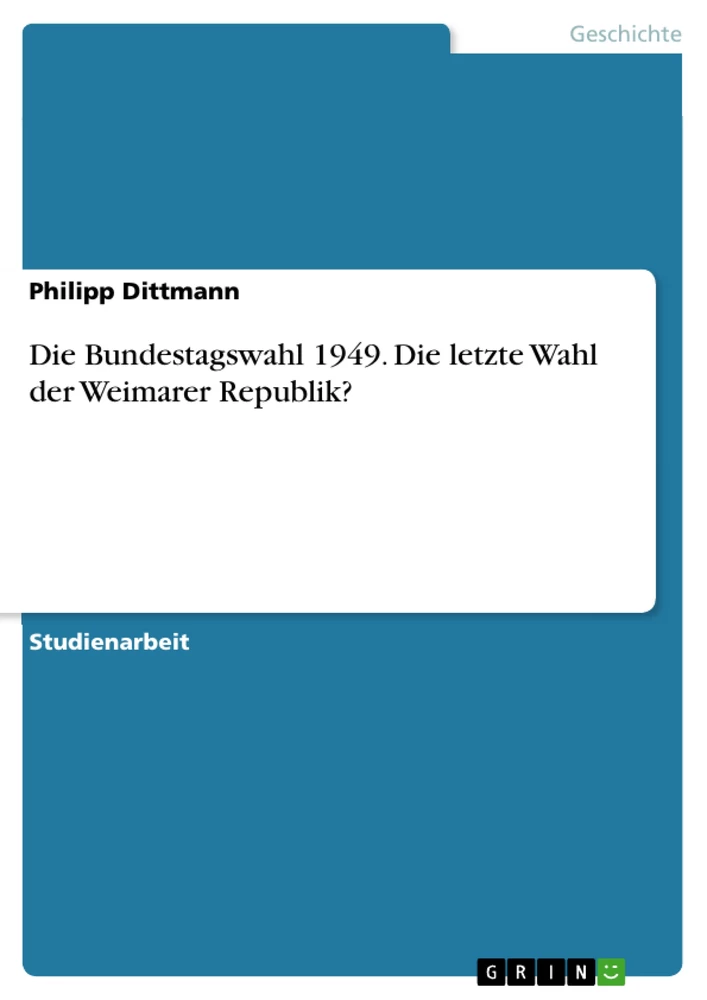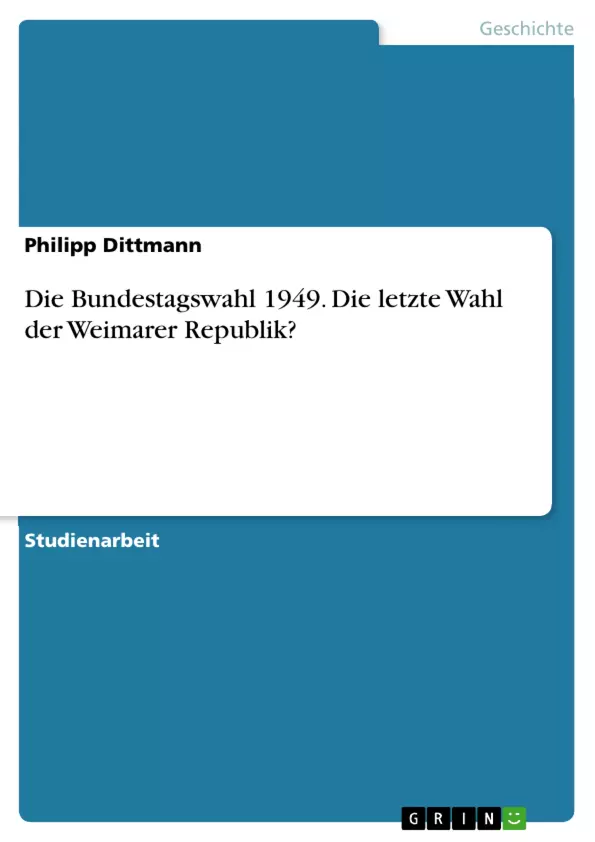Die Arbeit untersucht, ob es Zusammenhänge zwischen den Wahlkämpfen der Weimarer Republik und der ersten Bundestagswahl von 1949 gibt.
Um eine Antwort auf die Forschungsfrage dieser Arbeit zu finden, sollen in Kapitel eins zunächst Grundlagen geklärt werden, die für die Beantwortung notwendig sind. Hier soll es zunächst um die Parteiensysteme von 1949 und Weimar gehen. Der Wahlkampf wird schließlich von den Parteien getragen und handelt um diese. Diese gestalten ihn und somit lenken sie ihn auch in eine bestimmte Richtung. Hier ist die Frage zu stellen, ob das Parteiensystem von Weimar 1949 übernommen wurde oder ob es Erneuerung gab, die dann auch den Wahlkampf beeinflussen. Der nächste Teil soll in Grundzügen den Wahlkampf der Weimarer Republik darstellen. Auf Grund der Kürze der Arbeit kann hier selbstverständlich nur ein grober Überblick geschaffen werden, welcher aber dennoch nützlich sein soll für einen Vergleich mit 1949.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das schwere Erbe von Weimar
- Parteienlandschaft von Weimar im Vergleich zu 1949
- Polemik und die Härte des Wahlkampfs von Weimar
- Der Bundestagswahlkampf von 1949
- Ausgangslage
- „Lügenauer“ - Der Wahlkampf 1949
- Fazit
- Abbildungen
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Bundestagswahl von 1949 als „letzte Wahl der Weimarer Republik“ betrachtet werden kann oder ob signifikante Unterschiede und Erneuerungen zu beobachten sind. Es wird untersucht, ob die Angst vor einem zweiten Weimar gerechtfertigt war oder nur eine „Schwarzmalerei“ darstellte.
- Vergleich der Parteisysteme von Weimar und 1949
- Analyse der Wahlkampfstrategien der Parteien in Weimar und 1949
- Untersuchung der Rolle der KPD im Wahlkampf von 1949
- Bewertung des Einflusses der NS-Herrschaft auf die KPD der Nachkriegszeit
- Analyse des Wahlkampfs von 1949 unter Berücksichtigung von Wahlplakaten und Zeitungsartikeln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage in den Mittelpunkt und führt die zentrale These der Arbeit vor: Die Bundestagswahl von 1949 kann als ein Gradmesser für den Zustand der Demokratie in Deutschland betrachtet werden. Es werden die wichtigsten Quellen und Forschungsliteratur für die Untersuchung des Wahlkampfs von 1949 genannt.
Das schwere Erbe von Weimar
Dieses Kapitel analysiert die Parteienlandschaft der Weimarer Republik und vergleicht sie mit dem politischen System von 1949. Es wird herausgestellt, dass die Weimarer Republik von einer Vielzahl unterschiedlicher, teils gegensätzlicher Ideologien geprägt war, die in den meisten Fällen nicht miteinander vereinbar waren. Die KPD, die die Weimarer Republik ablehnte, spielte auch im Bundestagswahlkampf von 1949 eine bedeutende Rolle. Die Frage, inwieweit die KPD von 1949 der Weimarer KPD ähnelte und welche Rolle die NS-Herrschaft auf die KPD der Nachkriegszeit hatte, wird in diesem Kapitel diskutiert.
Der Bundestagswahlkampf von 1949
In diesem Kapitel wird die Bundestagswahl von 1949 im Detail betrachtet. Es werden die Ausgangslage, die zentralen Themen und die Wahlkampfstrategie der einzelnen Parteien beschrieben. Dabei wird immer wieder ein Vergleich mit den Wahlkämpfen der Weimarer Republik gezogen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den wichtigsten Schlüsselbegriffen wie Bundestagswahl 1949, Weimarer Republik, Parteisysteme, Wahlkampfstrategien, KPD, NS-Herrschaft, Demokratie, Kontinuität und Erneuerung. Der Fokus liegt auf der Analyse der Parallelen und Unterschiede zwischen den Wahlkämpfen der Weimarer Republik und der Bundestagswahl von 1949.
Häufig gestellte Fragen
Gab es Parallelen zwischen der Wahl 1949 und der Weimarer Republik?
Ja, insbesondere die Zersplitterung der Parteienlandschaft und die polemische Härte des Wahlkampfs erinnerten viele Zeitgenossen an die instabilen Verhältnisse von Weimar.
Wie unterschieden sich die Parteiensysteme von 1949 und Weimar?
Während Weimar von unversöhnlichen Ideologien geprägt war, zeichnete sich 1949 trotz vieler Kleinparteien bereits eine Konzentration auf größere Volksparteien ab, was zur Stabilisierung beitrug.
Welche Rolle spielte die KPD im ersten Bundestagswahlkampf?
Die KPD trat als Systemgegner auf, ähnlich wie in der Weimarer Republik, verlor jedoch durch die Erfahrungen der NS-Herrschaft und die Westbindung massiv an Rückhalt.
Warum war die Angst vor einem "zweiten Weimar" so groß?
Man befürchtete, dass eine schwache Demokratie und wirtschaftliche Not erneut radikalen Kräften den Weg ebnen könnten, was sich jedoch durch das "Wirtschaftswunder" nicht bewahrheitete.
Wie wurde der Wahlkampf 1949 geführt?
Der Wahlkampf war geprägt von persönlicher Diffamierung (z.B. der Begriff "Lügenauer") und einer scharfen Auseinandersetzung über die künftige Wirtschaftsordnung (Soziale Marktwirtschaft vs. Planwirtschaft).
- Quote paper
- Philipp Dittmann (Author), 2018, Die Bundestagswahl 1949. Die letzte Wahl der Weimarer Republik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456624