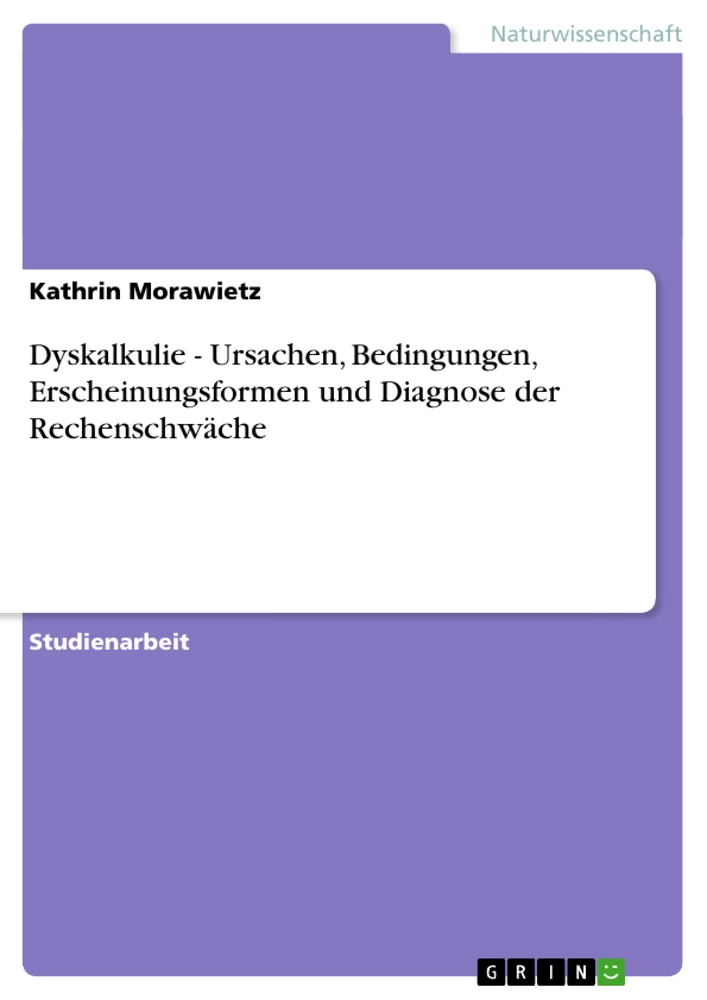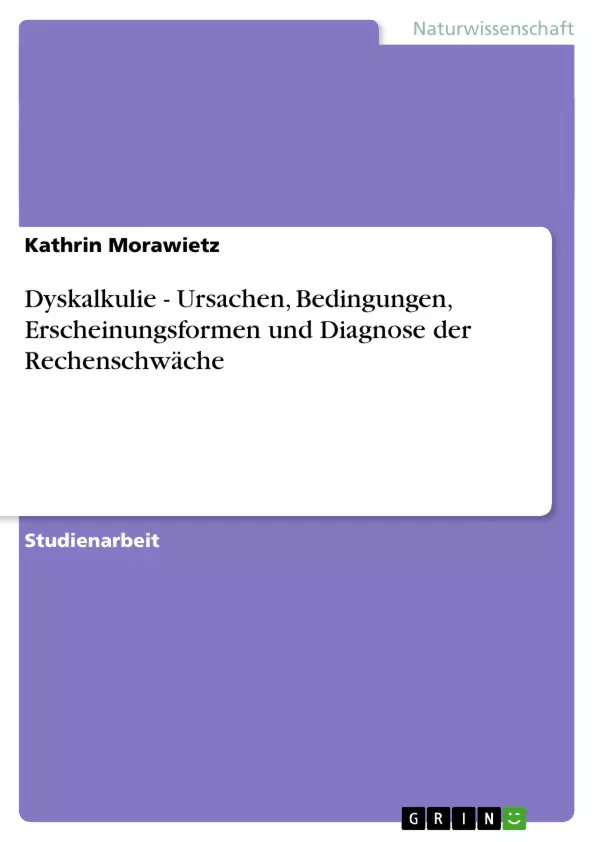Mathematik nimmt im Schulunterricht eine bedeutende Stellung ein, ist jedoch für viele Schüler ein wahres Angstfach. Viele von ihnen vertreten den Standpunkt, Mathematik könne man gar nicht verstehen, das Fach sei viel zu abstrakt, spreche nur den Verstand an und blende das Gefühl völlig aus, weshalb Jungen auch besser rechnen könnten als Mädchen. Wer in diesem systematisch aufgebauten Fach gut abschneidet, wird sogleich als Genie angesehen und man bewundert seine außerordentlichen Fähigkeiten.
Was passiert jedoch, wenn der Schulerfolg ausbleibt, Kinder Schwierigkeiten im Rechnen haben, sich die schlechten Mathematiknoten häufen oder sogar eine Rechenschwäche diagnostiziert wird? Eltern und Lehrer reagieren dann meist mit der altbewährten Forderung nach mehr Übung. Viele Schüler erzielen dennoch keine besseren Erfolge im Umgang mit Zahlen. Das mag daran liegen, dass noch immer eine Lücke im Behandlungsangebot besteht, so dass eine Rechenschwäche in vielen Fällen zu eskalieren droht bzw. gravierende Folgestörungen eintreten können, insbesondere dann, wenn die rechenschwachen Kinder aufgrund der vielen Misserfolge eine Vermeidungs- bzw. Abwehrhaltung dem Rechnen gegenüber entwickeln. Falls Kinder mit Zahlen aus irgendwelchen Gründen unangenehme Gefühle verbinden, ist es durchaus vorstellbar, dass sie in der Schule keine mathematischen Informationen an sich heranlassen. Rechengestörte Kinder können die mathematischen Anforderungen in der Schule nicht bewältigen, schneiden bei Tests und Klassenarbeiten mit schlechten Noten ab und brauchen sehr lange, um die Hausaufgaben in Mathematik zu bearbeiten, wobei in anderen Schulfächern keinerlei Schwierigkeiten auftreten müssen. Eltern und Lehrer werden solche Kinder zunächst dazu anhalten, mehr zu üben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Das Angstfach Mathematik
- 2. Der Begriff der Dyskalkulie
- 3. Verschiedene Ursachen einer Dyskalkulie
- 3.1 Biologisch-organische Beeinträchtigungen
- 3.2 Psychische, emotionale und soziale Beeinträchtigungen
- 3.3 Schulische Belastungen
- 3.4 Beeinträchtigung der Raumwahrnehmung
- 4. Kritische Einwände
- 4.1 Quantitative und qualitative Eigenschaften von Fehlern
- 4.2 Gleichsetzung von Intelligenz und Leistung
- 4.3 Die Annahme einer Normalschulfähigkeit
- 4.4 Rechenschwäche vs. Teilleistungsschwäche
- 5. Erste Hinweise auf das Vorliegen einer Rechenschwäche
- 6. Diagnose von Dyskalkulie
- 7. Der Mathematikstoff der ersten Grundschuljahre
- 8. Spezifische Probleme von rechenschwachen Kindern
- 8.1 Schwierigkeiten bei Bewegungsabläufen
- 8.2 Wahrnehmungsschwierigkeiten
- 8.3 Schwierigkeiten beim Rechnen
- 8.3.1 Schwierigkeiten beim Erfassen einer Menge
- 8.3.2 Schwierigkeiten mit Kardinal- und Ordinalzahlen
- 8.3.3 Schwierigkeiten mit dem Stellenwertsystem
- 8.3.4 Schwierigkeiten bei arithmetischen Aufgaben
- 8.3.5 Schwierigkeiten bei Textaufgaben
- 9. Typische Verhaltensmerkmale von rechenschwachen Kindern
- 10. Umgang mit Anschauungsmaterial und Hilfsmitteln
- 11. Fehlerermittelung
- 12. Nachhilfeunterricht in Mathematik
- 13. Rechenförderung – Zum Aufbau einer Förderkultur
- 13.1 Lerntherapie oder Förderunterricht?
- 13.2 Zur Behandlung einer Rechenschwäche
- 13.3 Ziele einer Rechentherapie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieses Textes ist es, ein umfassendes Verständnis von Dyskalkulie zu vermitteln. Dies beinhaltet die Erläuterung des Begriffs, die Darstellung verschiedener Ursachen, die Beschreibung von Diagnoseverfahren und die Vorstellung von Fördermöglichkeiten. Der Fokus liegt auf der Unterstützung von Kindern mit Rechenschwäche und der Sensibilisierung von Eltern und Lehrkräften.
- Definition und Abgrenzung von Dyskalkulie
- Vielfältige Ursachen der Rechenschwäche
- Diagnostik und Erkennung von Dyskalkulie
- Spezifische Probleme rechenschwacher Kinder
- Förderansätze und Interventionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Das Angstfach Mathematik: Die Einleitung beleuchtet die weitverbreitete Mathematikangst bei Schülern und die oft unzureichende Reaktion auf Rechenschwäche mit bloßer Übungsaufforderung. Sie hebt die Notwendigkeit einer adäquaten Behandlung hervor, um die Eskalation der Probleme und die Entwicklung von Vermeidungsstrategien zu verhindern. Die emotionalen Folgen von Misserfolgen im Mathematikunterricht, wie Angst, Verunsicherung und Stressreaktionen, werden ebenfalls thematisiert und die Notwendigkeit von Dyskalkulie- bzw. Lerntherapien betont.
2. Der Begriff der Dyskalkulie: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Dyskalkulie als eine Störung im Umgang mit Zahlen und mathematischen Konzepten, die über das normale Maß an Schwierigkeiten hinausgeht. Es wird als Teilleistungsstörung eingeordnet, die spezifische Defizite im mathematischen Bereich aufweist, während andere kognitive Fähigkeiten unbeeinträchtigt sein können. Der Zusammenhang mit Aufmerksamkeitsstörungen und Sprachentwicklungsstörungen wird ebenfalls angesprochen, und Dyskalkulie wird als eine therapiebedürftige Entwicklungsstörung klassifiziert.
Schlüsselwörter
Dyskalkulie, Rechenschwäche, Teilleistungsstörung, Mathematikangst, Diagnostik, Fördermöglichkeiten, Lerntherapie, Ursachen, Verhaltensmerkmale, Interventionen, Schulische Belastungen, Emotionale Beeinträchtigungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Das Angstfach Mathematik: Ein umfassender Überblick über Dyskalkulie"
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Dyskalkulie. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Die Themen reichen von der Definition und Abgrenzung von Dyskalkulie über verschiedene Ursachen, Diagnostik und spezifische Probleme rechenschwacher Kinder bis hin zu Förderansätzen und Interventionen. Es werden sowohl biologisch-organische als auch psychische, emotionale und soziale Beeinträchtigungen als mögliche Ursachen betrachtet, sowie kritische Einwände gegen gängige Diagnosen und Behandlungsansätze diskutiert.
Was wird unter Dyskalkulie verstanden?
Dyskalkulie wird als eine Teilleistungsstörung definiert, die spezifische Defizite im mathematischen Bereich aufweist, während andere kognitive Fähigkeiten unbeeinträchtigt sein können. Es handelt sich um eine Störung im Umgang mit Zahlen und mathematischen Konzepten, die über das normale Maß an Schwierigkeiten hinausgeht und als therapiebedürftige Entwicklungsstörung klassifiziert wird. Der Zusammenhang mit Aufmerksamkeitsstörungen und Sprachentwicklungsstörungen wird ebenfalls angesprochen.
Welche Ursachen werden für Dyskalkulie genannt?
Das Dokument nennt verschiedene Ursachen für Dyskalkulie, darunter biologisch-organische Beeinträchtigungen, psychische, emotionale und soziale Beeinträchtigungen, schulische Belastungen und Beeinträchtigungen der Raumwahrnehmung. Die Komplexität der Ursachen wird hervorgehoben, und es wird betont, dass es oft ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren ist, die zur Entstehung von Dyskalkulie beitragen.
Welche spezifischen Probleme haben Kinder mit Rechenschwäche?
Rechenschwache Kinder haben oft Schwierigkeiten bei Bewegungsabläufen, Wahrnehmungsschwierigkeiten, und insbesondere Probleme beim Rechnen selbst. Dies beinhaltet Schwierigkeiten beim Erfassen von Mengen, mit Kardinal- und Ordinalzahlen, dem Stellenwertsystem, arithmetischen Aufgaben und Textaufgaben. Das Dokument beschreibt diese Probleme detailliert.
Wie wird Dyskalkulie diagnostiziert?
Das Dokument erwähnt die Diagnose von Dyskalkulie als ein eigenes Kapitel, gibt aber keine detaillierte Beschreibung der Diagnoseverfahren. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass eine Diagnose gestellt werden muss.
Welche Fördermöglichkeiten werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt verschiedene Fördermöglichkeiten, darunter Nachhilfeunterricht in Mathematik und Rechenförderung im Rahmen einer Förderkultur. Es wird der Unterschied zwischen Lerntherapie und Förderunterricht erläutert und Ziele einer Rechentherapie genannt. Der Fokus liegt auf der Unterstützung von Kindern mit Rechenschwäche und der Sensibilisierung von Eltern und Lehrkräften.
Welche kritischen Einwände werden gegen die Diagnose und Behandlung von Rechenschwäche geäußert?
Kritische Einwände beziehen sich auf die quantitative und qualitative Bewertung von Fehlern, die Gleichsetzung von Intelligenz und Leistung, die Annahme einer Normalschulfähigkeit und die Abgrenzung zwischen Rechenschwäche und Teilleistungsschwäche. Diese Punkte werden im Dokument diskutiert, um ein umfassenderes Bild der Thematik zu vermitteln.
Welche Verhaltensmerkmale sind typisch für rechenschwache Kinder?
Das Dokument erwähnt typische Verhaltensmerkmale rechenschwacher Kinder in einem eigenen Kapitel, gibt aber keine detaillierte Auflistung. Es wird auf die Notwendigkeit einer genaueren Betrachtung hingewiesen.
Welche Rolle spielt Mathematikangst?
Mathematikangst wird als ein wichtiges Thema in der Einleitung behandelt. Es wird hervorgehoben, dass unzureichende Reaktionen auf Rechenschwäche mit bloßer Übungsaufforderung die Angst verstärken und zur Entwicklung von Vermeidungsstrategien führen können. Die emotionalen Folgen von Misserfolgen im Mathematikunterricht werden betont, und die Notwendigkeit von Dyskalkulie- bzw. Lerntherapien wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis des Textes?
Schlüsselwörter umfassen: Dyskalkulie, Rechenschwäche, Teilleistungsstörung, Mathematikangst, Diagnostik, Fördermöglichkeiten, Lerntherapie, Ursachen, Verhaltensmerkmale, Interventionen, Schulische Belastungen, Emotionale Beeinträchtigungen.
- Quote paper
- Kathrin Morawietz (Author), 2002, Dyskalkulie - Ursachen, Bedingungen, Erscheinungsformen und Diagnose der Rechenschwäche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45675