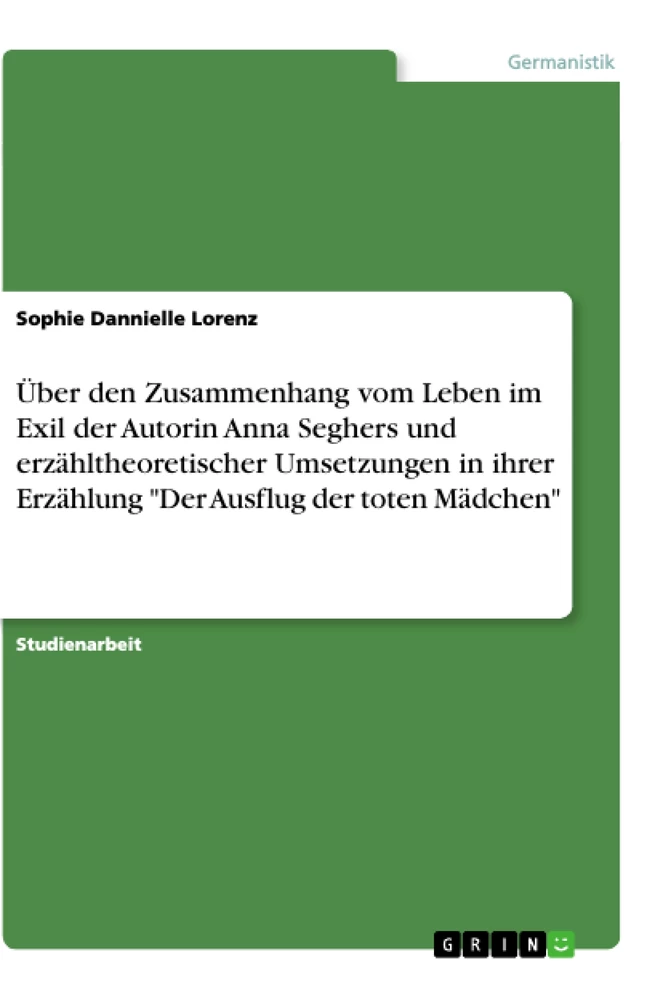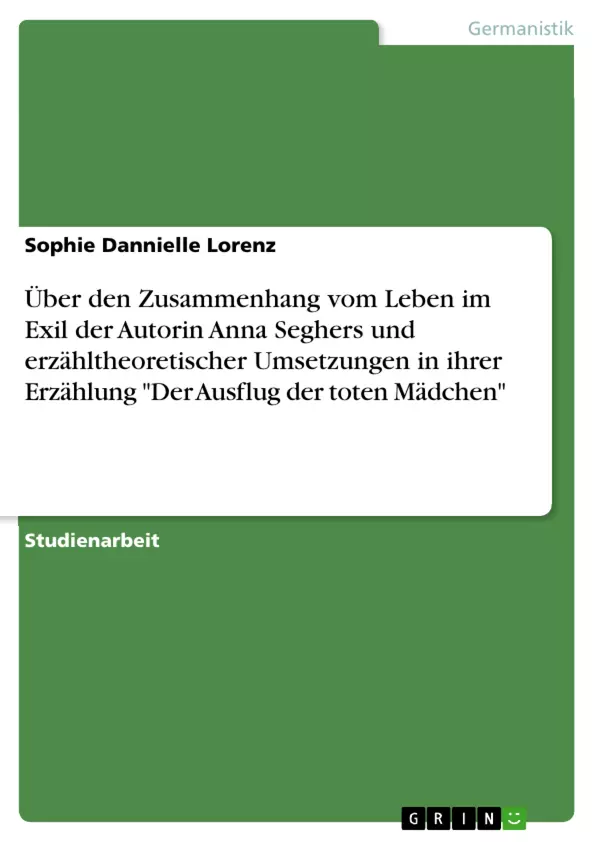Diese kurze Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema inwiefern sich das Leben im Exil der Autorin Anna Seghers im erzähltheoretischen Kontext widerspiegelt. Dies habe ich anhand ihrer Erzählung "Der Ausflug der toten Mädchen" beispielhaft dargestellt und aufgrund der analytischen Aspekte nach Matias Martinez und Michael Scheffel einen möglichen Versuch der Interpretation vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
-
-
- Die Rahmengeschichte beginnt in der Erzählung, indem der narrative Erzähler den Aufenthalt in Mexiko beschreibt bis plötzlich eine Kindheitserinnerung vor Augen als Fata Morgana erscheint.
- Hier findet das reibungslose Übergehen zur Binnengeschichte statt und bereits die erste von vier Etappen der erzählten Zeit kommt zum Vorschein, die vor dem ersten Weltkrieg.
- Anna Seghers, beziehungsweise die gebürtige Netty Reiling, ist auf einem Schulausflug zur Peteraue mit ihrer Mädchenklasse, anhand dieser Erinnerung erzählt sie die Schicksale ihrer Klassenkameradinnen von dem Zeitpunkt an vor dem ersten Weltkrieg bis hin zum zweiten Weltkrieg, der ja noch im Gange ist, als sich die Autorin bereits im Exil befindet.
- So schweifen ihre Gedanken zwischen diesen drei verschiedenen Zeitebenen hin und her, als Ausdruck der inneren Unruhe, bedingt durch das „,Nicht-ankommen-können“ im Exil.
- Deutlich wird dies nochmals am Ende dieser Erinnerung des Schulausflugs. Sie beschreibt detailliert den Nachhauseweg, wobei ihr physischer wie auch ihr psychischer Zustand sich weiter verschlechtert, sodass ihr ganz unklar vor Augen wird², besonders als sie vor ihrem Zuhause ankommt und ihre Mutter auf dem Balkon sieht.
- Gefühle der Heimat kommen auf, dieses Gefühl wird jedoch die Autorin im Gegensatz zu dem narrativen Erzähler nie mehr verspüren.
- Zum einen weil ihre Mutter am 30. März 1942 in ein polnisches Konzentrationslager bei Lublin deportiert wurde³ und zum anderen weil die Stadt Mainz, durch die Bombardements des Zweiten Weltkriegs in Schutt und Asche gelegt wurde.
-
- Anbei werden also auch erste Differenzen und Distanzen zwischen Narration und Wirklichkeit klar. Anna Seghers bemüht sich um stilistische Ausdrucksmöglichkeiten, die dieser Dualität zwischen subjektiver und einer faktischeren Wiedergabe der Wirklichkeit gerecht werden sollen.
- So steht im Vordergrund die Wahrnemungsperspektive des Erzählers als am Geschehen unmittelbar beteiligte Figur, und nicht die im zeitlichen Abstand formulierten Gedanken der Autorin Anna Seghers.
- Anhand des „Versuchs der Wiederherstellung der ungetrübten Kindheitswelt, obwohl ihre Erinnerungen an Heimat und Jugend deutlich von politischen Faktoren überschattet werden“5 liegt eine Erzählung von Ereignissen, aber auch eine von Worten und Gedanken vor.
- Am Ende erwacht sie quasi aus ihrem Traum, womit die Binnengeschichte zu Ende ist und die Rahmengeschichte wieder ein- und fortgesetzt werden kann, indem sie sich daran erinnert,,sie solle doch einen Aufsatz über diesen Ausflug schreiben“6. Hier erkennt man die besondere Doppelstimmigkeit des Textes, es werden zwei Erinnerungen im gleichen Kontext geschildert, jedoch auf verschiedenen Ebenen sowohl der Erzählzeit als auch dem Ort des Zeitpunktes der erzählten Zeit.
- So beendet Anna Seghers letztendlich nur den Rahmen der Erzählung ohne die Erzählung, sprachlich gesehen, tatsächlich zu beenden.
- Dies legt die Vermutung nahe, die Autorin wolle damit eine historische, jedoch mit stark persönlich emotional aufgeladene Erinnerung nicht zum Schweigen und somit zum Fortbestehen im Gedächtnis, bringen.
- Sie berichtet nicht nur über ihren eigenen Kummer und ihre Sehnsüchte, sondern sie schafft durch diesen abgestumpften Ton eine allgemeine Ebene für das Verständnis des Lesers.
- Dieser muss keiner speziellen Gruppe angehören um sich von der Erzählung indirekt angesprochen zu fühlen, obwohl der extradiagetische Leser gar nicht direkt in das Geschehen mit einbezogen wird, so führt jedoch die detailgenaue Beschreibung der Orts- und Zeitpunkte zu einem realistischen Monolog, der sich auch genau so abgespielt haben kann, da der narrative Erzähler über Erfahrungen der Autorin berichtet, auch wenn nicht zu einer absoluten Sicherheit garantiert werden kann, dass sich diese Erinnerung so und nicht anders, abgespielt haben müssen.
- Zudem muss die Unzulässigkeit von Erinnerungen als starkes Argument angenommen werden, wenn man aber das Text-Autor Verhältnis in dem Kontext betrachtet, das Verhältnis sei eng zu einander, so spiegelt die metaphorische Äußerung im Text „sie sehe nicht mehr so gut und fühle sich immer schwächer\"7 ihre tatsächliche, als Autorin der Erzählung, psychische Verfassung wieder.
- Dies ist insofern auch zutreffend, als dass die Autorin direkt bei ihrer Ankunft in Mexiko einen schweren Autounfall hatte, bei dem sie ihr Gedächtnis verlor und die Folgen davon bis zu ihrem Tod trug.
- Das Subjekt der Erzählung verkörpert jedoch eine gesamte Generation innerhalb einer Gesellschaft, die Beschreibung ihrer Mädchenklasse zeigt nämlich gleichzeitig auch den Konflikt zwischen Individualität, Zweifeln und der Diversität an Opfern des Zweiten Weltkriegs und der menschenverachtenden Politik der Nationalsozialisten auf und schafft somit ein authentisches Abbild der Gesellschaft, einen Art Zeitzeugenbericht.
- Doch ebenso darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es in „Der Ausflug der toten Mädchen“ auch um die Verarbeitung autobiographischer Aspekte geht, so hatte sie mit einigen Verlusten umzugehen wie eben der Tod der Mutter, der Klassenkameradinnen und der ständigen Flucht vor Vertreibung.
- Georges-Arthur Goldschmidt spricht von einer „Überlagerung zwei verschiedener Raumempfindungen“, bei Autoren die ins Exil verschlagen wurden⁹.
- Damit meint er die Eindrücke der Empfindung aus der Zeit und dem Leben vor dem Exil, hier bezieht er sich auf das Einsetzen des Welterfassens durch Ausprägen von Formen und Farben10, was zu späteren oft plötzlichen Kindheitserinnerungen führt, wenn die Raumaufnahme, die sich vollzieht sobald alltägliche Gegenstände etwas Vertrautes bekommen und ihnen eine feststehende Bedeutung zugeschrieben wird.
- So „verkörpert der narrative Erzähler selbst die anachronistische Gleichzeitigkeit, indem er übergangslos als jugendliche Netty, als einzige und allwissende Überlebende und offenbar als die Exilantin Anna Seghers berichtet 11.
- Der Erzählakt an sich ist einerseits extradiagetisch, da der Erzähler in der Rahmengeschichte an raumzeitliche Begrenzungen gebunden ist.
- Die Ordnung des Geschehens in Form von der Analepse und der Prolepse, die den Modus der Erzählung bestimmen, drückt sich durch das Vermischen verschiedener Zeitformen, das Überspringen von Zeiten, das Vermischen von Wirklichkeit und Traum, die Beschreibungen der Umgebung und des emotionalen Zustands der Figuren aus.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Anna Seghers' Exil in Mexiko und der erzähltheoretischen Umsetzung in ihrer Erzählung „Der Ausflug der toten Mädchen". Durch die Analyse des Textes anhand der erzähltheoretischen Ansätze nach Matías Martinez und Michael Scheffel und die Einbeziehung von Sekundärliteratur soll die Beziehung zwischen Schreibstil, Exilzeit und deren Auswirkungen kritisch beleuchtet werden.
- Die Auswirkungen des Exils auf die erzähltheoretische Struktur der Erzählung
- Die Verwendung von Erinnerungen und Traumsequenzen als Ausdruck der inneren Unruhe der Exilantin
- Die Darstellung der "Nicht-Ankommens" im Exil durch die Vermischung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
- Die Spannung zwischen subjektiver Wahrnehmung und faktischer Wiedergabe der Wirklichkeit
- Die Rolle der Erinnerung als Mittel der Bewältigung des Verlusts und der Trauer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der ersten Kapitel der Erzählung, die die Rahmengeschichte und die Binnengeschichte einführen. Dabei wird die Bedeutung der Kindheitserinnerung als Ausgangspunkt für die erzählte Geschichte und die verschiedenen Zeitebenen, die in der Erzählung vorkommen, hervorgehoben. Es wird auch die Distanz zwischen der Erzählzeit und der erzählten Zeit betrachtet und die stilistischen Mittel, die Anna Seghers einsetzt, um diese Distanz zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Anna Seghers, "Der Ausflug der toten Mädchen", Exil, Erzähltheorie, Matías Martinez, Michael Scheffel, Erinnerung, Traum, Zeitformen, Analepse, Prolepse, subjektive Wahrnehmung, faktische Wiedergabe, Verlust, Trauer, Heimatlosigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte das Exil auf Anna Seghers' Werk?
Das Exil in Mexiko prägte ihre Erzählweise durch Themen wie Heimatlosigkeit, innere Unruhe und die Sehnsucht nach einer verlorenen Kindheitswelt.
Worum geht es in „Der Ausflug der toten Mädchen“?
In einer Binnengeschichte erinnert sich die Erzählerin an einen Schulausflug vor dem Ersten Weltkrieg und schildert die tragischen Schicksale ihrer Klassenkameradinnen im Kontext des Nationalsozialismus.
Was bedeuten Analepse und Prolepse in der Erzählung?
Diese Begriffe beschreiben Rückblenden (Analepsen) und Vorausdeutungen (Prolepsen), mit denen Seghers verschiedene Zeitebenen verknüpft, um die Zerstörung der Vergangenheit aufzuzeigen.
Wie wird das „Nicht-ankommen-können“ im Exil dargestellt?
Durch das Hin- und Herschweifen der Gedanken zwischen Mexiko und der alten Heimat Mainz sowie das Verschwimmen von Traum und Wirklichkeit.
Warum ist die Erzählung auch ein Zeitzeugenbericht?
Sie verarbeitet autobiographische Erlebnisse und zeigt den Konflikt zwischen Individualität und den Opfern der menschenverachtenden Politik der Nationalsozialisten.
- Quote paper
- Sophie Dannielle Lorenz (Author), 2018, Über den Zusammenhang vom Leben im Exil der Autorin Anna Seghers und erzähltheoretischer Umsetzungen in ihrer Erzählung "Der Ausflug der toten Mädchen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456780