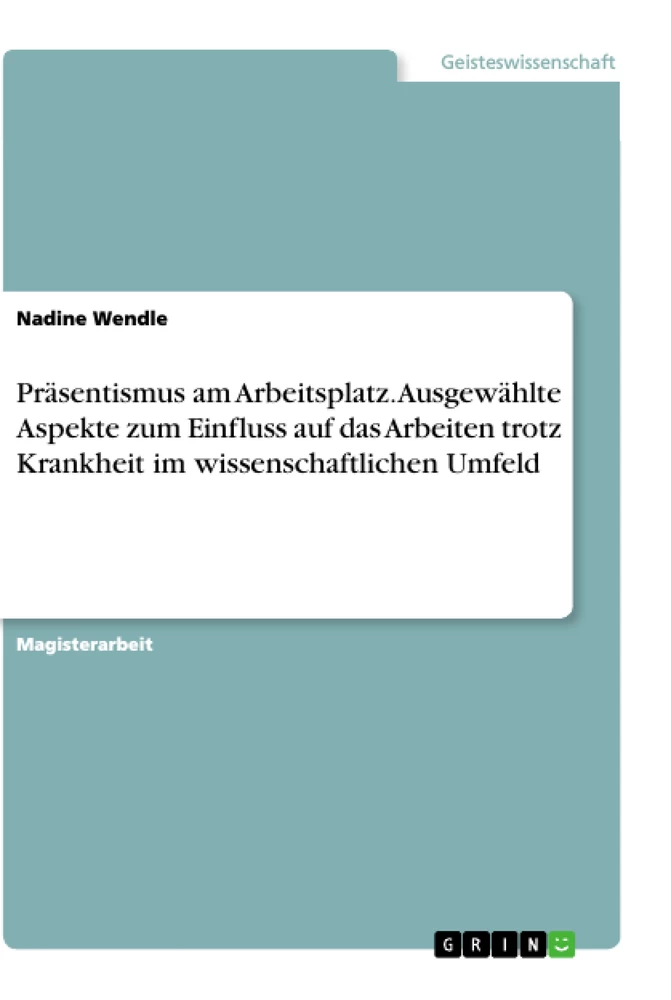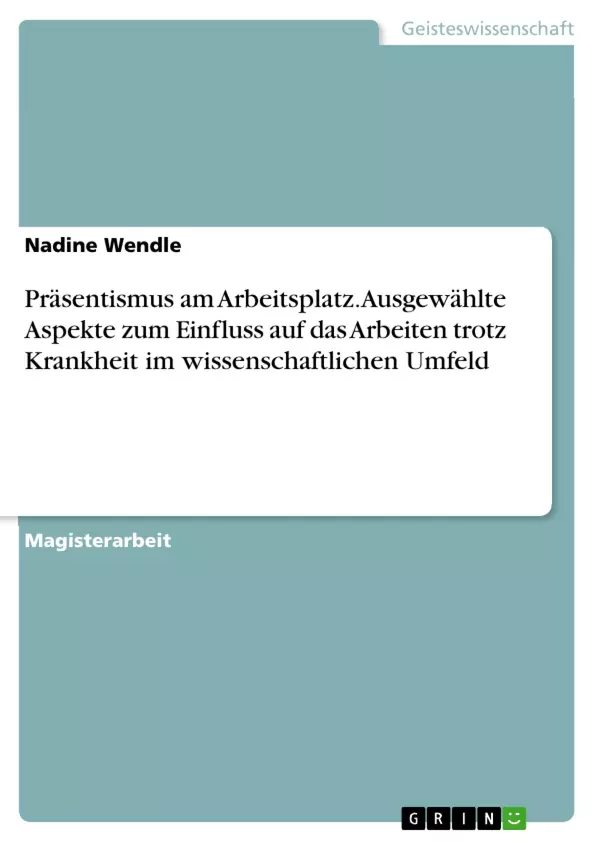Ausgangspunkt für diese wissenschaftliche Arbeit ist die in der empirischen Forschung bislang ungeklärte Frage nach den Gründen, weswegen sich Erwerbstätige im Krankheitsfall nicht für eine Krankschreibung und Auszeit entscheiden, sondern mit ihrer Erwerbstätigkeit fortfahren. Im Gegensatz zu Absentismus ist die Befundlage hinsichtlich Präsentismus relativ übersichtlich. Präsentismus kann nicht allein als Gegenstück von Absentismus betrachtet werden, sondern erfordert eine eigenständige Analyse, da möglicherweise andere Mechanismen hierfür ursächlich sind. Die Relevanz des Themas ergibt sich aus mehreren gesellschaftlichen Veränderungen. Zum einen ist der Krankenstand in Deutschland in den vergangenen Jahren überwiegend gesunken. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass eine bessere Gesundheit der Arbeitnehmer ausschließlich hierfür verantwortlich ist. Zudem nehmen psychische Erkrankungen wie beispielsweise Überlastung und Ausgebranntsein, das so genannte Burnout, tendenziell zu. Zum anderen sind deutsche Arbeitnehmer im Krankheitsfall nicht notwendigerweise einem Verdienstausfall ausgesetzt, da nach bestehender Gesetzgebung ein soziales Absicherungssystem zumindest im Normalarbeitsverhältnis besteht. Des Weiteren wurden bislang überwiegend Aspekte als Gründe für das Arbeiten trotz Krankheit analysiert, die in negativem Zusammenhang stehen.
Dabei ist Präsentismus ein auch genuin soziologisches Phänomen, da die Soziologie danach fragt, wie soziale Ordnung hergestellt wird und unter welchen Bedingungen Akteure sich in welcher Weise verhalten. Die Erwerbstätigkeit nimmt einen großen zeitlichen Anteil am Leben ein. Daher - und auch im Zuge der Humanisierung von Arbeit - ergibt sich die Relevanz dieses Themas. Auch die propagierten und teilweise empirisch festgestellten Konsequenzen des Arbeitens trotz Krankheit, beispielsweise dauerhafter Absentismus, chronischer Stress und Burnout, unterstreichen die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Ursachenforschung auf diesem Gebiet. Präsentismus kann als Frühwarnindikator fungieren, um möglicherweise ungesunde Arbeitsweisen und -umgebungen identifizieren zu können, die zu Überlastung und möglicherweise einem dauerhaftem Ausfall führen können. Die bisherige empirische Forschung hat keine eindeutige Befundlage ergeben.
Die zentrale Leitfrage schließt sich an bisherige Studien zu Präsentismus an: Welche Einussfaktoren führen zu Präsentismus?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stand der Forschung
- 2.1. Terminologie
- 2.2. Darstellung des aktuellen Forschungsstands
- 2.2.1. Auswirkungen von Präsentismus
- 2.2.2. Soziodemografische Merkmale
- 2.2.3. Organisationale Faktoren
- 2.2.4. Persönliche Merkmale
- 2.2.5. Absentismus
- 2.3. Kritische Beurteilung der Operationalisierungen
- 2.4. Zwischenfazit zum Forschungsstand
- 3. Fokus der Forschungsarbeit
- 3.1. Entgrenzung und Flexibilisierung der Arbeit
- 3.2. Persönlichkeit
- 3.3. Motivation
- 3.4. Arbeitszufriedenheit
- 3.5. Charakteristiken des Untersuchungsfelds
- 3.6. Ableitung der Forschungsfrage
- 4. Stichprobe und Methode
- 4.1. Stichprobe und Design
- 4.2. Operationalisierungen
- 4.2.1. Präsentismus
- 4.2.2. Arbeitszufriedenheit und Autonomie
- 4.2.3. Persönlichkeit
- 4.2.4. Entgrenzung
- 4.2.5. Intrinsische Motivation
- 4.2.6. Kontextmerkmale
- 4.3. Statistisches Vorgehen
- 5. Ergebnisse
- 5.1. Plausibilitätsanalyse und fehlende Werte
- 5.2. Modellierung und Kennwerte der Indizes
- 5.2.1. Präsentismus
- 5.2.2. Entgrenzung
- 5.2.3. Autonomie am Arbeitsplatz
- 5.2.4. Intrinsische Motivation
- 5.2.5. Persönlichkeitsdimensionen nach BFI-10
- 5.3. Deskriptive Ergebnisse
- 5.3.1. Soziodemografie und Kontextmerkmale
- 5.3.2. Präsentismus
- 5.4. Bivariate Ergebnisse
- 5.4.1. Korrelationsmaße zur Bestimmung bivariater Zusammenhänge
- 5.4.2. Geschlechterunterschiede
- 5.4.3. Mittelwertunterschiede
- 5.5. Multivariate Analyse
- 5.5.1. Mediation und Moderation der Persönlichkeitsdimensionen
- 5.5.2. Prädiktoren für das Präsentismusrisiko
- 5.5.3. Modelle für das Ausmaß an Präsentismus
- 5.5.4. Prüfung der Modellvoraussetzungen
- 5.5.5. Einflussmerkmale und Modellgüte für Gesamt- und Teilstichproben
- 5.6. Vergleich der Messinstrumente
- 5.7. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Präsentismus im wissenschaftlichen Umfeld. Ziel ist es, den Einfluss verschiedener Faktoren auf das Arbeiten trotz Krankheit zu analysieren. Die Studie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Präsentismus und individuellen Merkmalen (Persönlichkeit, Motivation), organisationalen Aspekten (Arbeitsbedingungen, Autonomie) sowie soziodemografischen Variablen.
- Definition und Abgrenzung des Präsentismus
- Einflussfaktoren auf Präsentismusverhalten
- Zusammenhang zwischen Präsentismus und Arbeitszufriedenheit
- Rollen von Persönlichkeitseigenschaften bei Präsentismus
- Methodische Herausforderungen bei der Erforschung von Präsentismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Präsentismus ein, definiert das Phänomen und verdeutlicht seine Relevanz im Kontext von betrieblichem Gesundheitsmanagement und demografischem Wandel. Sie beleuchtet die wachsende Bedeutung von Mitarbeitergesundheit und die bisherigen Forschungslücken im Bereich des Präsentismus, insbesondere im wissenschaftlichen Kontext. Der Fokus liegt auf der soziologischen Perspektive auf das Verhalten, das Arbeiten trotz Krankheit fortzuführen.
2. Stand der Forschung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Präsentismus. Es werden verschiedene Definitionen und Operationalisierungen des Konstrukts diskutiert und kritisch bewertet. Die Auswirkungen von Präsentismus, soziodemografische Merkmale, organisationale Faktoren, persönliche Merkmale und der Zusammenhang mit Absentismus werden beleuchtet. Der Abschnitt liefert eine Grundlage für die eigene Forschungsarbeit, indem er bestehende Erkenntnisse zusammenfasst und Lücken identifiziert.
3. Fokus der Forschungsarbeit: Dieses Kapitel beschreibt die Forschungsfrage und die zentralen Hypothesen der vorliegenden Arbeit. Es werden die spezifischen Aspekte des Präsentismus beleuchtet, die im Rahmen der Studie untersucht werden, einschließlich der Entgrenzung und Flexibilisierung der Arbeit, Persönlichkeitsmerkmalen, Motivation, Arbeitszufriedenheit und Charakteristika des Untersuchungsfelds. Es stellt die Verbindung zwischen der Literaturrecherche und der methodischen Vorgehensweise her.
4. Stichprobe und Methode: Dieses Kapitel detailliert die Methodik der Studie. Es beschreibt die Stichprobenzusammensetzung, das Studiendesign, die verwendeten Messinstrumente zur Operationalisierung von Präsentismus, Arbeitszufriedenheit, Autonomie, Persönlichkeit, intrinsischer Motivation und Kontextmerkmalen. Weiterhin wird das statistische Vorgehen, einschließlich der verwendeten Analysemethoden, erläutert.
5. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Analysen. Es beginnt mit einer Plausibilitätsanalyse und der Behandlung fehlender Werte. Es folgen die Modellierung und Kennwerte der Indizes für Präsentismus, Entgrenzung, Autonomie, intrinsische Motivation und die Persönlichkeitsdimensionen. Deskriptive Ergebnisse, bivariate und multivariate Analysen (einschliesslich Mediation und Moderation) werden dargestellt und interpretiert. Ein Vergleich der Messinstrumente rundet das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Präsentismus, Arbeitsfähigkeit, Gesundheit, Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz, Motivation, Persönlichkeit, Entgrenzung, Flexibilisierung, Arbeitszufriedenheit, Soziodemografie, Organisationale Faktoren, wissenschaftliches Umfeld, betriebliches Gesundheitsmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Präsentismus im wissenschaftlichen Umfeld
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen des Präsentismus im wissenschaftlichen Kontext. Der Fokus liegt auf der Analyse des Einflusses verschiedener Faktoren auf das Arbeiten trotz Krankheit. Es werden Zusammenhänge zwischen Präsentismus und individuellen Merkmalen (Persönlichkeit, Motivation), organisationalen Aspekten (Arbeitsbedingungen, Autonomie) sowie soziodemografischen Variablen beleuchtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Präsentismus, Einflussfaktoren auf Präsentismusverhalten, Zusammenhang zwischen Präsentismus und Arbeitszufriedenheit, Rolle von Persönlichkeitseigenschaften bei Präsentismus und methodische Herausforderungen bei der Erforschung von Präsentismus. Zusätzlich werden die Entgrenzung und Flexibilisierung der Arbeit, Motivation, Arbeitszufriedenheit und Charakteristika des Untersuchungsfelds untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Stand der Forschung (inkl. Terminologie, aktuellem Forschungsstand mit Unterpunkten zu Auswirkungen, soziodemografischen Merkmalen, organisationalen und persönlichen Faktoren sowie Absentismus, und kritischer Beurteilung der Operationalisierungen), Fokus der Forschungsarbeit (inkl. Entgrenzung, Persönlichkeit, Motivation, Arbeitszufriedenheit, Charakteristika des Felds und Forschungsfrage), Stichprobe und Methode (inkl. Stichprobe, Design, Operationalisierungen verschiedener Variablen und statistischem Vorgehen), Ergebnisse (inkl. Plausibilitätsanalyse, Modellierung, deskriptive, bivariate und multivariate Analysen sowie Vergleich der Messinstrumente und Zusammenfassung) und Schluss.
Wie ist die Methodik der Studie aufgebaut?
Die Studie beschreibt detailliert die Stichprobenzusammensetzung und das Studiendesign. Es werden die verwendeten Messinstrumente zur Erfassung von Präsentismus, Arbeitszufriedenheit, Autonomie, Persönlichkeit, intrinsischer Motivation und Kontextmerkmalen erläutert. Das statistische Vorgehen, inklusive der verwendeten Analysemethoden, wird ebenfalls detailliert dargestellt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen eine Plausibilitätsanalyse und Behandlung fehlender Werte. Es werden Modellierungen und Kennwerte für Indizes zu Präsentismus, Entgrenzung, Autonomie, intrinsischer Motivation und Persönlichkeitsdimensionen präsentiert. Die Arbeit beinhaltet deskriptive, bivariate und multivariate Analysen (inkl. Mediation und Moderation). Ein Vergleich der verwendeten Messinstrumente wird ebenfalls vorgenommen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Präsentismus, Arbeitsfähigkeit, Gesundheit, Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz, Motivation, Persönlichkeit, Entgrenzung, Flexibilisierung, Arbeitszufriedenheit, Soziodemografie, Organisationale Faktoren, wissenschaftliches Umfeld, betriebliches Gesundheitsmanagement.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit beantwortet?
Die spezifische Forschungsfrage wird im Kapitel "Fokus der Forschungsarbeit" detailliert erläutert. Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss verschiedener Faktoren auf das Arbeiten trotz Krankheit (Präsentismus) zu analysieren.
- Quote paper
- Nadine Wendle (Author), 2013, Präsentismus am Arbeitsplatz. Ausgewählte Aspekte zum Einfluss auf das Arbeiten trotz Krankheit im wissenschaftlichen Umfeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456795