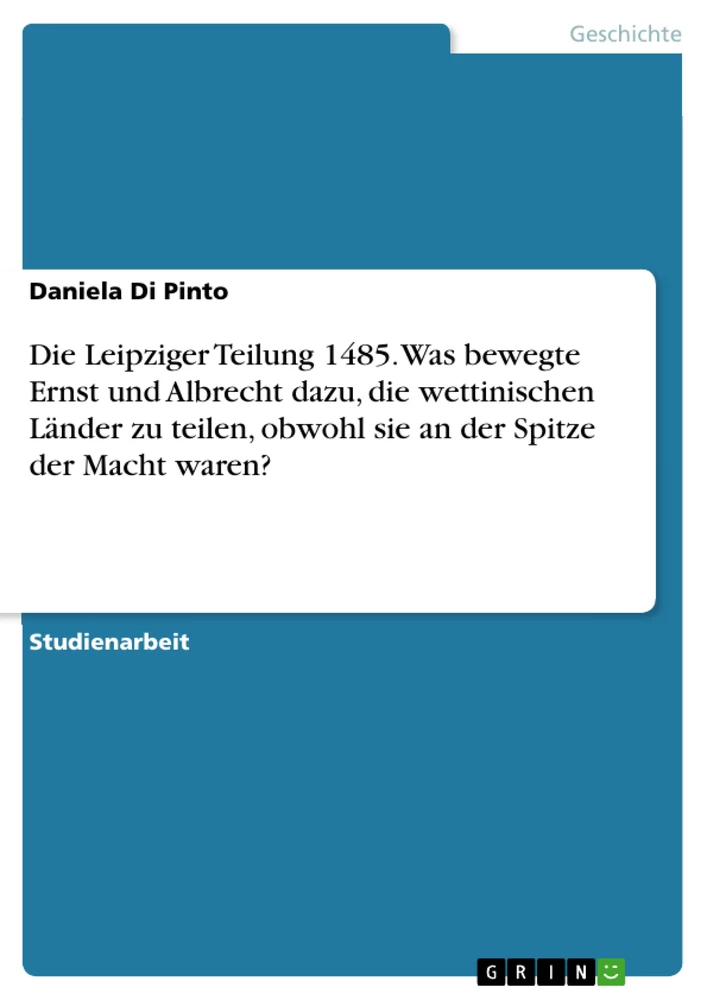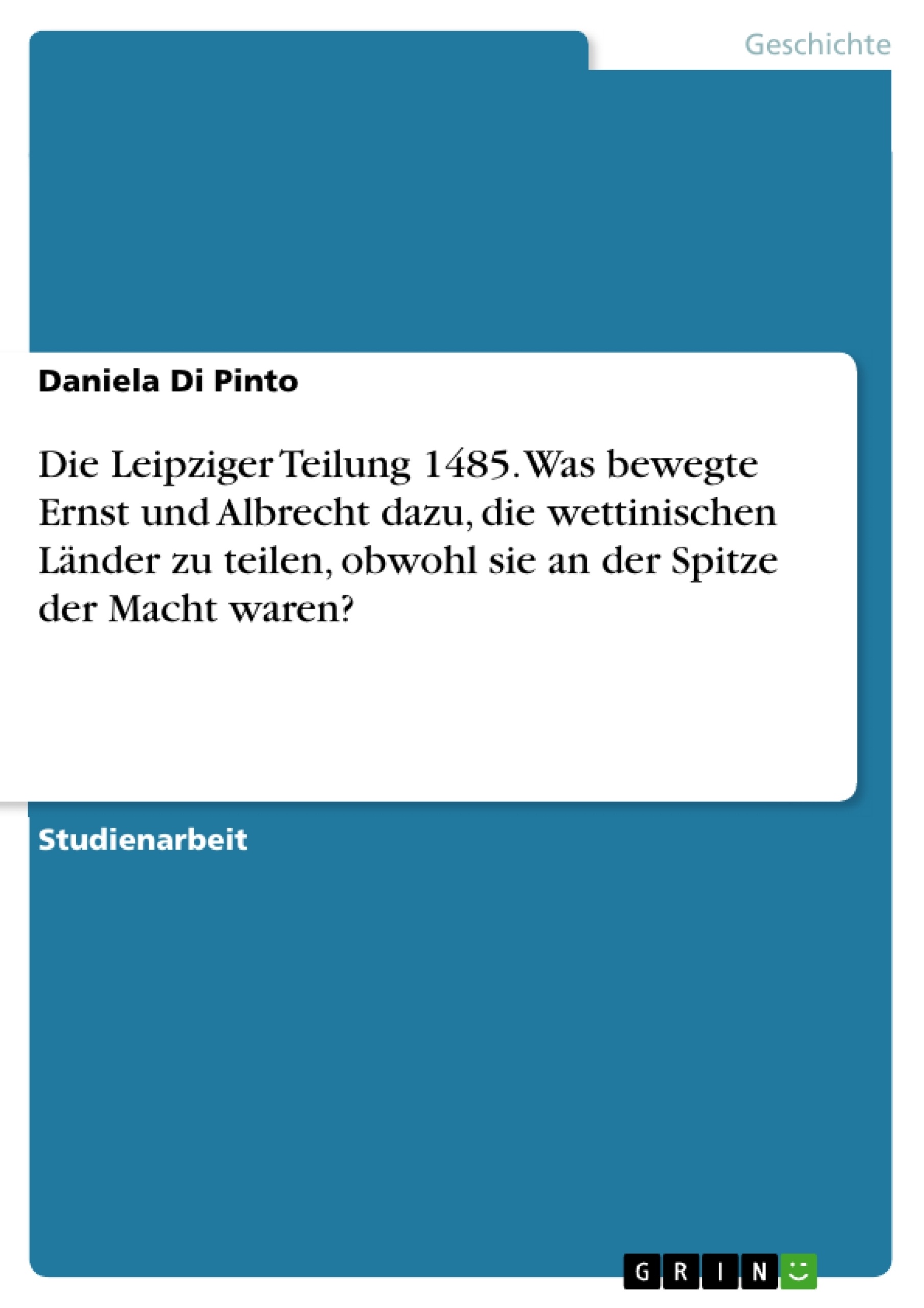Die Wettiner gehörten zu den wichtigsten Fürstenfamilien im deutschen Reich während des späten Mittelalters, nebst der kaiserlichen Hausmacht der Habsburger. Jedoch war die Geschichte der Wettiner von „Herrschaftsteilungen“ geprägt. Besonders die Leipziger Teilung im Jahre 1485 war für die Wettiner eine Zäsur. Kurfürst Ernst und sein Bruder Albrecht weisen eine zwanzigjährige, gemeinschaftliche Regierung auf, welche durchaus erfolgreich war. Das wirft verständlicherweise die Frage auf: Was bewegte die Brüder dazu, die wettinischen Länder zu teilen, obwohl sie an der Spitze der Macht waren?
Inhaltsverzeichnis
- Kommentierte Bibliographie
- Äußere Quellenkritik
- Einleitung
- Die Vorgeschichte
- Die Teilung zu Chemnitz im Jahre 1382
- Die Altenburger Teilung, der Bruderkrieg und der Prinzenraub
- Egerer Hauptvergleich von 1459
- Ernst und Albrecht: Die gemeinsame Regierungszeit
- Das Testament von Friedrich II.
- Ernst und Albrecht: Auf dem Gipfel der Macht
- Der Streit der Brüder bahnt sich an
- 1485: Die Leipziger Teilung
- Die Bestimmungen der Teilung
- Die Gründe der Teilung
- Hugold von Schleinitz: Seine Rolle
- Die Gleichberechtigung zwischen Ernst und Albrecht
- Sicherheiten für die nachfolgenden Generationen
- Die Simplifizierung der Regierung
- Die Konsequenzen aus der Leipziger Teilung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Hintergründe und Folgen der Leipziger Teilung im Jahr 1485, die die wettinischen Länder in zwei Teile aufteilte. Der Fokus liegt auf den Motiven der Brüder Ernst und Albrecht, die trotz ihrer Machtposition eine Teilung des Landes beschlossen. Die Arbeit beleuchtet auch die Auswirkungen der Teilung auf die politische und gesellschaftliche Ordnung der wettinischen Lande.
- Die Geschichte der Wettiner und die Vorgeschichte der Leipziger Teilung
- Die politische und wirtschaftliche Situation der wettinischen Lande im 15. Jahrhundert
- Die Motivationen von Ernst und Albrecht zur Teilung des Landes
- Die Bestimmungen der Leipziger Teilung und ihre Auswirkungen auf die wettinischen Lande
- Die langfristigen Folgen der Leipziger Teilung für die Geschichte der Wettiner und Sachsens.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der kommentierten Bibliographie und der äußeren Quellenkritik. Im zweiten Kapitel wird die Einleitung behandelt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Vorgeschichte der Leipziger Teilung, einschließlich der Teilung zu Chemnitz im Jahre 1382, der Altenburger Teilung, dem Bruderkrieg und dem Prinzenraub sowie dem Egerer Hauptvergleich von 1459.
Das vierte Kapitel untersucht die gemeinsame Regierungszeit von Ernst und Albrecht, einschließlich des Testaments von Friedrich II., der Machtposition der Brüder und der beginnenden Streitigkeiten. Das fünfte Kapitel analysiert die Leipziger Teilung im Jahr 1485, inklusive der Bestimmungen der Teilung, der Gründe für die Teilung, der Rolle von Hugold von Schleinitz, der Gleichberechtigung zwischen Ernst und Albrecht, der Sicherheiten für die nachfolgenden Generationen und der Simplifizierung der Regierung. Zudem werden die Konsequenzen der Leipziger Teilung diskutiert.
Schlüsselwörter
Leipziger Teilung, Wettiner, Ernst, Albrecht, Macht, Streitigkeiten, politische Ordnung, Geschichte Sachsens, Friedrich II., Hugold von Schleinitz, Bruderkrieg, Prinzenraub, Egerer Hauptvergleich, Chemnitz, Altenburg, Bestimmungen, Folgen, Sicherheiten, Simplifizierung.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Leipziger Teilung von 1485?
Es war eine Zäsur in der Geschichte der Wettiner, bei der die Brüder Ernst und Albrecht ihre zuvor gemeinsam regierten Länder in zwei eigenständige Gebiete aufteilten.
Warum teilten die Brüder das Land trotz gemeinsamer Erfolge?
Gründe waren bahnende Streitigkeiten, das Streben nach individueller Gleichberechtigung, die Sicherung der Nachfolge für ihre Söhne und eine Vereinfachung der Regierung.
Wer waren die Wettiner?
Die Wettiner gehörten neben den Habsburgern zu den wichtigsten Fürstenfamilien im deutschen Reich des späten Mittelalters.
Welche Konsequenzen hatte die Teilung für Sachsen?
Die Teilung führte zur Entstehung der ernestinischen und albertinischen Linien, was die politische Landkarte Sachsens über Jahrhunderte prägte.
Welche Rolle spielte Hugold von Schleinitz?
Er war ein einflussreicher Berater, dessen Rolle im Prozess der Teilungsverhandlungen in der Arbeit näher beleuchtet wird.
- Quote paper
- Daniela Di Pinto (Author), 2016, Die Leipziger Teilung 1485. Was bewegte Ernst und Albrecht dazu, die wettinischen Länder zu teilen, obwohl sie an der Spitze der Macht waren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456904