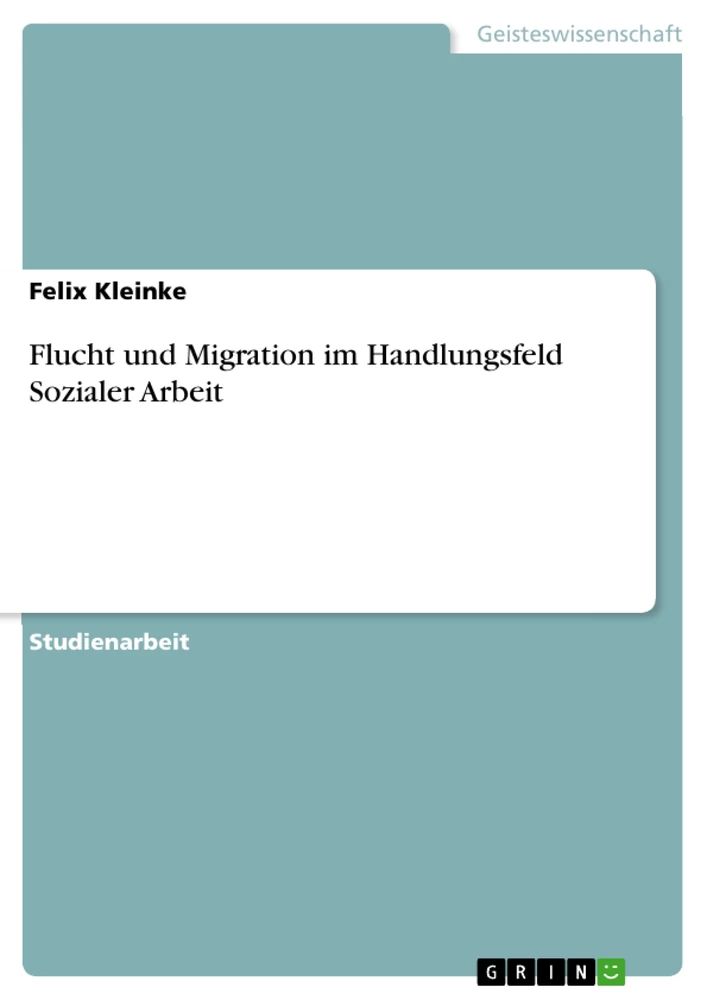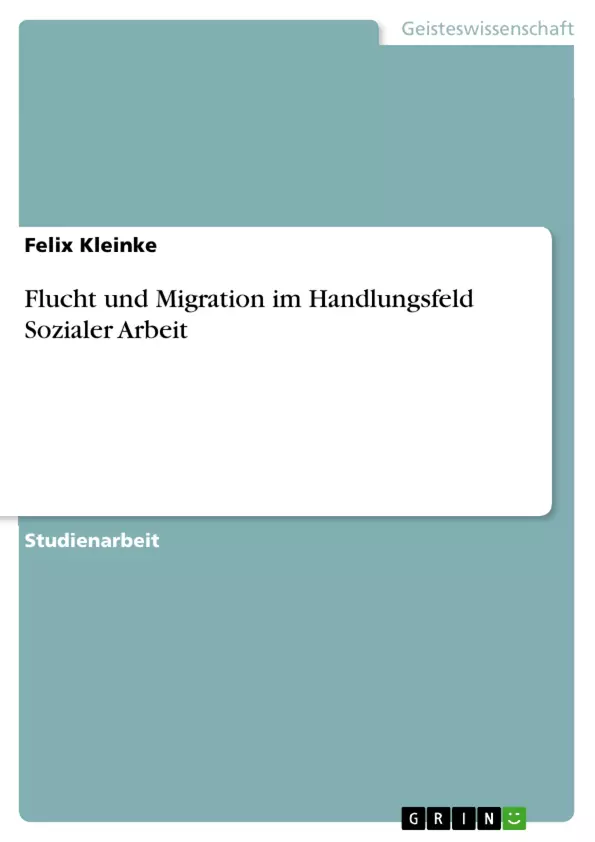In dieser Hausarbeit werde ich mich zunächst mit dem Thema Migration beschäftigen und einen kurzen historischen Abriss vollziehen. Anschließend werde ich die Fluchtursachen näher beleuchten und der Frage nachgehen, was Menschen dazu bewegt, ihre Heimat und oft auch ihre Familien zu verlassen. Dabei soll auch kritisch beleuchtet werden, welchen massiven Anteil die weltweiten Industriemächte dabeihaben. Außerdem möchte ich auch auf aktuelle Situationen in den betroffenen Herkunftsländern eingehen. Dazu habe ich drei Länder herausgesucht, aus denen im Jahr 2015 mit die meisten Asylsuchenden kamen. Außerdem beleuchte ich die verschiedenen einzelnen Migrant*innengruppen und gehe auf die Vielzahl der Flüchtlingsgruppen ein, die sich zum Teil enorm voneinander unterscheiden.
Zum Ende beschäftige ich mich mit der Sozialen Arbeit. Wie reagiert die Profession auf das Thema Flucht und Migration und wie kann eine Rassismus-kritische Bildungsarbeit aussehen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition der Migration
- Deutsche Migrationsgeschichte
- Fluchtursachen
- Aktuelle Situation in den Herkunftsländern
- Syrien
- Afghanistan
- Irak
- Welche Migrant*innengruppen gibt es?
- Spätaussiedler*innen
- Arbeitsmigrant*innen
- Flüchtlingsgruppen
- Anerkannte Flüchtlinge
- Flüchtlinge mit (vorläufigem) Bleiberecht oder Abschiebeverbot
- Geduldete
- Asylbewerber*innen
- ,,Illegale"
- Reaktionen der Sozialen Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Flucht und Migration und analysiert dessen Ursachen, Hintergründe und Auswirkungen. Im Fokus steht dabei ein kritischer Blick auf die globalen Zusammenhänge und die Rolle der Industrienationen bei der Entstehung von Flucht und Migration.
- Definition und Abgrenzung von Migration und Flucht
- Analyse von Fluchtursachen, insbesondere Krieg und Gewalt
- Die Rolle der weltweiten Industriemächte bei der Entstehung von Flucht
- Die aktuelle Situation in den Herkunftsländern Syrien, Afghanistan und Irak
- Die verschiedenen Migrant*innengruppen und ihre spezifischen Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Flucht und Migration ein und skizziert die Problematik des Strebens nach einem besseren Leben in einer Welt, die oft uneingeschränktes Reisen suggeriert, aber gleichzeitig die Grenzen für viele Menschen verschließt. Kapitel 2 definiert den Begriff Migration und grenzt ihn von Flucht ab. Kapitel 3 beleuchtet die deutsche Migrationsgeschichte und die Entwicklung des Begriffs "Gastarbeiter" zu "Ausländer". Kapitel 4 fokussiert auf die zentralen Fluchtursachen, insbesondere Krieg und Gewalt, und zeigt auf, dass sich die Anzahl der Kriegsgeflüchteten in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat.
Schlüsselwörter
Die zentrale Thematik der vorliegenden Arbeit ist Flucht und Migration. Dabei spielen Begriffe wie Fluchtursachen, Krieg und Gewalt, Industrienationen, Herkunftsländer, Migrant*innengruppen, Flüchtlingsgruppen und die Reaktion der Sozialen Arbeit eine entscheidende Rolle. Besonderes Augenmerk liegt auf der aktuellen Situation in den Herkunftsländern Syrien, Afghanistan und Irak.
- Quote paper
- Felix Kleinke (Author), 2017, Flucht und Migration im Handlungsfeld Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456944