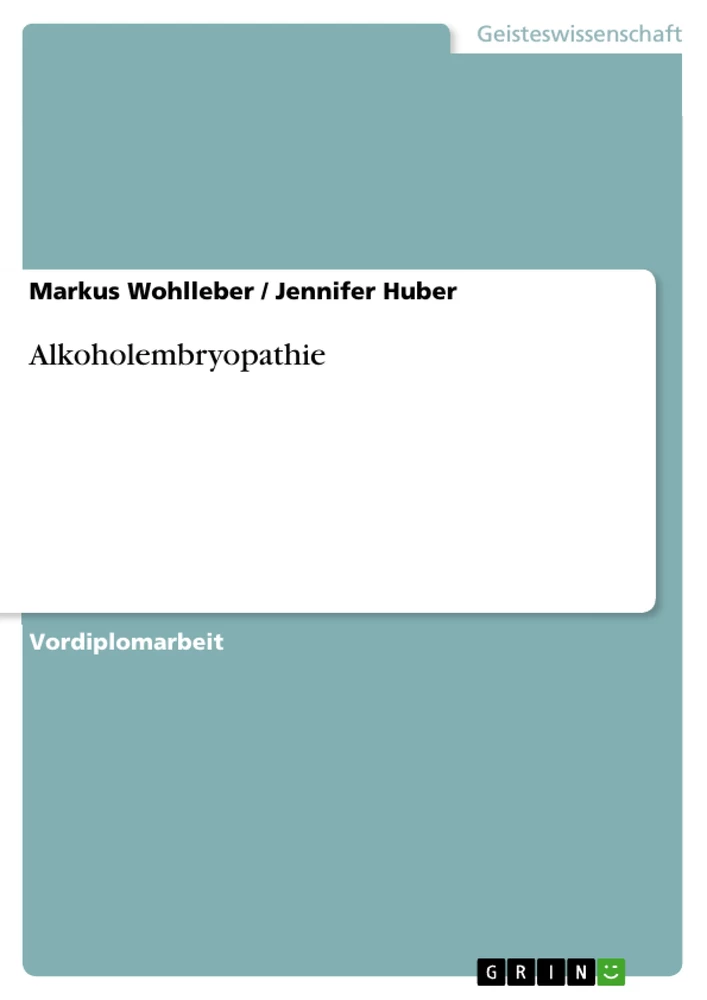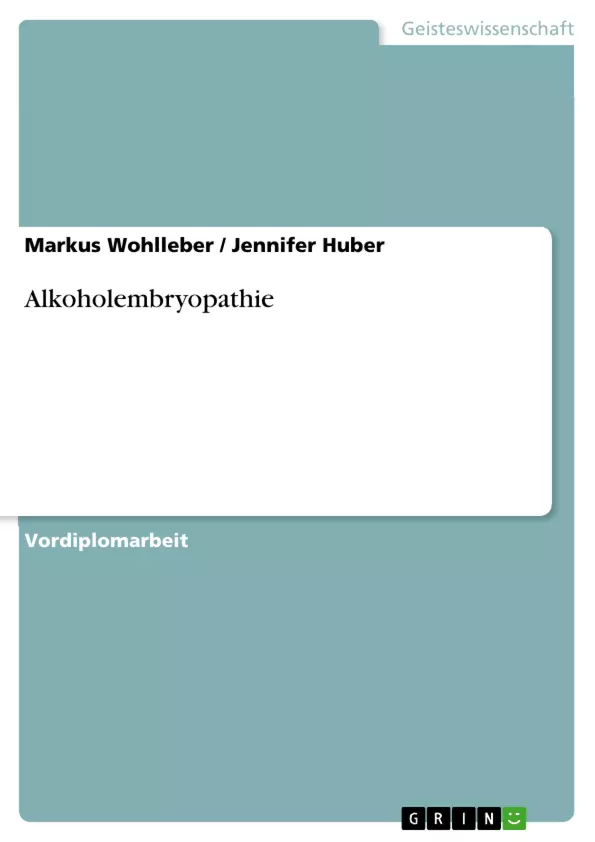In der folgenden Vordiplomarbeit zum Thema „Alkoholembryopathie“ wird der allgemeine Konsum von Alkohol in der Gesellschaft aufgezeigt, zu welchem ebenfalls die Punkte der Motivation und die Folgen bei übermäßigem Konsum zählen.
Danach gibt es einen Überblick über das Hauptthema, der Alkoholembryopathie. Dazu zählt als erstes eine Definition, ab wann man bei einem Kind von eine Alkoholembryopathie sprechen kann, sowie einen kurzen Einblick in die Geschichte und die Aufzählung über die Häufigkeit von Alkoholembryopathie in der Gesellschaft. Ebenso zeigt der nächste Punkt auf, welche pathologischen, neurologischen und psychologischen Störungen bei einem Kind entstehen können. Der fünfte und letzte Punkt dieser Arbeit bezieht sich auf die Hilfe und Unterstützung von sozialpädagogischen Einrichtungen in Bezug auf Kinder mit der Krankheit der Alkoholembryopathie.
Inhaltsverzeichnis
- I.) Einleitung
- II.) Der Alkoholkonsum in Deutschland
- II.1) Statistik über den Alkoholkonsum sortiert nach Alter, Geschlecht und sozialer Schicht
- II.2) Pro-Kopf-Verbrauch
- II.3) Die Motivation
- II.4) Die Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum
- III.) Die Alkoholembryopathie
- III.1) Definitionen
- III.2) Die Geschichte der Alkoholembryopathie
- III.3) Die Häufigkeit der Alkoholembryopathie
- IV.) Pathologische-, neurologische - und psychologische Störungen des Kindes
- IV.1) Gewicht, Länge und Kopfumfang
- IV.2) Gesichts-, Hals- und Ohrenfehlbildungen
- IV.3) Logisches und phantasievolles Denken, Konzentrations-, Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögensdefizite
- IV.4) Logopädische und motorische Dysfunktionen
- IV.5) Verhaltensstörungen
- IV.5.1) Die Hyperaktivität
- IV.5.2) Die Distanzlosigkeit in Verbindung mit Verführbarkeit und Risikobereitschaft
- IV.5.3) (Ein-) Schlafstörungen
- V.) Die Pädagogischtherapeutischen Einrichtungen
- V.1) Wer leistet Hilfestellung?
- V.1.1) Hilfen aus dem familiären Umfeld des Kindes
- V.1.2) Hilfen von Seiten pädagogischer Einrichtungen
- V.1.3) Die Integrativen Fördermaßnahmen
- VI.) Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Alkoholembryopathie. Ziel ist es, den Alkoholkonsum in Deutschland zu beleuchten, die Alkoholembryopathie zu definieren und ihre Auswirkungen auf Kinder zu beschreiben. Schließlich werden unterstützende pädagogisch-therapeutische Einrichtungen betrachtet.
- Alkoholkonsum in Deutschland: Statistiken und Motivation
- Definition und Geschichte der Alkoholembryopathie
- Pathologische, neurologische und psychologische Folgen für betroffene Kinder
- Häufigkeit der Alkoholembryopathie
- Hilfsangebote und unterstützende Einrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
I.) Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Alkoholembryopathie ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die verschiedenen Aspekte, die im Folgenden behandelt werden, beginnend mit dem Alkoholkonsum in Deutschland und endend mit der Betrachtung der Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Kinder.
II.) Der Alkoholkonsum in Deutschland: Dieses Kapitel präsentiert Statistiken zum Alkoholkonsum in Deutschland nach Alter, Geschlecht und sozialer Schicht. Es werden Daten aus dem Jahr 1998 herangezogen und der Pro-Kopf-Verbrauch analysiert. Zusätzlich werden mögliche Motivationsfaktoren für Alkoholkonsum diskutiert, wobei die Schwierigkeiten, genaue Angaben zu erhalten, betont werden. Die Komplexität des Themas wird deutlich gemacht, indem verschiedene Aspekte des Alkoholkonsums beleuchtet werden.
III.) Die Alkoholembryopathie: Dieses Kapitel beschäftigt sich umfassend mit der Alkoholembryopathie. Es beinhaltet eine genaue Definition, einen historischen Überblick und eine Darstellung der Häufigkeit des Auftretens in der Gesellschaft. Es legt den Grundstein für das Verständnis der Erkrankung und ihrer weitreichenden Folgen, die in den folgenden Kapiteln detaillierter untersucht werden.
IV.) Pathologische-, neurologische - und psychologische Störungen des Kindes: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die vielschichtigen Auswirkungen der Alkoholembryopathie auf die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Es werden verschiedene Störungsbilder wie Fehlbildungen, Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten (z.B. Hyperaktivität, Schlafstörungen) umfassend dargestellt. Die Komplexität der Erkrankung und die Herausforderungen für die betroffenen Kinder und ihre Familien werden verdeutlicht.
V.) Die Pädagogischtherapeutischen Einrichtungen: Das Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Hilfsmöglichkeiten für Kinder mit Alkoholembryopathie und deren Familien. Es werden Hilfen aus dem familiären Umfeld, von pädagogischen Einrichtungen und integrative Fördermaßnahmen untersucht und ihre Bedeutung im Unterstützungsprozess hervorgehoben. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Ebenen der Unterstützung und deren Zusammenspiel.
Schlüsselwörter
Alkoholembryopathie, Alkoholkonsum, Deutschland, Statistiken, Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, pädagogisch-therapeutische Einrichtungen, Fördermaßnahmen, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Alkoholembryopathie - Auswirkungen auf Kinder und unterstützende Maßnahmen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend die Alkoholembryopathie, ihre Auswirkungen auf Kinder und die verfügbaren pädagogisch-therapeutischen Unterstützungsmöglichkeiten. Sie beleuchtet den Alkoholkonsum in Deutschland, definiert die Alkoholembryopathie und beschreibt detailliert ihre Folgen für betroffene Kinder. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung unterstützender Einrichtungen und Maßnahmen.
Welche Aspekte des Alkoholkonsums in Deutschland werden behandelt?
Die Arbeit präsentiert Statistiken zum Alkoholkonsum in Deutschland, differenziert nach Alter, Geschlecht und sozialer Schicht (Datenstand 1998). Der Pro-Kopf-Verbrauch wird analysiert und mögliche Motivationsfaktoren für Alkoholkonsum werden diskutiert. Die Schwierigkeiten, genaue Angaben zu erhalten, werden ebenfalls angesprochen.
Wie wird die Alkoholembryopathie definiert und beschrieben?
Die Arbeit liefert eine präzise Definition der Alkoholembryopathie, gibt einen historischen Überblick und beschreibt die Häufigkeit ihres Auftretens. Sie legt den Grundstein für das Verständnis der Erkrankung und ihrer weitreichenden Folgen.
Welche Auswirkungen hat die Alkoholembryopathie auf Kinder?
Die Arbeit beschreibt detailliert die vielfältigen körperlichen und geistigen Auswirkungen der Alkoholembryopathie auf Kinder. Dies umfasst Fehlbildungen (Gesichts-, Hals- und Ohrenfehlbildungen), Entwicklungsverzögerungen (Gewicht, Länge, Kopfumfang), neurologische und psychologische Störungen (Denk- und Konzentrationsstörungen, Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögen, Logopädie und motorische Dysfunktionen) sowie Verhaltensauffälligkeiten wie Hyperaktivität, Schlafstörungen und Distanzlosigkeit mit erhöhter Verführbarkeit und Risikobereitschaft.
Welche pädagogisch-therapeutischen Einrichtungen und Maßnahmen werden vorgestellt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Hilfsmöglichkeiten für Kinder mit Alkoholembryopathie und ihre Familien. Dies beinhaltet Hilfen aus dem familiären Umfeld, Unterstützung von pädagogischen Einrichtungen und integrative Fördermaßnahmen. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Ebenen der Unterstützung und ihrem Zusammenspiel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Alkoholkonsum in Deutschland, Alkoholembryopathie, Pathologische, neurologische und psychologische Störungen des Kindes, Pädagogisch-therapeutische Einrichtungen und Schlusswort. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Alkoholembryopathie, von den Ursachen bis hin zu den unterstützenden Maßnahmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alkoholembryopathie, Alkoholkonsum, Deutschland, Statistiken, Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, pädagogisch-therapeutische Einrichtungen, Fördermaßnahmen, Prävention.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit hat zum Ziel, den Alkoholkonsum in Deutschland im Kontext der Alkoholembryopathie zu beleuchten, die Alkoholembryopathie zu definieren, ihre Auswirkungen auf Kinder zu beschreiben und die unterstützenden pädagogisch-therapeutischen Einrichtungen zu betrachten.
- Citar trabajo
- Markus Wohlleber (Autor), Jennifer Huber (Autor), 2005, Alkoholembryopathie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45720