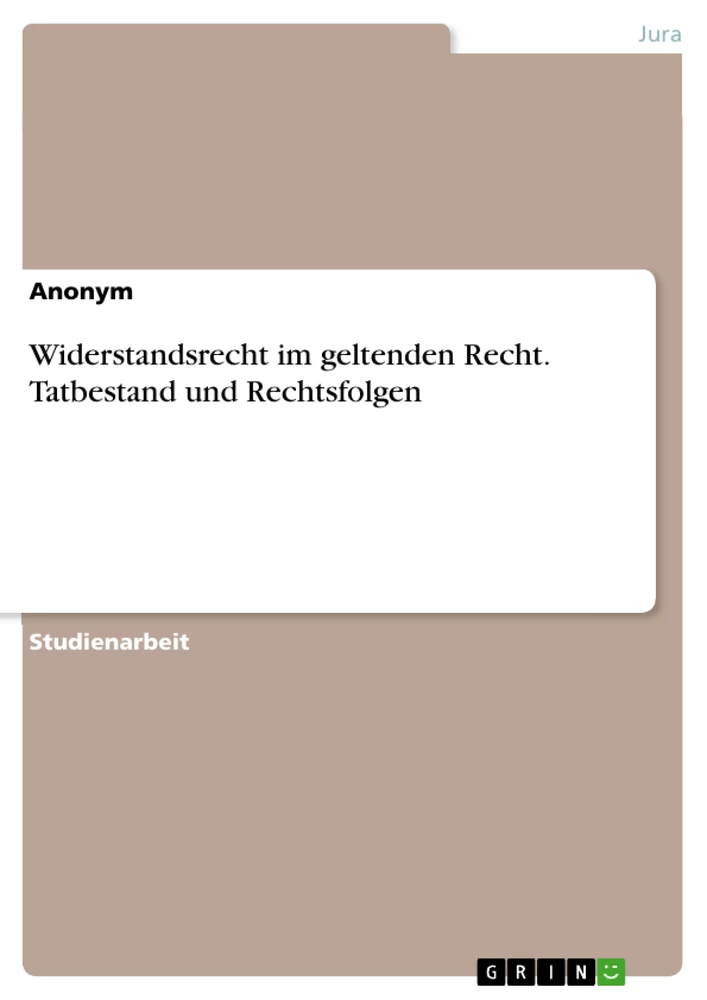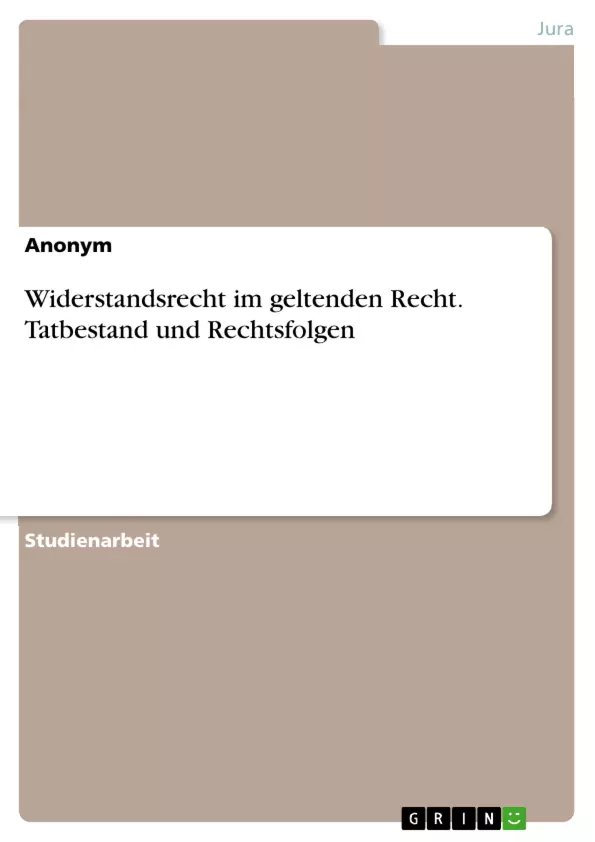Warum das Widerstandsrecht in Art. 20 IV GG zunächst von Kritikern als Beruhigungspille bezeichnet wurde, ob dies gerechtfertigt war und inwiefern es praktische Bedeutung entfalten konnte, sind die zentralen Fragen dieser Arbeit.
Grundstein für die Beantwortung dieser Fragen legt die Darstellung der historischen Entwicklung des Widerstandsrecht. Auf die Darstellung der über zweitausendjährigen internationalen Ideengeschichte wird dabei verzichtet, da dies den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. In diesem Kapitel wird auf das Widerstandsrecht in den Landesverfassungen von Hessen, Bremen und Berlin eingegangen, da das Widerstandsrecht in allen drei Landesverfassungen in unterschiedlichen Formen mit verschiedenen Inhalten früher kodifiziert wurde, als im Grundgesetz.
Der Fokus liegt auf der Erläuterung des Widerstandsrecht in der hessischen Verfassung, welches die Basis für die Kodifizierungen des Widerstandsrechts in die Verfassungen Bremens und Berlins und somit auch für die Einführung in das Grundgesetz darstellte. Die historischen und politischen Umstände sowie die Gründe für die Kodifizierung des Widerstandsrecht in Art. 20 IV GG werden nachfolgend dargestellt.
Anschließend steht die Erläuterung der Tatbestände im Mittelpunkt. Dabei wird insbesondere auf die restriktive Auslegung der Tatbestände eingegangen. Darüberhinaus werden in diesem Kapitel die Rechtsfolgen eruiert. Es wird der Frage nachgegangen, welche Situationen gemäß der restriktiven Auslegung des Widerstandsrecht, wie sie von der Rechtsprechung vorgenommen wird, überhaupt von Art. 20 IV GG erfasst werden.
Vor allem in von Diktaturen geprägten Staaten, wie etwa in Portugal und in Griechenland wurde ein Recht zum Widerstand in den Verfassungen kodifiziert. In der Schweiz und in Österreich wurde kein Recht zum Widerstand in den Verfassungen kodifiziert, jedoch bleibt die Diskussion über ein ungeschriebenen Widerstandsrechts lebendig. In anderen Ländern, beispielsweise in Großbritannien und Frankreich, fand das Widerstandsrecht über staatsrechtliche Traditionen den Weg in die Verfassungen.
Im Gegensatz zu Großbritannien und Frankreich konnte Deutschland nicht auf eigene staatsrechtliche Tradition zurückgreifen, da die Problematik des Widerstandsrechts aufgrund des deutschen Konstitutionalismus kaum diskutiert worden war. Eine Debatte über das Widerstandsrecht entwickelte sich erst nach 1945. In das Grundgesetz wurde das Widerstandsrecht am 24. Juni 1968 eingeführt.
Inhaltsverzeichnis
- B. Einleitung
- C. Das Widerstandsrecht in den Landesverfassungen der BRD und im Grundgesetz
- I. Widerstandsrecht in der Verfassung Hessens
- II. Widerstandsrecht in der Verfassung Bremens
- III. Widerstandsrecht in der Verfassung von Berlin
- IV. Widerstandsrecht im Grundgesetz
- D. Tatbestand und Rechtsfolgen
- I. Tatbestand
- 1. Träger des Rechts
- 2. Der Widerstandsfall
- 2.1,,Diese Ordnung“
- 2.2 Unternehmen
- 2.3 Andere Abhilfe ist nicht mehr möglich
- 2.4 Formen und Grenzen der Widerstandshandlung
- 3. Rechtsfolgen und Reichweite des Widerstandsrechts
- 3.1 Dogmatische Probleme
- 3.2 Unanwendbarkeit der Änderungssperre des Art. 79 III GG
- I. Tatbestand
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Widerstandsrecht in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Grundgesetz. Sie untersucht die historische Entwicklung des Widerstandsrechts in den Landesverfassungen und im Grundgesetz, analysiert die Tatbestände und Rechtsfolgen des Widerstandsrechts und beleuchtet die Bedeutung und die Grenzen des Widerstandsrechts im Kontext der deutschen Verfassungsgeschichte und -ordnung.
- Historische Entwicklung des Widerstandsrechts in den Landesverfassungen und im Grundgesetz
- Tatbestände und Rechtsfolgen des Widerstandsrechts
- Bedeutung und Grenzen des Widerstandsrechts im deutschen Verfassungsstaat
- Aktuelle Debatten um das Widerstandsrecht
- Praktische Relevanz und Anwendungsmöglichkeiten des Widerstandsrechts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Widerstandsrechts im internationalen Kontext und die historische Entwicklung des Widerstandsrechts in Deutschland. Sie führt in die Thematik ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor.
- Das Widerstandsrecht in den Landesverfassungen der BRD und im Grundgesetz: Dieses Kapitel untersucht die Kodifizierung des Widerstandsrechts in den Landesverfassungen von Hessen, Bremen und Berlin und die Einfügung des Widerstandsrechts in das Grundgesetz. Es analysiert die verschiedenen Formen und Inhalte des Widerstandsrechts in den einzelnen Verfassungen und die Gründe für die Einführung des Widerstandsrechts.
- Tatbestand und Rechtsfolgen: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Tatbestände und Rechtsfolgen des Widerstandsrechts. Es untersucht die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerstandsrechts, die Formen des Widerstands und die rechtlichen Konsequenzen des Widerstands.
Schlüsselwörter
Widerstandsrecht, Grundgesetz, Landesverfassungen, Bundesrepublik Deutschland, Verfassungsschutz, Rechtsstaat, Demokratie, Rechtsgehorsam, Notwehr, ultima ratio, politischer Widerstand, Staatsstreich, Notstand, Revolution, Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen
Wo ist das Widerstandsrecht im Grundgesetz verankert?
Das Widerstandsrecht ist in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes (GG) kodifiziert.
Was sind die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerstandsrechts?
Widerstand ist nur zulässig gegen jeden, der es unternimmt, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist (Ultima-Ratio-Prinzip).
Welche Rolle spielten die Landesverfassungen für das Widerstandsrecht?
In Hessen, Bremen und Berlin wurde das Widerstandsrecht bereits früher kodifiziert als im Grundgesetz. Insbesondere die hessische Verfassung diente als Basis für die spätere Einführung im GG.
Warum wurde das Widerstandsrecht 1968 in das Grundgesetz eingeführt?
Die Einführung erfolgte am 24. Juni 1968 im Zuge der Notstandsgesetze, um ein Gegengewicht zu den erweiterten Befugnissen des Staates im Krisenfall zu schaffen.
Gilt das Widerstandsrecht auch gegen legale Regierungsakte?
Nein, es ist ein Ausnahme- und Notrecht, das nur bei einem Angriff auf die demokratische Grundordnung greift, wenn der Rechtsweg und staatliche Organe versagen.
Was ist mit der "restriktiven Auslegung" des Widerstandsrechts gemeint?
Die Rechtsprechung legt die Hürden für das Widerstandsrecht sehr hoch an, um einen Missbrauch für politische Proteste oder zivilen Ungehorsam im Alltag zu verhindern.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Widerstandsrecht im geltenden Recht. Tatbestand und Rechtsfolgen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457542