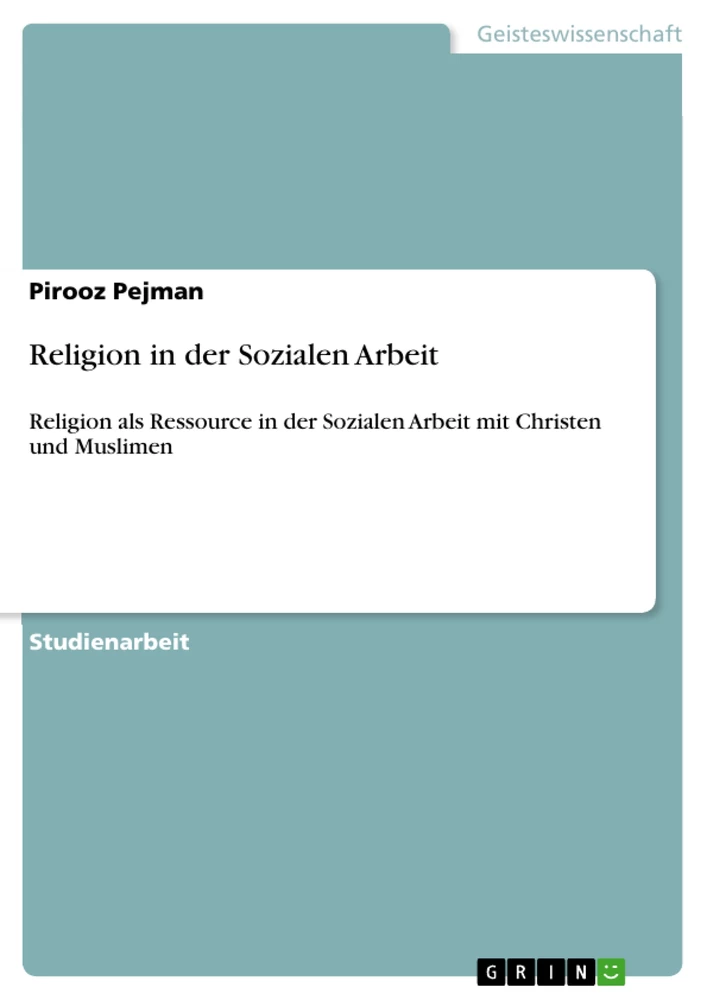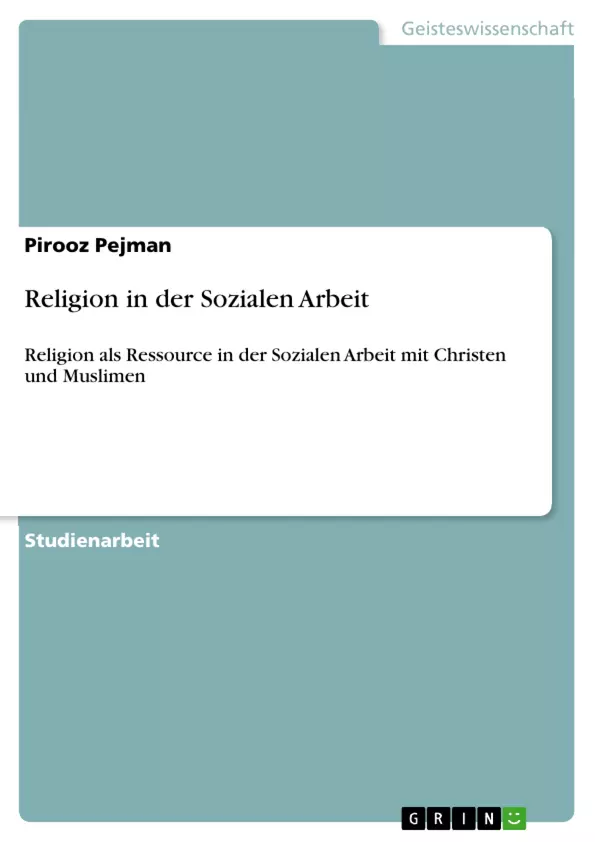Soziale Arbeit und Religion. Inwieweit können Religion als Ressource für die Soziale Arbeit genutzt werden? Inwieweit weisen sie Affinitäten zueinander auf? Insbesondere vor dem Hintergrund der Erstarkung religiöser Bewegungen und der zunehmenden Tendenz, sich Weltreligionen, wie dem Islam, anzuschließen sowie fundamentalistischen Bewegungen auf religiöser Ebene ist die vorliegende Hausarbeit erstellt worden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Bestimmung und Abgrenzung
- (Kritische) Thesen zur Nähe zw. Religion & Sozialer Arbeit
- Anwendung religiöser Ansätze auf die Soziale Arbeit
- Zwei Beispiele für Nutzung von Religion als Ressource in der Sozialen Arbeit
- Religions-pädagogisches Handlungskonzept in der Jugendhilfe
- Muslimische Seelsorge
- Lösungsorientierter Umgang mit Religion - Geisenheimer Thesen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle von Religion in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Hinblick auf die Integration von Muslimen in Deutschland. Sie analysiert die Verbindung zwischen Religion und Sozialer Arbeit sowie deren mögliche Nutzung als Ressource in der Praxis. Die Arbeit zielt darauf ab, sowohl kritische als auch befürwortende Perspektiven zu beleuchten und ein praktisches Konzept für religionsensible Soziale Arbeit zu entwickeln.
- Verbindung zwischen Religion und Sozialer Arbeit
- Einsatz von Religion als Ressource in der Sozialen Arbeit
- Integration von Muslimen in Deutschland
- Religionsensible Soziale Arbeit
- Konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit im Kontext von Religion
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz von Religion in der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die historische Entwicklung und die aktuelle Bedeutung des Zusammenhangs zwischen Religion und Sozialer Arbeit.
- Begriffliche Bestimmung und Abgrenzung: Dieses Kapitel klärt die Begriffe Religion, Religiosität und Spiritualität und grenzt sie voneinander ab. Es wird darauf hingewiesen, dass die Grenzen zwischen diesen Begriffen in der Praxis oftmals verschwimmen.
- (Kritische) Thesen zur Nähe zw. Religion & Sozialer Arbeit: Dieses Kapitel präsentiert sowohl befürwortende als auch kritische Thesen zum Thema der Verbindung zwischen Religion und Sozialer Arbeit. Es wird diskutiert, inwieweit Religion in der Sozialen Arbeit eine konstruktive Rolle spielen kann und welche Herausforderungen es im Zusammenhang mit Religion und Macht gibt.
- Anwendung religiöser Ansätze auf die Soziale Arbeit: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze, wie religiöse Überzeugungen und Praktiken in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden können. Es werden sowohl christliche als auch andere religiöse Perspektiven berücksichtigt.
- Zwei Beispiele für Nutzung von Religion als Ressource in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel stellt zwei konkrete Beispiele für den Einsatz von Religion als Ressource in der Sozialen Arbeit vor: das religions-pädagogische Handlungskonzept in der Jugendhilfe und die muslimische Seelsorge.
- Lösungsorientierter Umgang mit Religion - Geisenheimer Thesen: Dieses Kapitel behandelt die Geisenheimer Thesen, die einen lösungsorientierten Umgang mit Religion in der Sozialen Arbeit fördern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Religion, Religiosität, Sozialer Arbeit, Integration von Muslimen, Interkulturelle Kompetenz, Religionsensible Soziale Arbeit, Theologische Ansätze in der Sozialen Arbeit, Interreligiöser Dialog, Seelsorge, Jugendhilfe, Subsidiaritätsprinzip.
- Quote paper
- Pirooz Pejman (Author), 2018, Religion in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457640