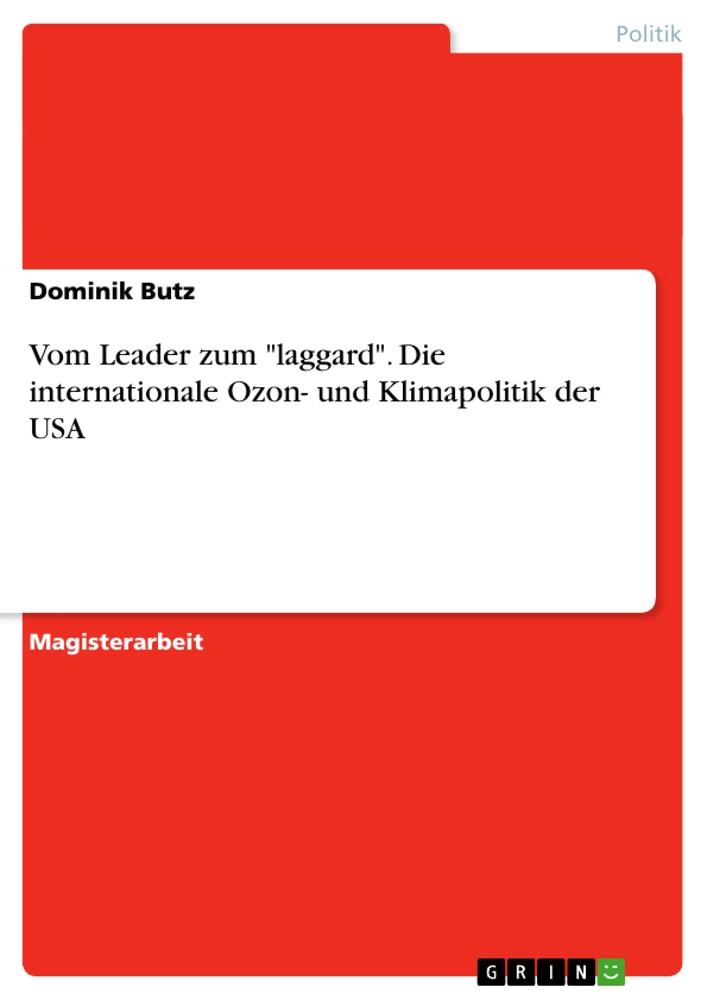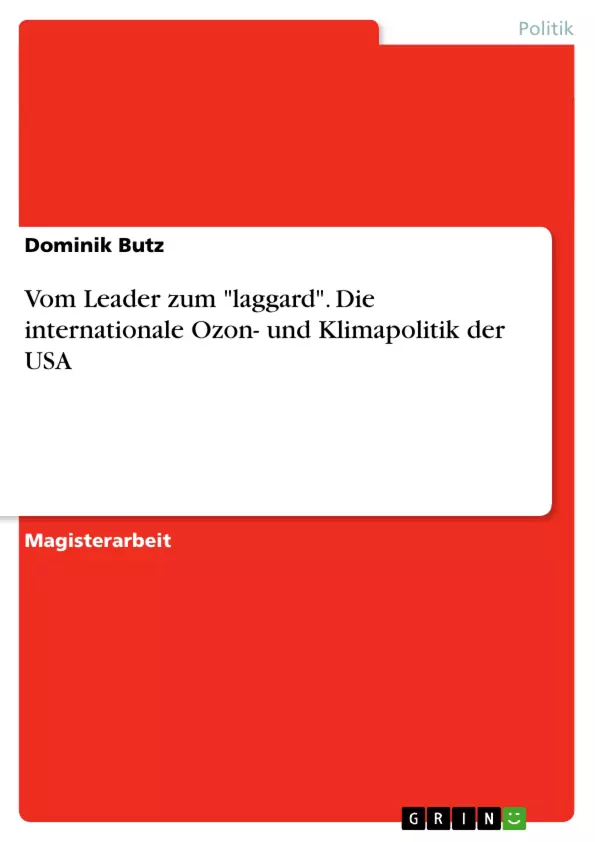Als der Weltöffentlichkeit am 16. September 1987 das Montreal-Protokoll über ozonzerstörende Substanzen präsentiert wurde, hatte die Staatengemeinschaft das wichtigste Kapitel einer bis dato noch nicht gesehenen Erfolgsgeschichte der internationalen Umweltpolitik geschrieben. Das Montreal-Protokoll und seine zahlreichen in den 90er Jahren vorgenommenen Regelungsverschärfungen undausweitungen werden in den nächsten Jahrzehnten zu einer nachhaltigen Abnahme der Konzentration ozonzerstörender Substanzen (OZS) in der Stratosphäre führen (siehe Anhang 6.1). Schätzungen haben ergeben, dass es ohne das internationale Ozonregime innerhalb dieses Jahrhunderts zu einer dreißigprozentigen Ausdünnung der Ozonschicht und als Folgewirkung zu einer Vervierfachung der Hautkrebsfälle bis zum Jahr 2100 gekommen wäre (Benedick1998a: 313).Bereits das ursprüngliche Montreal-Protokoll sah eine Verringerung der Produktion und des Verbrauchs der wichtigsten FCKW um 50% bis Ende der 90er Jahre vor; die erfolgten Abänderungen haben bis heute zu einem fast vollständigen Verbot der OZS in den Industriestaaten und zu einer substantiellen Reduktion in den Entwicklungsländern geführt. Die Beteiligung an dem ersten globalen Umweltregime der Geschichte ist bis heute auf mehr als 180 Staaten angewachsen.
Das Kyoto-Protokoll - Kernstück des internationalen Klimaregimes - wird auf mittlere Sicht kein vergleichbares Effektivitätsniveau erreichen wie das Montreal-Protokoll. Zwar wurde der im Dezember 1997 unterzeichnete Vertrag, der für 39 Industriestaaten eine insgesamt fünfprozentige Reduktion der wichtigsten Treibhausgase (THG) ab dem Basisjahr 1990 bis zur Zielperiode 2008-2012 vorsieht, bisher von 1501Staaten ratifiziert und konnte am 16. Februar 2005, nachdem auch die russische Duma dem Vertragswerk zugestimmt hatte, in Kraft treten. Jedoch ist bereits heute schon absehbar, dass das Ziel der Klimarahmenkonvention (FCCC), „eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird“ (FCCC, Artikel 2) auf mittlere Sicht nicht erreicht wird. Die THG-Emissionen der Entwicklungsländer, die keine Stabilisierungsverpflichtungen zu erfüllen haben, werden von 1990 bis 2010 voraussichtlich um 34% und die der USA und Australiens ebenfalls um etwa 34% angestiegen sein.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DAS EMPIRISCHE PUZZLE
- DIE ABHÄNGIGE VARIABLE
- INDIZIEN DES VORREITER- UND BREMSERVERHALTENS
- DER WEG ZUM MONTREAL-PROTOKOLL: DIE USA ALS LEADER
- DIE ROLLE DER USA IN DEN VERHANDLUNGEN ZUM MONTREAL-PROTOKOLL VON 1987
- DIE WEITERENTWICKLUNG DES MONTREAL-PROTOKOLLS
- DER WEG ZUM KYOTO-PROTOKOLL: DIE USA ALS „BREMSER“
- BEGINN DER INTERNATIONALEN PROBLEMBEARBEITUNG UND ERSTE NATIONALE MASSNAHMEN
- DER VERHANDLUNGSPROZESS ZUR KLIMARAHMENKONVENTION UND DIE ERSTE VERTRAGSSTAATENKONFERENZ
- DER VERHANDLUNGSPROZESS ZUM KYOTO-PROTOKOLL
- ZWISCHENBILANZ
- DER NEOLIBERALE INSTITUTIONALISMUS: KOSTEN-NUTZEN-KALKÜLE UNTER DEN BEDINGUNGEN KOLLEKTIVER HANDLUNGSDILEMMATA
- GRUNDANNAHMEN DER THEORIE
- ENTWICKLUNG DES THEORETISCHEN ANSATZES: DIE RATIFIKATIONSENTSCHEIDUNG ALS SITUATIONSSTRUKTURELLE KOSTEN-NUTZEN-RECHNUNG
- SEQUENZIELLE SPIELE IN DER OZON- UND KLIMAPOLITIK
- DIE RATIFIKATIONSENTSCHEIDUNG UND DIE FUNKTION INTERNATIONALER REGIME
- HYPOTHESENTEST
- DIE RATIFIKATION DES MONTREAL-PROTOKOLLS ALS DOMINANTE STRATEGIE
- DIE NICHT-RATIFIKATION DES KYOTO-PROTOKOLLS ALS „FREE-RIDING“
- ERWEITERUNG DES THEORETISCHEN ANSATZES: EPISTEMIC COMMUNITIES UND DAS PROBLEM DER UNVOLLSTÄNDIGEN INFORMATION
- ZWISCHENBILANZ: ZUSAMMENFASSUNG UND KRITIK
- DIE LIBERALE THEORIE: WIRTSCHAFTSINTERESSEN VS. UMWELTINTERESSEN
- AUBENPOLITIK ALS ZWEI-EBENEN-SPIEL: EIN MODELLTHEORETISCHER RAHMEN ZUR RATIFIKATIONSENTSCHEIDUNG
- DIE GRUNDZÜGE VON PUTNAMS ZWEI-EBENEN-MODELL
- GRUNDANNAHMEN UND VARIANTEN DES LIBERALISMUS
- HYPOTHESENTEST
- DIE BESTIMMUNGSFAKTOREN DER WIN-SET-GRÖSSE: VERSCHIEDENE HYPOTHESEN
- DIE PRIVILEGIERUNG INDUSTRIELLER INTERESSEN
- DIE INNERSTAATLICHE REGELUNG UND DIE INTERNATIONALE WETTBEWERBSSITUATION ALS EINFLUSSFAKTOREN
- DIE PARTEIDIFFERENZHYPOTHESE
- DER EINFLUSS DER ÖFFENTLICHEN MEINUNG UND DAS WIEDERWAHLKALKÜL
- DAS KRÄFTEVERHÄLTNIS ZWISCHEN VERURSACHER- UND HELFERINTERESSEN
- ZWISCHENBILANZ: SYNERGIE DER ERKLÄRUNGSFAKTOREN?
- SCHLUSSBETRACHTUNG: HYPOTHESE 1 VS. HYPOTHESE 3
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die internationale Ozon- und Klimapolitik der USA und untersucht dabei, warum sich die USA im Bereich der Ozonpolitik als Vorreiter („leader“) und im Bereich der Klimapolitik als Bremser („laggard“) präsentiert haben.
- Das empirische Puzzle: Vergleichende Analyse der USA als „leader“ in der Ozonpolitik und als „laggard“ in der Klimapolitik
- Theoretische Ansätze: Neoliberaler Institutionalismus und liberale Theorie
- Ratifikationsentscheidungen als Kosten-Nutzen-Kalküle: Analyse der „win-sets“ in der Ozon- und Klimapolitik
- Einflussfaktoren auf die „win-sets“: Wirtschaftsinteressen, innerstaatliche Politik, öffentliche Meinung
- Zusammenspiel von innerstaatlichen und internationalen Faktoren: Zwei-Ebenen-Spielmodell
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt das empirische Puzzle vor, indem es die Rolle der USA in der internationalen Ozon- und Klimapolitik beleuchtet. Es werden Indizien für das Vorreiter- und Bremserverhalten der USA in beiden Politikfeldern aufgezeigt. Das zweite Kapitel widmet sich den theoretischen Ansätzen des Neoliberalen Institutionalismus und der liberalen Theorie. Es wird die Ratifikationsentscheidung als situationsstrukturelle Kosten-Nutzen-Rechnung analysiert und die Bedeutung von „win-sets“ in der Ozon- und Klimapolitik herausgestellt. Das dritte Kapitel untersucht die Einflussfaktoren auf die „win-sets“, wie Wirtschaftsinteressen, innerstaatliche Politik und öffentliche Meinung. Es wird das Zwei-Ebenen-Spielmodell vorgestellt, um das Zusammenspiel von innerstaatlichen und internationalen Faktoren zu erklären.
Schlüsselwörter
Ozonpolitik, Klimapolitik, USA, Vorreiter, Bremser, Neoliberaler Institutionalismus, Liberale Theorie, Ratifikationsentscheidung, Kosten-Nutzen-Kalkül, „win-sets“, Wirtschaftsinteressen, innerstaatliche Politik, öffentliche Meinung, Zwei-Ebenen-Spielmodell
Häufig gestellte Fragen
Warum gelten die USA in der Ozonpolitik als Vorreiter (Leader)?
Die USA spielten eine entscheidende Rolle bei der Verhandlung und Umsetzung des Montreal-Protokolls von 1987, das zu einem fast vollständigen Verbot ozonzerstörender Substanzen in Industriestaaten führte.
Weshalb werden die USA in der Klimapolitik als „Bremser“ (Laggard) bezeichnet?
Im Gegensatz zur Ozonpolitik haben die USA das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert und verzeichneten einen deutlichen Anstieg ihrer Treibhausgasemissionen, was die Erreichung globaler Klimaziele erschwerte.
Was ist das zentrale Ziel des Montreal-Protokolls?
Das Ziel ist die nachhaltige Abnahme der Konzentration ozonzerstörender Substanzen (OZS) in der Stratosphäre, um die Ausdünnung der Ozonschicht und deren gesundheitliche Folgen zu verhindern.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Analyse der US-Politik genutzt?
Die Analyse stützt sich auf den Neoliberalen Institutionalismus (Kosten-Nutzen-Kalküle) und die liberale Theorie (Einfluss von Wirtschaftsinteressen und innerstaatlicher Politik).
Was versteht man unter dem „Zwei-Ebenen-Spielmodell“?
Es ist ein modelltheoretischer Rahmen nach Putnam, der erklärt, wie die Außenpolitik durch das Zusammenspiel von internationalen Verhandlungen und innerstaatlichen Interessen (Win-Sets) bestimmt wird.
Welchen Einfluss hat die öffentliche Meinung auf die US-Umweltpolitik?
Die öffentliche Meinung und das Wiederwahlkalkül von Politikern sind wesentliche Bestimmungsfaktoren für die Größe der „Win-Sets“ und damit für die Bereitschaft, internationale Abkommen zu ratifizieren.
- Quote paper
- Dominik Butz (Author), 2005, Vom Leader zum "laggard". Die internationale Ozon- und Klimapolitik der USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45777