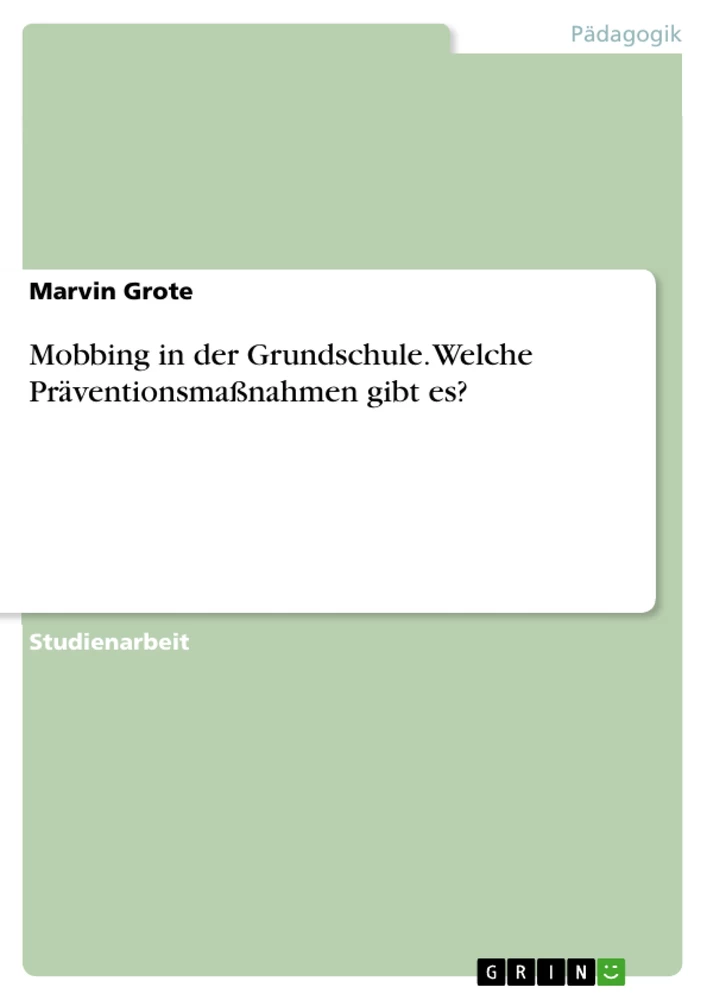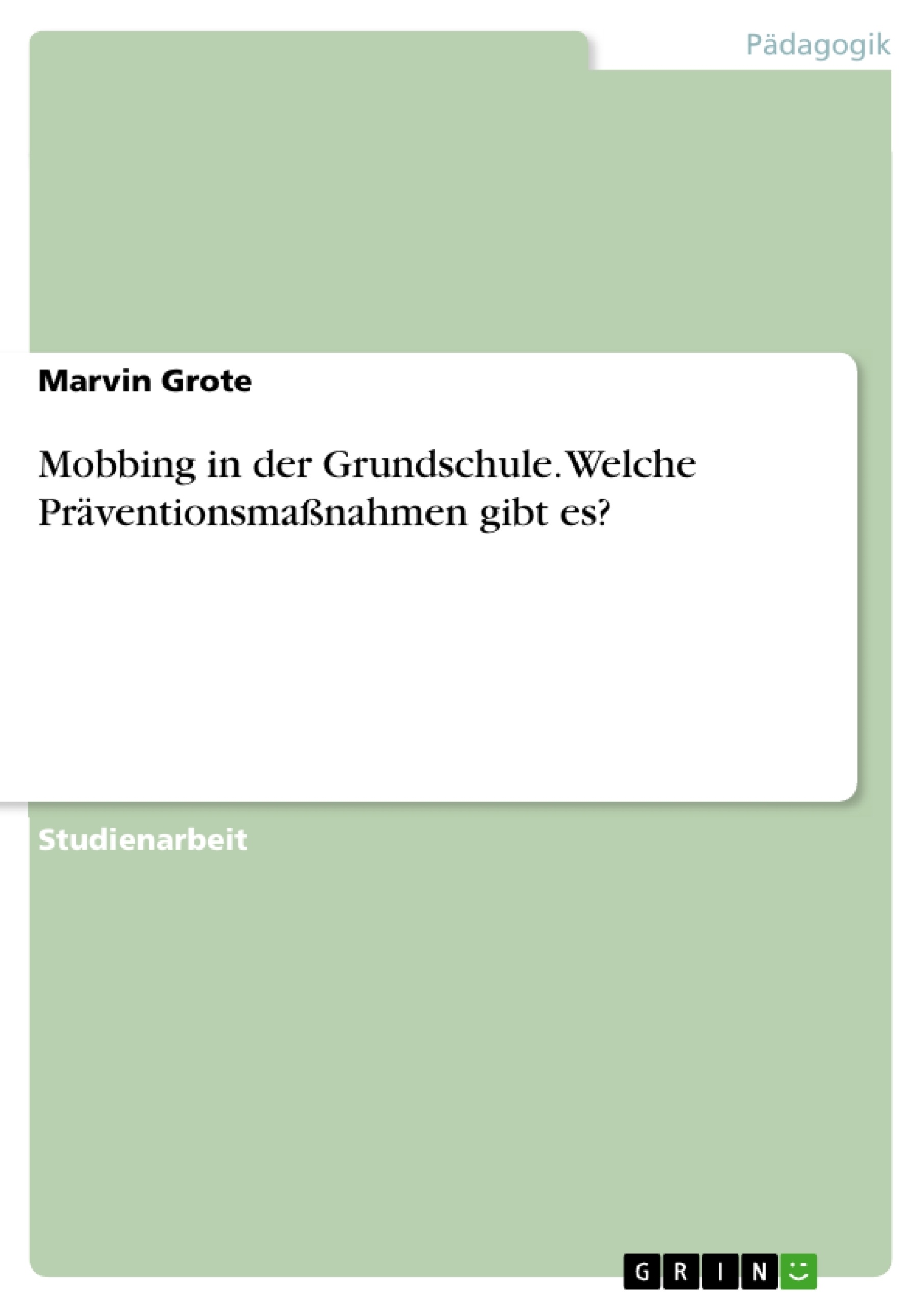Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Mobbing und der Frage, was Sozialarbeiter unternehmen können, um Mobbing in Grundschulen präventiv entgegenzuwirken.
Dem Thema Mobbing wurde in den letzten Jahren immer mehr Beachtung geschenkt, denn durch die immer öfter auftretenden Mobbingvorfälle an Schulen stand fest, dass für die Betroffenen Hilfe geleistet werden und diesen Vorfällen durch präventive Maßnahmen entgegengetreten werden muss. Es steht fest, dass die Sozialarbeiter einen großen Beitrag der Präventions- und Interventionsarbeit leisten. Jedoch reicht dies nicht aus, um Mobbing dauerhaft einzudämmen, da alle Schüler, Lehrer und Sozialarbeiter zusammenarbeiten müssen.
Durch Präventionsprogramme, die von den Sozialarbeitern an die Lehrer weitergegeben werden, ist es möglich feste Verhaltensregeln aufzustellen, die das Mobbing eindämmen. Schüler müssen in Ihrem Schulalltag aufmerksamer sein und einschreiten, wenn jemand gemobbt wird oder direkt Hilfe hinzuziehen.
Unter dem Begriff Mobbing ist eine dauerhafte und grundlegende Form aggressiven Verhaltens zu verstehen, das von einer, einem oder mehreren TäterInnen ausgeht und sich meist gegen eine angegriffene Person wendet. Mobbing tritt in vielen verschiedenen Bereichen des Lebens auf, wie in der Schule, am Arbeitsplatz oder auch in der Familie. Das Besondere an dieser Gewaltform ist, dass sie oft verdeckter ausgeübt wird als andere gewaltsame Umgangsformen. Die Opfer haben häufig Schwierigkeiten, sich in ihrer Not selbst als Opfer zu erkennen oder sich gar anderen zu offenbaren.
Wichtig ist, zwischen singulären, negativen Handlungen wie Ärgernissen, misslungenen Scherzen, Unhöflichkeiten, Beschimpfungen oder anderen vereinzelten Vorkommnissen und zwischen Mobbing selbst zu unterscheiden. Denn von Mobbing wird erst gesprochen, wenn die negativen Folgen des Mobbens systematisch über einen längeren Zeitraum ausgeübt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist unter Mobbing zu verstehen?
- Welche Formen von Mobbing gibt es und wie sind sie voneinander abzugrenzen?
- Was sind die Gründe und Ursachen für Mobbing?
- Wer ist von Mobbing betroffen?
- Mobbing in der Grundschule
- Was sind mögliche Handlungsoptionen der SozialarbeiterInnen in Grundschulen?
- Was können Schüler gegen Mobbing tun?
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen Mobbing in Grundschulen und konzentriert sich auf die Rolle von Sozialarbeitern bei der Prävention. Sie beleuchtet die verschiedenen Formen von Mobbing und ihre Ursachen sowie die Auswirkungen auf die Betroffenen. Darüber hinaus werden Handlungsmöglichkeiten für Sozialarbeiter und Schüler aufgezeigt, um Mobbing entgegenzuwirken.
- Definition und Formen von Mobbing
- Ursachen und Folgen von Mobbing
- Präventive Maßnahmen von Sozialarbeitern in Grundschulen
- Möglichkeiten für Schüler, Mobbing entgegenzuwirken
- Diskussion von Handlungsoptionen und Lösungsansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung befasst sich mit der Relevanz des Themas Mobbing in Grundschulen und den schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen. Sie stellt die Rolle von Sozialarbeitern in diesem Kontext dar und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Das zweite Kapitel definiert Mobbing und unterscheidet verschiedene Formen von Mobbing, wie körperliches, verbales und relationales Mobbing. Es werden auch die Ursachen und Folgen von Mobbing sowie die verschiedenen Gruppen, die von Mobbing betroffen sind, erörtert.
- Das dritte Kapitel fokussiert sich auf Mobbing in der Grundschule. Es werden mögliche Handlungsoptionen für Sozialarbeiter in Grundschulen aufgezeigt, um Mobbing präventiv entgegenzuwirken. Außerdem wird beleuchtet, wie Schüler aktiv gegen Mobbing vorgehen können.
Schlüsselwörter
Mobbing, Grundschule, Sozialarbeit, Prävention, Handlungsoptionen, Schüler, Gewalt, Aggression, psychosoziale Folgen, relationales Mobbing, körperliches Mobbing, verbales Mobbing, Cybermobbing.
Häufig gestellte Fragen
Ab wann spricht man wissenschaftlich von Mobbing?
Von Mobbing spricht man erst, wenn negative Handlungen systematisch und über einen längeren Zeitraum gegen eine Person ausgeübt werden, nicht bei einmaligen Vorfällen.
Welche Rolle spielen Sozialarbeiter bei der Mobbing-Prävention?
Sozialarbeiter entwickeln Präventionsprogramme, geben Verhaltensregeln an Lehrer weiter und unterstützen Betroffene sowie die gesamte Schulgemeinschaft bei der Intervention.
Welche verschiedenen Formen von Mobbing gibt es in der Grundschule?
Es wird zwischen körperlichem, verbalem, relationalem (sozialer Ausschluss) Mobbing und zunehmend auch Cybermobbing unterschieden.
Wie können Schüler aktiv gegen Mobbing vorgehen?
Schüler sollten im Alltag aufmerksam sein, bei Vorfällen einschreiten oder direkt Hilfe durch Lehrer oder Sozialarbeiter hinzuziehen.
Warum erkennen sich Opfer oft nicht selbst als solche?
Mobbing geschieht oft verdeckt, was es Opfern erschwert, die systematische Natur der Gewalt zu erkennen oder sich anderen aus Scham zu offenbaren.
- Quote paper
- Marvin Grote (Author), 2018, Mobbing in der Grundschule. Welche Präventionsmaßnahmen gibt es?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458042