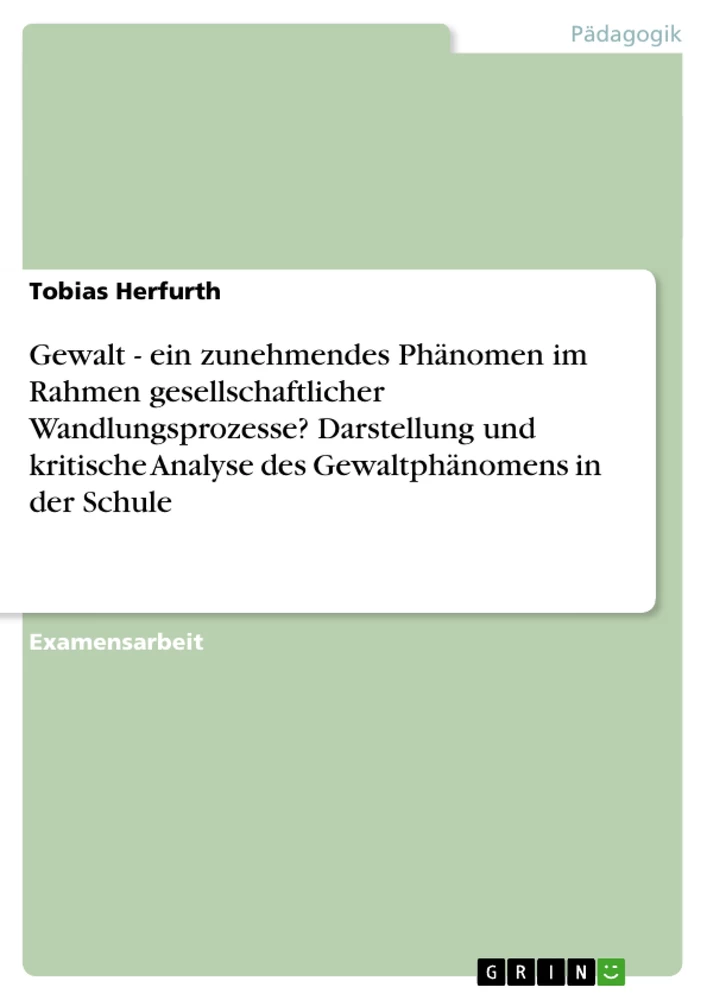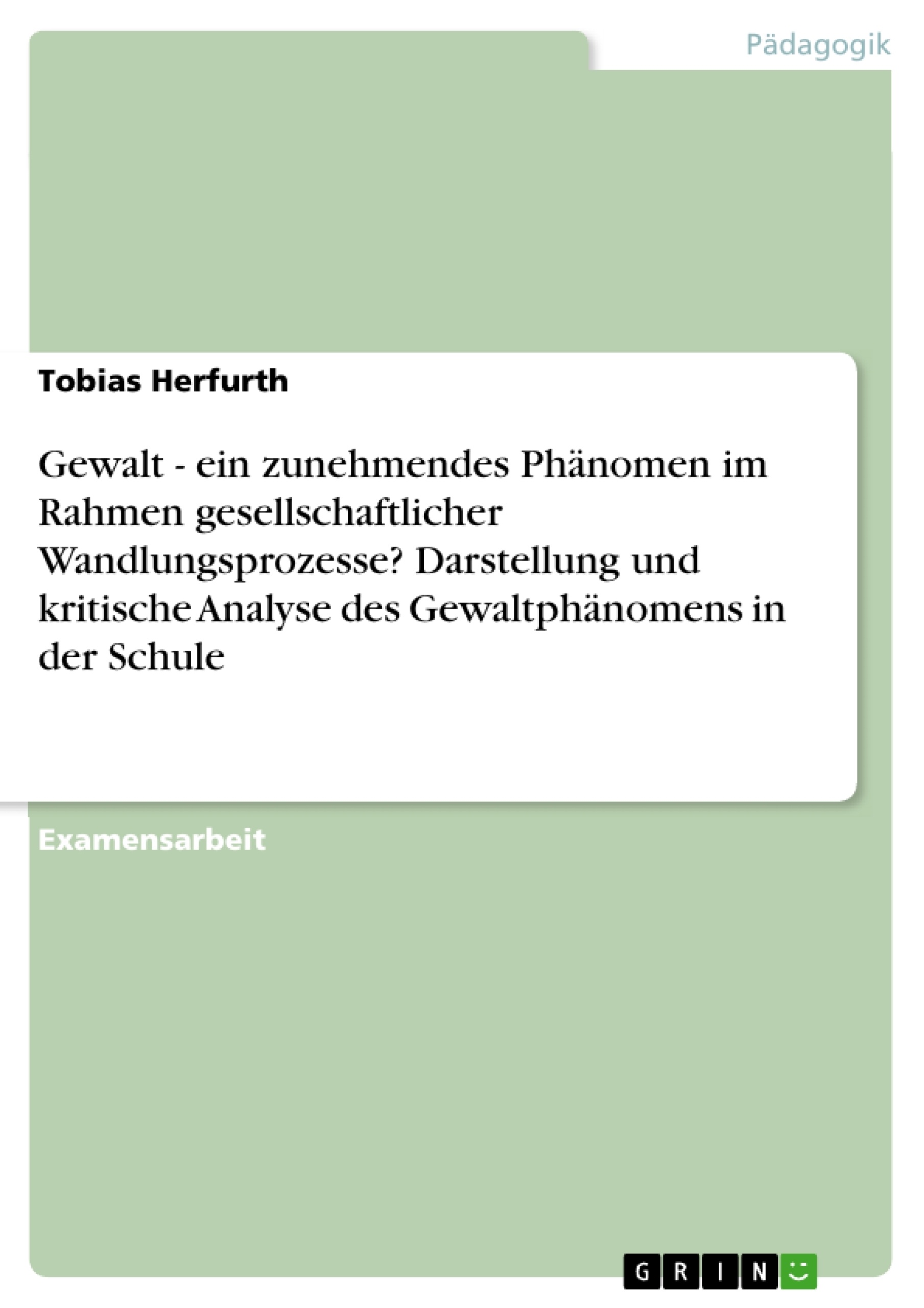Innerhalb des letzten Jahrzehntes ist die Gewalt an Schulen bzw. die Gewalt unter Kindern und Jugendlichen in zunehmendem Maße, insbesondere durch die Medienberichterstattung, in die öffentliche Diskussion und damit auch in das Interesse der wissenschaftlichen Forschung gerückt. Eine Zeit lang berichteten die Medien fast täglich darüber, besonders in der Zeit, als es nach einigen Vorfällen in den USA auch in Deutschland einige „spektakuläre“ Einzeltaten von Schülern gegeben hat. Ist das öffentliche Interesse an diesem Thema zwar inzwischen wieder etwas abgeklungen, so ist es in der wissenschaftlichen Forschung dafür nach wie vor aktuell.
Ein Aspekt, den dabei zu diskutieren gilt, ist, in welcher Beziehung die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse und ihre Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche zu deren Gewaltverhalten stehen. Das unsere Gesellschaft sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert hat, ist sicherlich unbestritten. Doch welche Folgen und Auswirkungen hat dies auf die Kinder und Jugendlichen und wird dadurch auch das Gewaltverhalten beeinflußt, oder wo sind die Ursachen für Gewaltverhalten sonst zu suchen? Hat sich da Gewaltverhalten von Kindern und Jugendlichen überhaupt verändert bzw. gibt es heutzutage mehr Gewalt oder hat sich eventuell die Qualität der Gewalt verändert? Und welche Möglichkeiten haben die Schulen durch gewaltpräventive Arbeit dem möglichen Anstieg von Gewalt zu begegnen?
Diesen Fragestellungen vorangestellt wurde die Frage, ob die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse auch durch einen Wandel der Werte bedingt sind bzw. ob und wie sie zu einem solchen in Beziehung stehen. Anschließend sollen zunächst die Auswirkungen der gesellschaftlichen Wandlungsprozesse auf Kinder und Jugendliche besprochen werden, danach wird die Gewalt an Schulen in Quantität und Qualität dargestellt, so daß im nächsten Schritt eine mögliche Beziehung der Auswirkungen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse und dem Gewaltverhalten von Kindern und Jugendlichen diskutiert werden kann bzw. mögliche andere Ursachen aufzuzeigen sind. Abschließend werden Ebenen und Bereiche gewaltpräventiver Maßnahmen in der Schule vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung und Problemstellung der Arbeit
- Der gesellschaftliche Wertewandel
- Definition des Wertbegriffs
- Wandel der Werte in unserer Gesellschaft?
- Zwischenfazit
- Die Auswirkungen des Wertewandels auf Kinder und Jugendliche/veränderte Lebensweltbedingungen von Kindern und Jugendlichen
- Im familiären und sozialen Bereich
- Im schulischen Bereich
- In der Arbeitswelt
- Die Bedeutung der Medien
- Kritische Reflexion des Wertewandels in Bezug auf Gewalt
- Das Gewaltphänomen
- Definition des Gewaltbegriffs
- Formen der Gewalt
- Untersuchung des Ausmaßes, der Häufigkeit und der Qualität von Gewalthandlungen an Schulen mit Hilfe von Studien und statistischen Daten
- Jugendkriminalität
- Gewaltaufkommen im Zeitvergleich
- Gewaltaufkommen nach Schulformen
- Häufigkeit und Qualität einzelner Gewaltformen
- Gewalt gegen Lehrer/innen
- Rechtsextremistisch- motivierte Gewalt
- Mögliche Ursachen für das Auftreten von Gewalt
- mögliche Ursachen im familiären Bereich
- mögliche Ursachen für das unterschiedlich hohe Gewaltaufkommen an einzelnen Schulformen/ schulbedingte Ursachen
- andere Ursachen
- Ursachen aus Sicht der Lehrer/innen und der Schüler/innen
- Die an den Gewaltprozessen Beteiligten
- Die Täter von Gewalt
- Die Opfer von Gewalt
- Die Täter-Opfer-Kette
- Analyse und kritische Reflexion der Daten und Ergebnisse
- Ebenen und Bereiche präventiver Maßnahmen sowie kritische Diskussion
- Bereiche der Prävention
- Räumliche und bauliche Maßnahmen/Möglichkeiten
- Regeln aufstellen, achten und einüben
- Präventive Maßnahmen zur Täter-Opfer-Problematik
- Lehrer-Eltern-Zusammenarbeit
- Binnendifferenzierter Unterricht
- Sozialtraining
- Reflexion der Maßnahmen
- Der Einfluss des gesellschaftlichen Wertewandels auf Kinder und Jugendliche
- Die Ursachen und Formen von Gewalt an Schulen
- Die Rolle von Medien und Lebensweltbedingungen
- Die Analyse von Gewaltdaten und Statistiken
- Präventionsmaßnahmen und ihre Wirksamkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Examensarbeit untersucht das Gewaltphänomen an Schulen und setzt sich mit den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und ihren möglichen Auswirkungen auf das Gewaltverhalten von Kindern und Jugendlichen auseinander. Sie beleuchtet die veränderte Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Bereichen und diskutiert die Auswirkungen des Wertewandels auf die Entstehung von Gewalt. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Formen von Gewalt an Schulen, untersucht das Ausmaß und die Häufigkeit von Gewalthandlungen und beleuchtet die möglichen Ursachen für das Auftreten von Gewalt. Im letzten Schritt werden präventive Maßnahmen und ihre Wirksamkeit im Kampf gegen Gewalt an Schulen diskutiert.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse des gesellschaftlichen Wertewandels und dessen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Sie beleuchtet die Veränderungen in der familiären, sozialen, schulischen und medialen Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen und erörtert die möglichen Auswirkungen des Wertewandels auf das Gewaltverhalten.
Im nächsten Kapitel wird das Gewaltphänomen an Schulen genauer betrachtet. Die Arbeit definiert den Gewaltbegriff, analysiert verschiedene Formen von Gewalt und untersucht das Ausmaß und die Häufigkeit von Gewalthandlungen in Schulen. Es werden verschiedene Studien und Statistiken herangezogen, um die Entwicklung des Gewaltphänomens im Zeitvergleich zu beleuchten.
Es werden zudem mögliche Ursachen für das Auftreten von Gewalt an Schulen analysiert. Hier werden die Rolle des familiären Umfelds, die Auswirkungen der Schule und weitere Ursachen untersucht. Der Fokus liegt dabei auch auf der Betrachtung der Ursachen aus Sicht der Lehrer/innen und Schüler/innen.
Die Arbeit beleuchtet die an den Gewaltprozessen Beteiligten, einschließlich der Täter von Gewalt, der Opfer von Gewalt und der Täter-Opfer-Kette. Es wird eine Analyse und kritische Reflexion der Daten und Ergebnisse präsentiert, die die Komplexität des Gewaltphänomens an Schulen deutlich machen.
Im letzten Kapitel werden Ebenen und Bereiche präventiver Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen diskutiert. Es werden verschiedene Maßnahmen wie räumliche und bauliche Maßnahmen, die Etablierung von Regeln, die Prävention der Täter-Opfer-Problematik, die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern, binnendifferenzierter Unterricht und Sozialtraining vorgestellt.
Schlüsselwörter
Gewalt, Schule, Jugend, gesellschaftlicher Wertewandel, Lebenswelt, Jugendkriminalität, Prävention, Täter, Opfer, Täter-Opfer-Kette, Sozialtraining, Medien
Häufig gestellte Fragen
Nimmt die Gewalt an Schulen wirklich zu?
Die Arbeit analysiert Statistiken und Studien, um zu klären, ob die Gewalt tatsächlich steigt oder ob vor allem die mediale Aufmerksamkeit zugenommen hat.
Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche Wertewandel auf Gewalt?
Veränderte Lebenswelten, Individualisierung und der Verlust traditioneller Bindungen in Familie und Gesellschaft werden als mögliche Ursachen diskutiert.
Gibt es Unterschiede im Gewaltaufkommen je nach Schulform?
Ja, die Arbeit untersucht, warum an bestimmten Schulformen häufiger Gewalt gemeldet wird und welche schulbedingten Faktoren dies begünstigen.
Was sind effektive Maßnahmen zur Gewaltprävention?
Dazu gehören Sozialtraining, binnendifferenzierter Unterricht, klare Schulregeln sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern.
Welche Rolle spielen die Medien beim Gewaltverhalten?
Die Bedeutung medialer Vorbilder und die Darstellung von Gewalt in den Medien werden als verstärkende Faktoren für aggressives Verhalten bei Jugendlichen beleuchtet.
- Citation du texte
- Tobias Herfurth (Auteur), 2001, Gewalt - ein zunehmendes Phänomen im Rahmen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse? Darstellung und kritische Analyse des Gewaltphänomens in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4581