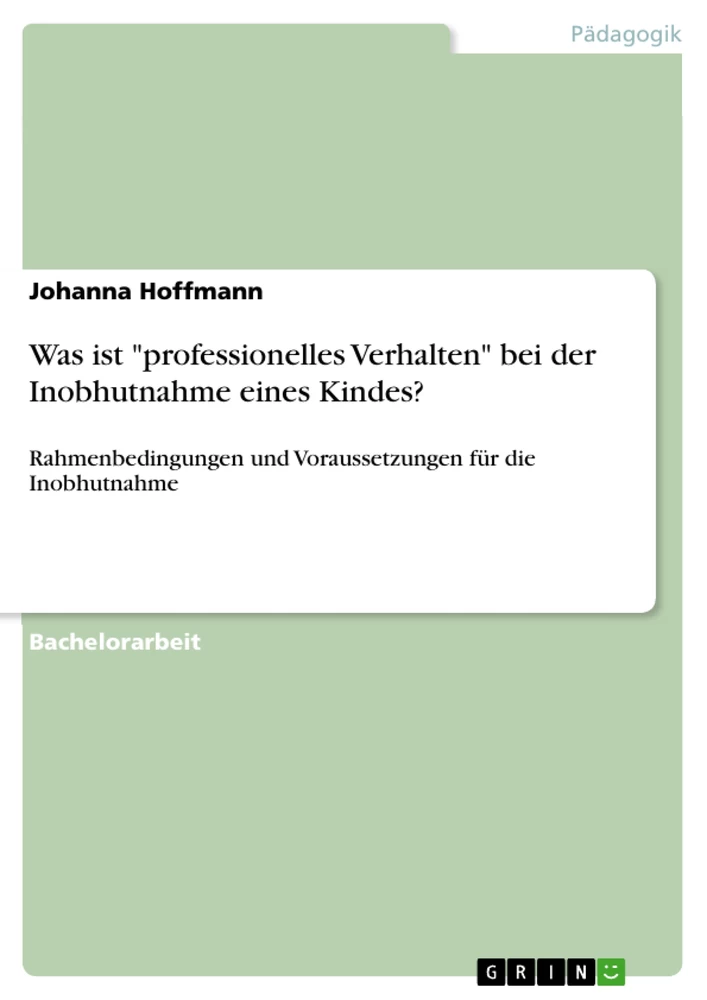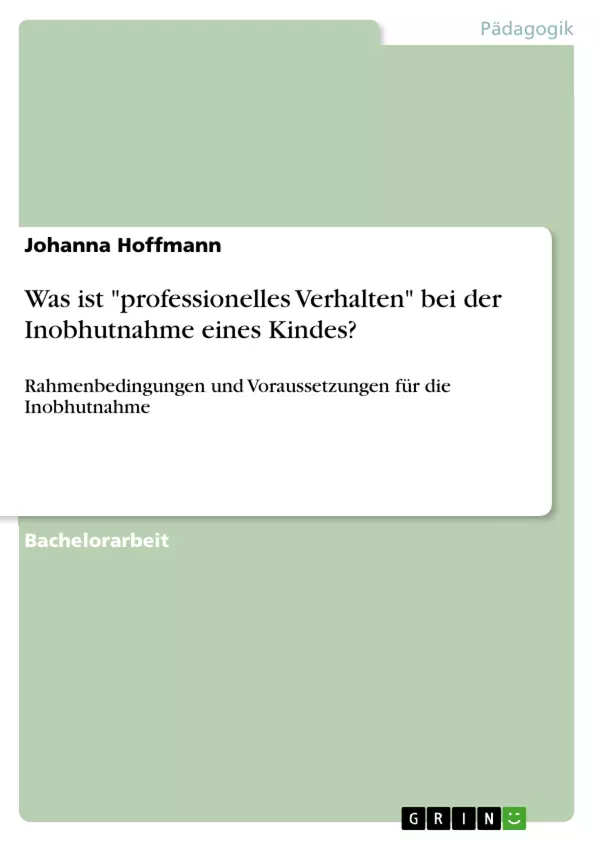Um Vorwürfe gegenüber den Mitarbeitern des Jugendamtes zu entgehen, versuchen Sozialarbeiter, sich bei einer Inobhutnahme professionell zu verhalten. Doch was wird unter dem Begriff „Professionelles Verhalten“ verstanden? Was macht ein „Professionelles Verhalten“ genau aus? Wann kann ein Sozialarbeiter von sich behaupten, dass er sich professionell verhalten hat? Dies sind die Hauptfragen dieser Arbeit.
In den letzten Jahren kam es immer wieder zu zahlreichen Diskussionen aufgrund verschiedenster Inobhutnahmen. Immer wieder wird hervorgetragen, dass zahlreiche Jugendämter ihrer Arbeit nicht ordnungsgemäß nachgehen würden. Den Mitarbeitern des Jugendamtes wird häufig vorgeworfen, Inobhutnahmen ohne rechtmäßigen Hintergrund durchzuführen. Aus diesem Grund, werden regelmäßig Sätze formuliert wie „das Jugendamt klaut Eltern ihre Kinder!“. Doch auch das Gegenteil ist der Fall und Mitarbeiter des Jugendamtes werden gefragt, warum sie das Kind nicht früher in Obhut genommen haben, da es doch offensichtlich war, dass das Kind in der Familie nicht bleiben konnte.
Den Sozialarbeitern wird also nicht selten vorgeworfen, dass sie nicht zum Wohle und Schutz des Kindes handeln, Fälle falsch deuten, Missstände übersehen und sie schuldig am Leiden der betroffenen Kinder sind. Für die Sozialarbeiter des Jugendamtes gilt grundsätzlich, liegt eine akute Kindeswohlgefährdung vor und die Eltern des Kindes oder des Jugendlichen sind nicht bereit oder in der Lage die Gefährdung abzuwenden, muss das Jugendamt tätig werden und das betroffene Kind bzw. den betroffenen Jugendlichen aus der Familie nehmen.
Doch was gilt in Deutschland als akute Kindeswohlgefährdung und ist es leicht zu differenzieren was genau unter eine akute Kindeswohlgefährdung fällt? Welche Formen von Kindeswohlgefährdungen gibt es? Wie häufig kommen sie in Deutschland vor? Welche Altersgruppen sind am häufigsten davon betroffen? Und letztlich welche Auswirkungen hat eine Kindeswohlgefährdung auf ein Kind sprich mit welchen Folgen hat es zu kämpfen? Für die meisten Menschen in Deutschland ist klar, liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, werden die Kinder die von der Kindeswohlgefährdung betroffen sind, vom Jugendamt aus der Familie geholt und fremduntergebracht. Dieses Verfahren wird unter dem Begriff Inobhutnahme verstanden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kindeswohlgefährdung
- 2.1. Definitionen
- 2.2. Erscheinungsformen
- 2.3. Vorkommenshäufigkeit
- 2.4. Folgen für die Kinder
- 3. Inobhutnahme
- 3.1. Definition
- 3.2. Der Allgemeine Soziale Dienst
- 3.3. Rechtlichen Rahmenbedingungen
- 3.3.1. Die Rechte der Eltern
- 3.3.2. Die Rechte des Kindes
- 3.3.3. Die Rechte des Jugendamtes
- 3.4. Arbeitsphasen einer Inobhutnahme
- 3.5. Kritik
- 4. Professionelles Verhalten
- 4.1. Definitionen
- 4.2. Einflussfaktoren
- 4.2.1. Personalbeschaffenheit des ASD
- 4.2.2. Arbeitsbelastung
- 4.3. Umgang mit den Paradoxien
- 4.3.1. Das doppelte Mandat
- 4.3.2. Nähe und Distanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem komplexen Thema der Kindeswohlgefährdung und der damit verbundenen Inobhutnahme durch Jugendämter. Der Fokus liegt auf der Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen, der verschiedenen Formen der Gefährdung, ihrer Folgen für Kinder sowie der Herausforderungen und Paradoxien, denen Sozialarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) im Umgang mit Kindeswohlgefährdungssituationen gegenüberstehen.
- Definition und Erscheinungsformen von Kindeswohlgefährdung
- Rechtliche Grundlagen und Abläufe der Inobhutnahme
- Rechte von Eltern, Kindern und Jugendämtern im Kontext der Inobhutnahme
- Professionelles Verhalten von Sozialarbeitern im ASD
- Einflussfaktoren und Paradoxien im professionellen Umgang mit Kindeswohlgefährdung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte um Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahme, wobei die Diskrepanz zwischen öffentlichen Vorwürfen und dem tatsächlichen Handlungsdruck für Sozialarbeiter im ASD hervorgehoben wird.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Konzept der Kindeswohlgefährdung. Es werden unterschiedliche Definitionen beleuchtet sowie verschiedene Formen von Kindeswohlgefährdung dargestellt. Außerdem wird auf die Häufigkeit des Phänomens in Deutschland sowie auf die Folgen für die betroffenen Kinder eingegangen.
Kapitel 3 widmet sich der Inobhutnahme. Hier werden die rechtlichen Grundlagen und die Aufgaben des Allgemeinen Sozialen Dienstes erläutert. Außerdem werden die Rechte von Eltern, Kindern und Jugendämtern im Kontext der Inobhutnahme dargestellt.
Kapitel 4 befasst sich mit dem professionellen Verhalten von Sozialarbeitern im ASD bei Inobhutnahmen. Die Kapitel analysieren die Definition von „Professionellem Verhalten" und untersuchen die Einflussfaktoren, die die professionelle Verhaltensweise beeinflussen können. Darüber hinaus werden die Herausforderungen und Paradoxien, denen Sozialarbeiter bei der Inobhutnahme gegenüberstehen, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kindeswohlgefährdung, Inobhutnahme, Jugendamt, Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), Rechtliche Rahmenbedingungen, Rechte von Eltern und Kindern, Professionelles Verhalten, Einflussfaktoren, Paradoxien, Doppeltes Mandat, Nähe und Distanz.
- Quote paper
- Johanna Hoffmann (Author), 2018, Was ist "professionelles Verhalten" bei der Inobhutnahme eines Kindes?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458202