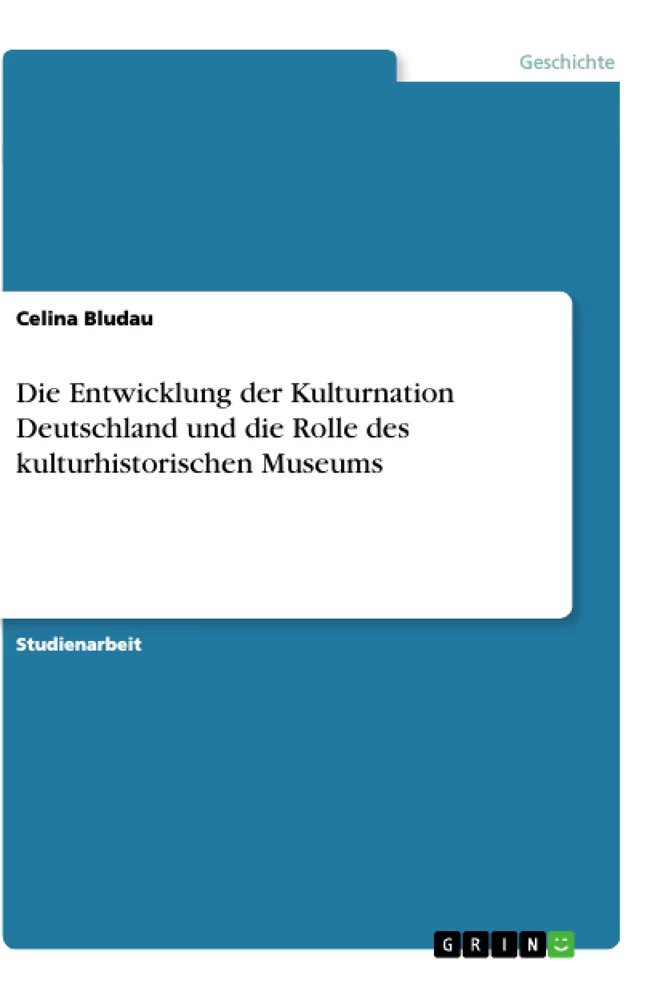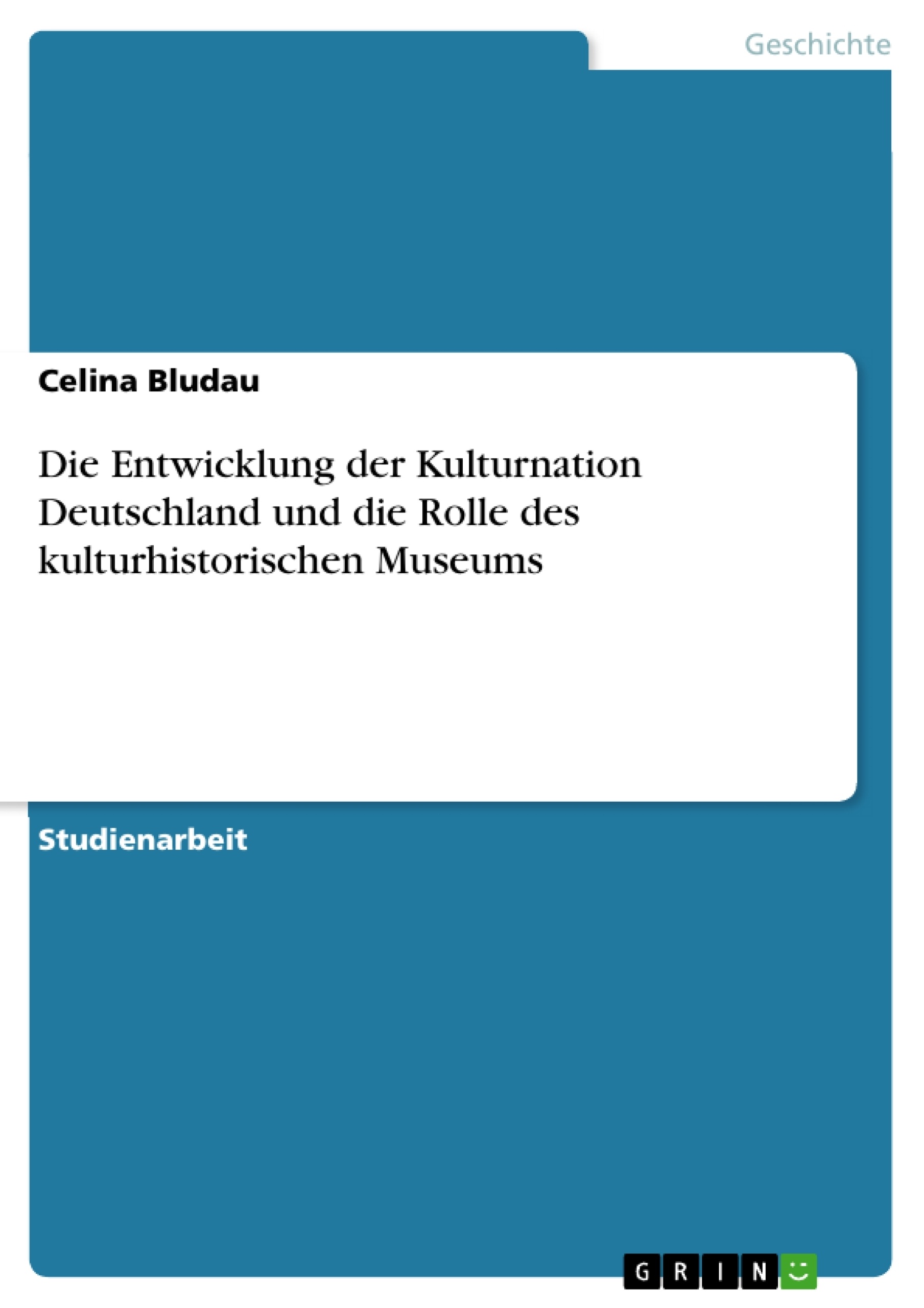Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung kulturhistorischer Museen innerhalb Deutschlands und ihrem historischen Kontext und untersucht, inwiefern das mit der Entfaltung eines speziell bürgerlichen Geschichtsbewusstseins einherging, das Deutschland zu einer Kulturnation werden ließ. Dazu wird der Begriff der "Kulturnation Deutschland" näher untersucht, um das Eigentümliche an der deutschen Nation zu verdeutlichen. Folgend wird die Geschichte kulturhistorischer Museen kontextualisiert, wobei der Fokus auf der Entwicklung und den dabei entstandenen Problemen liegt. Als Beispiel dafür wird das Germanische Nationalmuseum herangezogen. Abschließend wird eruiert, welche Aufgaben und Tätigkeitsbereiche kulturhistorische Museen haben und inwiefern sie heute von Bedeutung sein können.
Nachdem sich 1806 mit der Unterzeichnung des Rheinbundaktes 16 deutsche Staaten vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation lossagten, entsagte Franz II. dem Kaisertitel und das einst so mächtige Reich ging unter. Die deutsche Nation aber, die sich nicht durch geographische Grenzen oder eine einheitliche Politik definierte, entstand noch vor der historischen Entstehung des deutschen Nationalstaats. Die Kämpfe zwischen 1806-1813 gegen die französische Besatzung besiegelten das Band der Zusammengehörigkeit zwischen den einzelnen deutschen Staaten. Auf der Landkarte noch voneinander getrennt, verband die Deutschen etwas Anderes miteinander: Traditionen, die Sprache, Bräuche, und Erinnerungen – die Kultur. Während die deutsche Nation zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation die wohl größte räumliche Zersplitterung erlebte, erwachte das Goldene Zeitalter der deutschen Kultur innerhalb der Landesgrenzen. Schiller, Goethe, Kant und Beethoven sind dabei nur einige wenige Namen, die genannt werden müssen.
Der Begriff "Nation" war im deutschen Sprachraum ein entpolitisierter Begriff, durch den erst recht nicht vorgeschrieben wurde (oder werden konnte?), wie oder wodurch sich die Kultur zu entwickeln hatte. Und gerade durch diese Offenheit, die über die Landesgrenzen hinausging, nahm Deutschland viele Impressionen von außen auf und ließ sie in seine eigene Kultur miteinfließen. Die zentrale Lage auf dem europäischen Kontinent war dabei noch zusätzlich von Vorteil.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Deutschland, eine Kulturnation?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung kulturhistorischer Museen in Deutschland im historischen Kontext und deren Zusammenhang mit der Entwicklung eines bürgerlichen Geschichtsbewusstseins, das zur Bildung der Kulturnation Deutschland beitrug. Der Begriff „Kulturnation Deutschland“ wird analysiert, um die Besonderheiten der deutschen Nation zu verdeutlichen. Die Geschichte kulturhistorischer Museen wird unter Berücksichtigung der Herausforderungen ihrer Entwicklung beleuchtet, wobei das Germanische Nationalmuseum als Beispiel dient. Abschließend werden die Aufgaben und die heutige Bedeutung kulturhistorischer Museen erörtert.
- Die Entwicklung des Begriffs „Kulturnation Deutschland“
- Der Einfluss des bürgerlichen Geschichtsbewusstseins auf die Entstehung kulturhistorischer Museen
- Die Rolle kulturhistorischer Museen in der nationalen Identität Deutschlands
- Herausforderungen in der Entwicklung kulturhistorischer Museen
- Die Bedeutung kulturhistorischer Museen in der Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den komplexen Begriff „Nation“, ausgehend von Ernest Renans Definition als „geistiges Prinzip“ aus gemeinsamer Geschichte und kollektivem Gedächtnis. Sie zeigt die Entstehung der deutschen Nation als kulturelle Einheit vor dem Nationalstaat, geprägt von einem weltoffenen kulturellen Austausch, der im 20. Jahrhundert in eine nationalistische Ideologie umschlug. Die Arbeit fokussiert auf die Entstehung kulturhistorischer Museen in Deutschland und deren Verbindung zum bürgerlichen Geschichtsbewusstsein, am Beispiel des Germanischen Nationalmuseums.
2. Hauptteil, 2.1 Deutschland, eine Kulturnation?: Dieser Abschnitt untersucht die Frage, ob Deutschland eine Kulturnation ist, ausgehend von den Ereignissen um die Französische Revolution und deren Einfluss auf das deutsche Selbstverständnis. Goethe und Schillers Werke werden herangezogen, um die ambivalente Haltung gegenüber der Idee einer politischen Nation zu beleuchten. Die Rolle des Rheinbunds, die Befreiungskriege, der Wiener Kongress und die Restaurationszeit werden analysiert, um die Entwicklung des deutschen Nationalbewusstseins zu kontextualisieren. Das Hambacher Fest von 1832 wird als Höhepunkt bürgerlicher Opposition und Ausdruck nationaler Identität dargestellt, ebenso wie die Revolutionen von 1848. Die Kapitel unterstreichen den komplexen und oft widersprüchlichen Prozess der deutschen Nationenbildung und das Ringen um nationale Identität im Kontext europäischer Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Kulturnation Deutschland, kulturhistorische Museen, bürgerliches Geschichtsbewusstsein, nationale Identität, Germanisches Nationalmuseum, Französische Revolution, Befreiungskriege, Hambacher Fest, 1848er Revolution, nationale Einheit, europäische Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entstehung kulturhistorischer Museen in Deutschland
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entstehung kulturhistorischer Museen in Deutschland im historischen Kontext und deren Zusammenhang mit der Entwicklung eines bürgerlichen Geschichtsbewusstseins, das zur Bildung der „Kulturnation Deutschland“ beitrug. Der Fokus liegt auf der Analyse des Begriffs „Kulturnation“, der Herausforderungen bei der Entwicklung solcher Museen und ihrer heutigen Bedeutung.
Welche Aspekte des Begriffs „Kulturnation Deutschland“ werden behandelt?
Die Arbeit analysiert den Begriff „Kulturnation Deutschland“ kritisch, beleuchtet dessen Entstehung und Entwicklung, und untersucht dessen Ambivalenz. Sie betrachtet die Besonderheiten der deutschen Nation im Vergleich zu anderen europäischen Nationen und verdeutlicht die komplexen und oft widersprüchlichen Prozesse der deutschen Nationenbildung.
Welche Rolle spielt das bürgerliche Geschichtsbewusstsein?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des bürgerlichen Geschichtsbewusstseins auf die Entstehung kulturhistorischer Museen. Es wird gezeigt, wie das Streben nach nationaler Identität die Gründung und Entwicklung dieser Museen prägte und wie diese Museen wiederum zur Formierung der nationalen Identität beitrugen.
Welches Museum dient als Beispiel?
Das Germanische Nationalmuseum wird als Fallbeispiel herangezogen, um die Entwicklung und Herausforderungen kulturhistorischer Museen in Deutschland zu veranschaulichen.
Welche historischen Ereignisse werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene historische Ereignisse, darunter die Französische Revolution und deren Einfluss auf das deutsche Selbstverständnis, die Befreiungskriege, den Wiener Kongress, die Restaurationszeit, das Hambacher Fest von 1832 und die Revolutionen von 1848. Diese Ereignisse werden im Kontext der Entwicklung des deutschen Nationalbewusstseins analysiert.
Welche Werke werden erwähnt?
Die Werke Goethes und Schillers werden herangezogen, um die ambivalente Haltung gegenüber der Idee einer politischen Nation im Kontext der deutschen Nationenbildung zu beleuchten.
Welche Kapitel sind enthalten und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, die den komplexen Begriff „Nation“ erläutert und den Fokus auf die Entstehung kulturhistorischer Museen in Deutschland und deren Verbindung zum bürgerlichen Geschichtsbewusstsein setzt. Der Hauptteil analysiert, ob Deutschland eine Kulturnation ist, unter Berücksichtigung der genannten historischen Ereignisse und der Rolle des Germanischen Nationalmuseums.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kulturnation Deutschland, kulturhistorische Museen, bürgerliches Geschichtsbewusstsein, nationale Identität, Germanisches Nationalmuseum, Französische Revolution, Befreiungskriege, Hambacher Fest, 1848er Revolution, nationale Einheit, europäische Integration.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung kulturhistorischer Museen in Deutschland im historischen Kontext zu untersuchen und deren Zusammenhang mit der Entwicklung eines bürgerlichen Geschichtsbewusstseins und der Bildung der „Kulturnation Deutschland“ zu analysieren. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Entwicklung dieser Museen und erörtert deren heutige Bedeutung.
- Citar trabajo
- Celina Bludau (Autor), 2019, Die Entwicklung der Kulturnation Deutschland und die Rolle des kulturhistorischen Museums, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458235