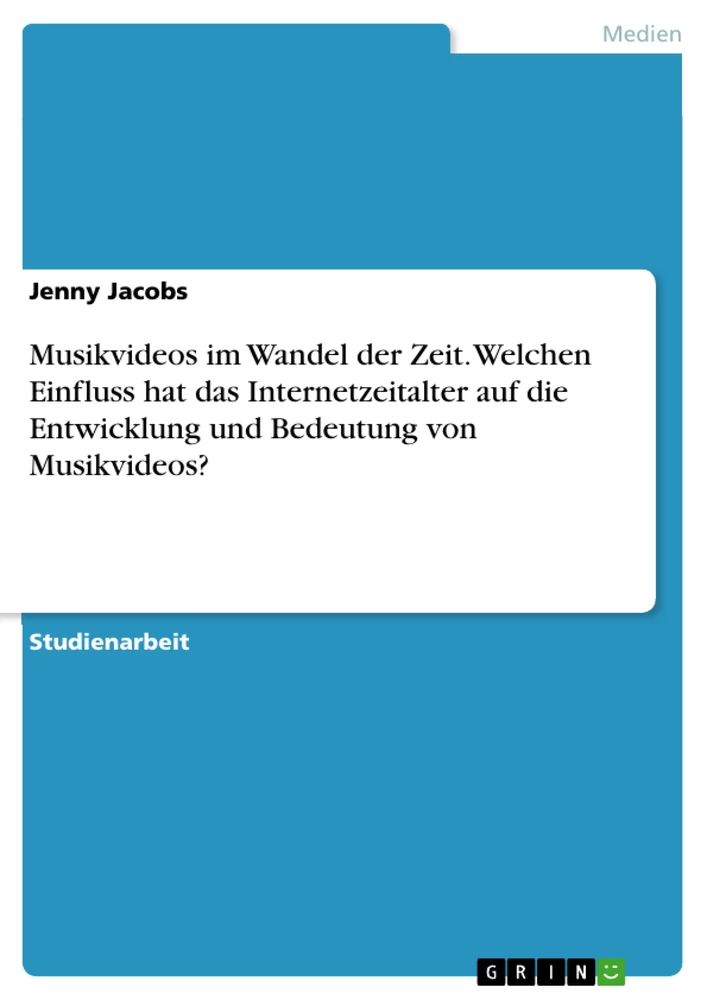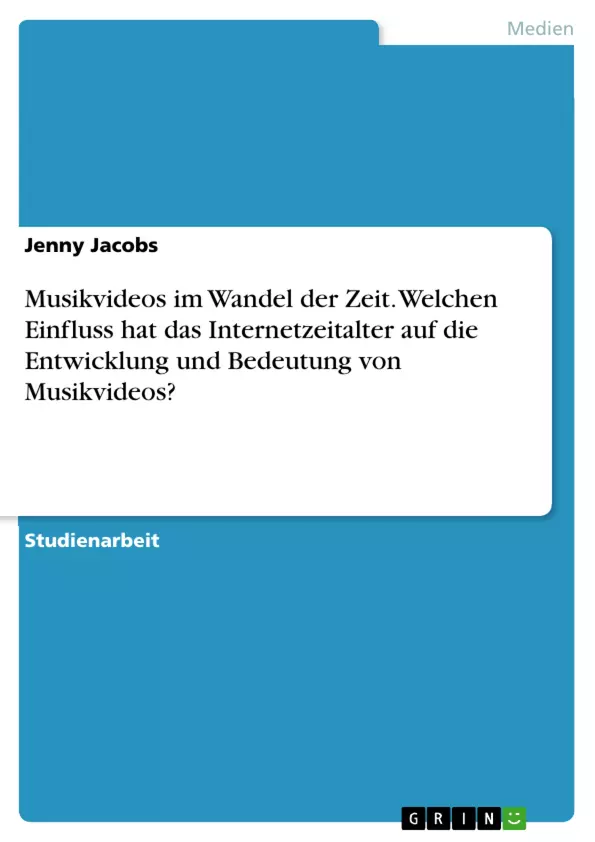Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich Musikvideos noch an enormer Beliebtheit erfreuten und einen boomenden Markt hervorbrachten. Im sogenannten MTV-Zeitalter entdeckte man in Musikvideos großes Potenzial. Doch das Einsetzen des Internetzeitalters löste das MTV-Zeitalter völlig unerwartet ab. Videoplattformen im World Wide Web wie zum Beispiel „YouTube“ oder „MyVideo“ stellen eine gänzlich neue Konkurrenz für MTV und VIVA dar, der die Sender nicht mehr gewachsen sind. Doch was bedeutet diese Entwicklung für das Phänomen Musikvideo? Behalten die Experten recht und das Musikvideo stirbt nun genauso schnell aus wie es auferstanden ist? Oder bleibt es weiterhin ein bedeutender Teil der Musikindustrie, nur dass es eben auf andere Plattformen ausweicht?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Medium Musikvideo
- 2.1. Definition von Musikvideos
- 2.2. Die Anfänge von Musikvideos
- 3. Musikvideos im "MTV-Zeitalter"
- 3.1. Die Anfänge der Musikfernsehsender MTV und VIVA
- 3.2. Darstellungsweisen und Funktion von Musikvideos im „MTV-Zeitalter“
- 4. Musikvideos im heutigen Internetzeitalter
- 4.1. Die Ablösung des Musikfernsehens durch das Internet
- 4.2. Darstellungsweisen und Funktion von Musikvideos im Internetzeitalter
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung und Bedeutung von Musikvideos im Wandel der Zeit, insbesondere mit dem Einfluss des Internetzeitalters auf dieses Phänomen. Die Arbeit analysiert die Anfänge von Musikvideos, beleuchtet das sogenannte MTV-Zeitalter und untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Produktion und Rezeption von Musikvideos im 21. Jahrhundert.
- Definition und Entwicklung des Musikvideos
- Die Rolle von Musikfernsehsendern wie MTV und VIVA
- Der Einfluss des Internets auf die Verbreitung und Gestaltung von Musikvideos
- Die ästhetischen Möglichkeiten und Herausforderungen in verschiedenen Zeitaltern
- Die Bedeutung von Musikvideos für die Musikindustrie und die Rezeption von Musik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit bietet eine Einleitung in das Thema und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss des Internetzeitalters auf Musikvideos. Das zweite Kapitel definiert den Begriff "Musikvideo" und beleuchtet dessen Anfänge, beginnend mit den "Song Slides" des 19. Jahrhunderts bis hin zu den "Soundies" und "Scopitones" des 20. Jahrhunderts. Kapitel drei konzentriert sich auf das sogenannte "MTV-Zeitalter", analysiert die Entstehung der Musikfernsehsender MTV und VIVA sowie die Darstellungsweisen und Bedeutung von Musikvideos in dieser Zeit. Kapitel vier widmet sich dem Internetzeitalter und erörtert die Ablösung des Musikfernsehens durch das Internet, die sich daraus ergebenden neuen Möglichkeiten und Herausforderungen für die Gestaltung von Musikvideos sowie deren Rezeption im digitalen Raum.
Schlüsselwörter
Musikvideo, MTV, VIVA, Internet, Digitalisierung, Videoplattformen, YouTube, MyVideo, ästhetische Möglichkeiten, Rezeption, Musikindustrie, Promotion, kommerzieller Erfolg, Musikfernsehen, visuelle Gestaltung, Soundies, Song Slides, Scopitones, Entwicklung, Bedeutung, Einfluss.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat das Internet die Bedeutung von Musikvideos verändert?
Das Internetzeitalter hat das klassische Musikfernsehen (MTV/VIVA) abgelöst. Plattformen wie YouTube bieten neue Verbreitungswege, verändern aber auch die Rezeption und die kommerziellen Strategien der Musikindustrie.
Was war das Besondere am „MTV-Zeitalter“?
In dieser Ära waren Musikvideos das zentrale Marketinginstrument. Sender wie MTV und VIVA dominierten den Markt und prägten die visuelle Ästhetik der Popkultur.
Welche frühen Vorläufer des Musikvideos gab es?
Die Anfänge reichen zurück zu den „Song Slides“ des 19. Jahrhunderts sowie den „Soundies“ und „Scopitones“ des 20. Jahrhunderts.
Stirbt das Musikvideo durch das Internet aus?
Nein, es stirbt nicht aus, sondern weicht auf neue Plattformen aus. Es bleibt ein bedeutender Teil der Musikindustrie, passt sich jedoch den digitalen Sehgewohnheiten an.
Welche Funktionen erfüllen Musikvideos heute?
Sie dienen weiterhin der Promotion und dem kommerziellen Erfolg, bieten aber durch das Internet auch interaktive und experimentelle ästhetische Möglichkeiten.
- Quote paper
- Jenny Jacobs (Author), 2016, Musikvideos im Wandel der Zeit. Welchen Einfluss hat das Internetzeitalter auf die Entwicklung und Bedeutung von Musikvideos?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458640