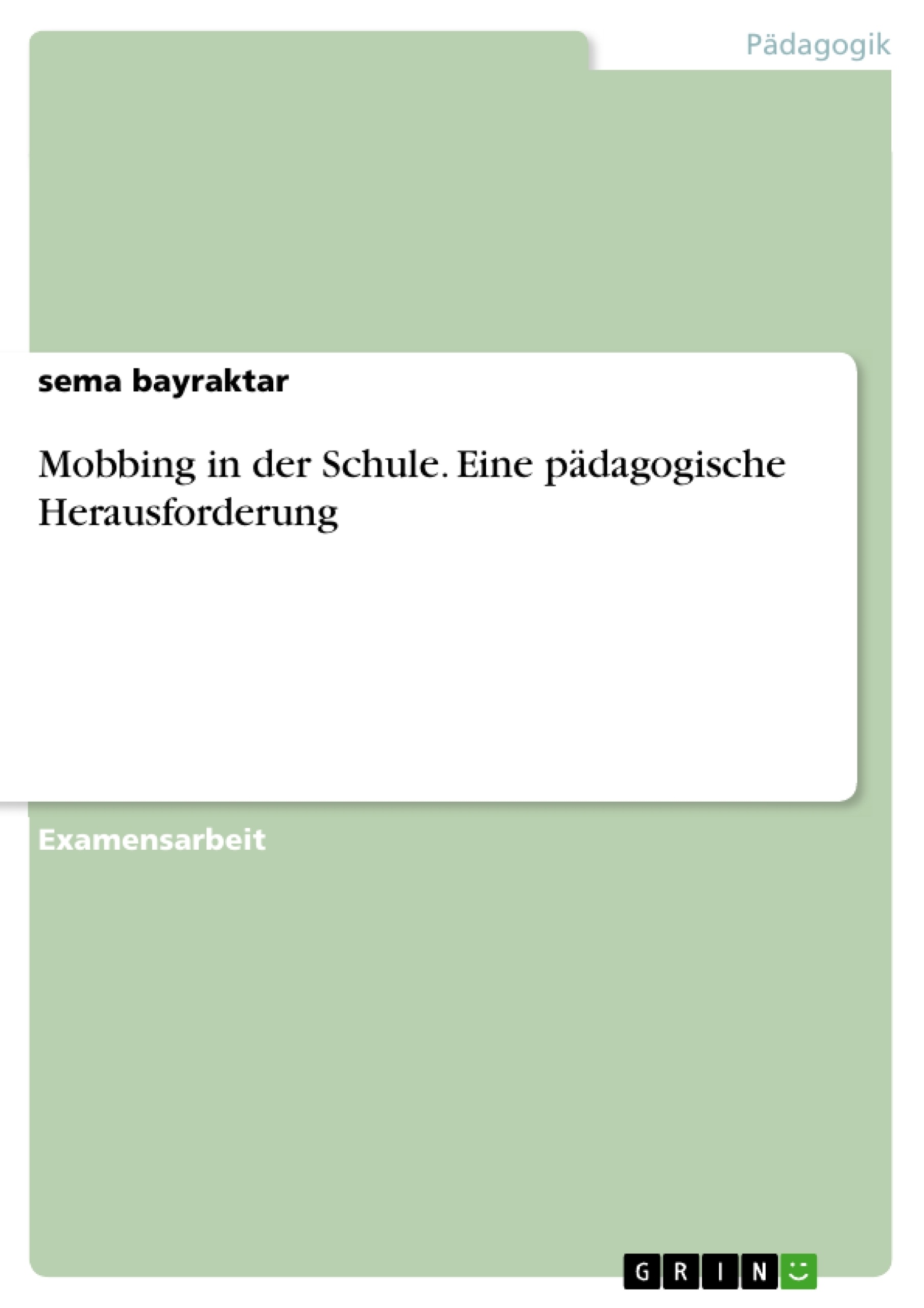Diese wissenschaftliche Hausarbeit im Rahmen des ersten Staatsexamens wird sich mit dem Thema „Mobbing in der Schule: Eine pädagogische Herausforderung“ beschäftigen. Dabei wird versucht, das Thema aus den wichtigsten Blickwinkeln zu betrachten.
Mobbing ist ein sehr komplexes Thema, daher kann eine Vollständigkeit der Behandlung nicht garantiert werden. Im Verlauf der Arbeit wird zuerst geklärt, was schulische Gewalt ist. Danach wird Mobbing, das eine Form von Gewalt darstellt, mit einer Definition, seinem Ursprung und allen wichtigen Faktoren vorgestellt. Darauf folgen die verschiedenen Erscheinungsformen von Mobbing. Als Nächstes werden die signifikanten Merkmale von Tätern und Opfern näher beleuchtet. Daraufhin geht es um die Ursachen von Mobbing. Diese gliedern sich in außerschulische und schulische Auslöser, die zu erklären versucht werden. Dann werden die verschiedenen Folgen von Mobbing aus der Sicht der Opfer und der Mobber vorgestellt. Weiterhin beschäftigt sich die Ausarbeitung mit den Interventions- und Präventionsmaßnahmen. Dazu werden einige Konzepte näher dargestellt. Ein Fazit schließt die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gewalt in Schulen
- 2.1. Mobbing - eine Form der Gewalt
- 3. Mobbing
- 3.1. Definition
- 3.2. Erscheinungsformen von Mobbing
- 3.2.1. Mobbing durch körperliche Gewalt
- 3.2.2. Verbales Mobbing
- 3.2.3. Stummes Mobbing
- 3.2.4. Cyber-Mobbing
- 3.3. Erscheinungsformen von Mobbing in Bezug zu verschiedenen Faktoren
- 4. Charakteristika von Opfer und Täter
- 4.1. Das Opfer
- 4.1.1. Passive Opfer
- 4.1.2. Provozierende/aggressive Opfer
- 4.2. Der Täter
- 5. Ursachen von Mobbing
- 5.1. Schulische Faktoren
- 5.1.1. Die Rolle der Schule und des Schulklimas
- 5.1.2. Die Rolle des Lernklimas
- 5.1.3. Die Rolle der Lehrer
- 5.1.4. Die Rolle der Mitschüler
- 5.2. Außerschulische Faktoren
- 5.2.1. Die Rolle der Familie und der Erziehung
- 5.2.2. Die Rolle der Peergroup
- 5.2.3. Die Rolle der Medien
- 6. Verlauf von Mobbing
- 7. Folgen von Mobbing
- 7.1. Folgen für das Opfer
- 7.1.1. Gesundheitliche und psychische Folgen
- 7.1.2. Soziale Folgen
- 7.2. Folgen von Cyber-Mobbing
- 7.3. Folgen für den Täter
- 8. Prävention und Intervention
- 8.1. Grundlagen
- 8.2. Handlungsebenen
- 8.2.1. Maßnahmen auf Schulebene
- 8.2.2. Maßnahmen auf Klassenebene
- 8.2.3. Maßnahmen auf persönlicher Ebene
- 9. Anti-Mobbing-Konzepte
- 9.1. Anti-Bullying-Konzept nach Olweus
- 9.2. No-Blame-Approach-Konzept
- 9.3. Die Farsta-Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht das Phänomen des Mobbings an Schulen und dessen pädagogische Herausforderungen. Ziel ist es, Mobbing umfassend zu beleuchten, von seinen Definitionen und Erscheinungsformen über die Charakteristika von Tätern und Opfern bis hin zu Ursachen, Folgen und möglichen Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Die Arbeit strebt eine ganzheitliche Betrachtung an, die sowohl schulische als auch außerschulische Faktoren berücksichtigt.
- Definition und Erscheinungsformen von Mobbing
- Charakteristika von Opfern und Tätern
- Ursachen von Mobbing (schulische und außerschulische Faktoren)
- Folgen von Mobbing für Opfer und Täter
- Prävention und Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Mobbing an Schulen ein und unterstreicht dessen Aktualität und Bedeutung für die pädagogische Praxis. Sie hebt die Notwendigkeit von weiterführender Bildung für Lehrkräfte im Umgang mit diesem komplexen Problem hervor, insbesondere im Bereich des Cyber-Mobbing.
2. Gewalt in Schulen: Dieses Kapitel etabliert den Kontext von Mobbing als eine spezielle Form von Gewalt in Schulen. Es verortet Mobbing innerhalb des breiteren Spektrums schulischer Gewaltphänomene und bereitet den Boden für eine detailliertere Betrachtung in den folgenden Kapiteln.
3. Mobbing: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Phänomen Mobbing. Es definiert Mobbing, beschreibt seine verschiedenen Erscheinungsformen (körperlich, verbal, stumm, Cyber-Mobbing) und analysiert diese im Kontext verschiedener Faktoren. Der Schwerpunkt liegt auf einer differenzierten Darstellung der Vielschichtigkeit von Mobbing.
4. Charakteristika von Opfer und Täter: Dieses Kapitel beleuchtet die Merkmale von Opfern und Tätern von Mobbing. Es unterscheidet zwischen passiven und provokativen Opfern und analysiert die Eigenschaften und Verhaltensweisen von Tätern. Der Fokus liegt auf einem differenzierten Verständnis der beteiligten Personen.
5. Ursachen von Mobbing: Hier werden die Ursachen von Mobbing aus schulischen und außerschulischen Perspektiven untersucht. Die Rolle der Schule, des Schulklimas, der Lehrer, der Mitschüler, der Familie, der Peergroup und der Medien werden analysiert und in ihrem Einfluss auf das Entstehen von Mobbing bewertet. Die Komplexität der Ursachen wird hervorgehoben.
6. Verlauf von Mobbing: Dieses Kapitel analysiert den zeitlichen Verlauf von Mobbingprozessen, die Eskalation und die Dynamiken innerhalb der Interaktionen zwischen Opfer und Täter. Es befasst sich mit der Entwicklung und dem Fortbestehen von Mobbinghandlungen über die Zeit.
7. Folgen von Mobbing: Die Folgen von Mobbing für Opfer und Täter werden ausführlich behandelt. Die Arbeit beleuchtet die gesundheitlichen, psychischen und sozialen Auswirkungen auf Opfer, die spezifischen Folgen von Cyber-Mobbing und die Auswirkungen auf die Täter. Der Fokus liegt auf der Tragweite und den langfristigen Konsequenzen des Mobbings.
8. Prävention und Intervention: Dieses Kapitel befasst sich mit Maßnahmen der Prävention und Intervention. Es beschreibt grundlegende Ansätze und Handlungsebenen (Schule, Klasse, persönliche Ebene) und erläutert konkrete Strategien und Interventionsprogramme zur Bekämpfung von Mobbing.
9. Anti-Mobbing-Konzepte: Hier werden verschiedene Anti-Mobbing-Konzepte wie das Olweus-Konzept, der No-Blame-Approach und die Farsta-Methode vorgestellt und im Detail erläutert. Der Vergleich und die Bewertung verschiedener Ansätze stehen im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Mobbing, Schule, Gewalt, Opfer, Täter, Prävention, Intervention, Cyber-Mobbing, Schulische Faktoren, Außerschulische Faktoren, Pädagogik, Konzepte, Anti-Bullying.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Mobbing an Schulen
Was ist der Inhalt dieser wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht umfassend das Phänomen des Mobbings an Schulen. Sie behandelt Definitionen und Erscheinungsformen von Mobbing, die Charakteristika von Tätern und Opfern, Ursachen (schulische und außerschulische Faktoren), Folgen für Opfer und Täter sowie Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Besonderes Augenmerk liegt auf einer ganzheitlichen Betrachtung und der Berücksichtigung von Cyber-Mobbing.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Erscheinungsformen von Mobbing (inkl. Cyber-Mobbing), Charakteristika von Opfern (passive und aggressive Opfer) und Tätern, Ursachen von Mobbing (schulische Faktoren wie Schulklima, Lehrerrolle, Mitschüler; außerschulische Faktoren wie Familie, Peergroup, Medien), Verlauf von Mobbingprozessen, Folgen von Mobbing für Opfer (gesundheitliche, psychische, soziale Folgen) und Täter, Prävention und Intervention (Maßnahmen auf Schul-, Klassen- und persönlicher Ebene) sowie verschiedene Anti-Mobbing-Konzepte (Olweus, No-Blame-Approach, Farsta-Methode).
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in neun Kapitel gegliedert: Einleitung, Gewalt in Schulen, Mobbing (Definition, Erscheinungsformen), Charakteristika von Opfer und Täter, Ursachen von Mobbing, Verlauf von Mobbing, Folgen von Mobbing, Prävention und Intervention, und Anti-Mobbing-Konzepte. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema.
Welche Arten von Mobbing werden beschrieben?
Die Hausarbeit beschreibt verschiedene Erscheinungsformen von Mobbing: körperliche Gewalt, verbales Mobbing, stummes Mobbing und Cyber-Mobbing. Die unterschiedlichen Ausprägungen und ihr Kontext werden analysiert.
Welche Faktoren werden als Ursachen für Mobbing genannt?
Die Arbeit untersucht sowohl schulische als auch außerschulische Faktoren. Schulische Faktoren umfassen das Schulklima, die Rolle der Lehrer und Mitschüler, das Lernklima. Zu den außerschulischen Faktoren gehören die Familie und Erziehung, die Peergroup und der Einfluss der Medien.
Welche Folgen von Mobbing werden betrachtet?
Die Folgen von Mobbing werden sowohl für Opfer als auch für Täter untersucht. Für Opfer werden gesundheitliche, psychische und soziale Folgen beleuchtet. Die spezifischen Folgen von Cyber-Mobbing werden separat betrachtet. Die Auswirkungen auf die Täter werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Präventions- und Interventionsmaßnahmen werden vorgestellt?
Die Hausarbeit beschreibt grundlegende Ansätze zur Prävention und Intervention auf verschiedenen Ebenen: Schule, Klasse und persönlicher Ebene. Konkrete Strategien und Interventionsprogramme werden erläutert.
Welche Anti-Mobbing-Konzepte werden vorgestellt und verglichen?
Die Arbeit stellt verschiedene Anti-Mobbing-Konzepte vor und vergleicht diese: das Olweus-Konzept, den No-Blame-Approach und die Farsta-Methode. Die jeweiligen Ansätze werden detailliert erläutert und bewertet.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Lehrer, Erzieher, Schüler, Eltern und alle, die sich mit dem Thema Mobbing an Schulen auseinandersetzen. Sie bietet ein umfassendes Verständnis des Phänomens und hilfreiche Informationen zu Prävention und Intervention.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mobbing, Schule, Gewalt, Opfer, Täter, Prävention, Intervention, Cyber-Mobbing, Schulische Faktoren, Außerschulische Faktoren, Pädagogik, Konzepte, Anti-Bullying.
- Arbeit zitieren
- sema bayraktar (Autor:in), 2014, Mobbing in der Schule. Eine pädagogische Herausforderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458754