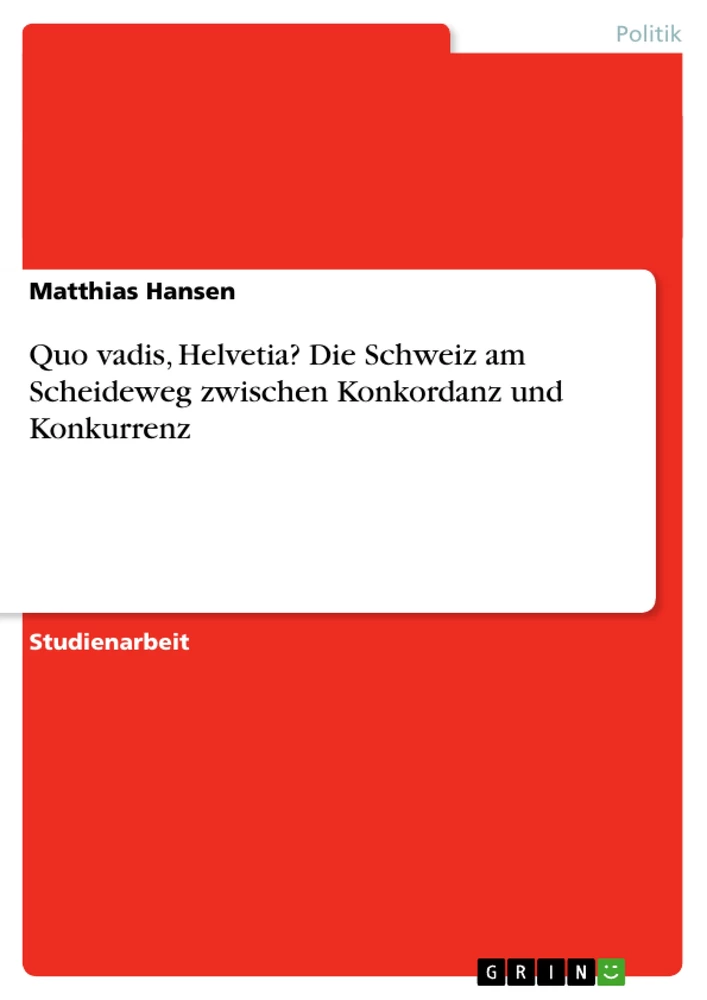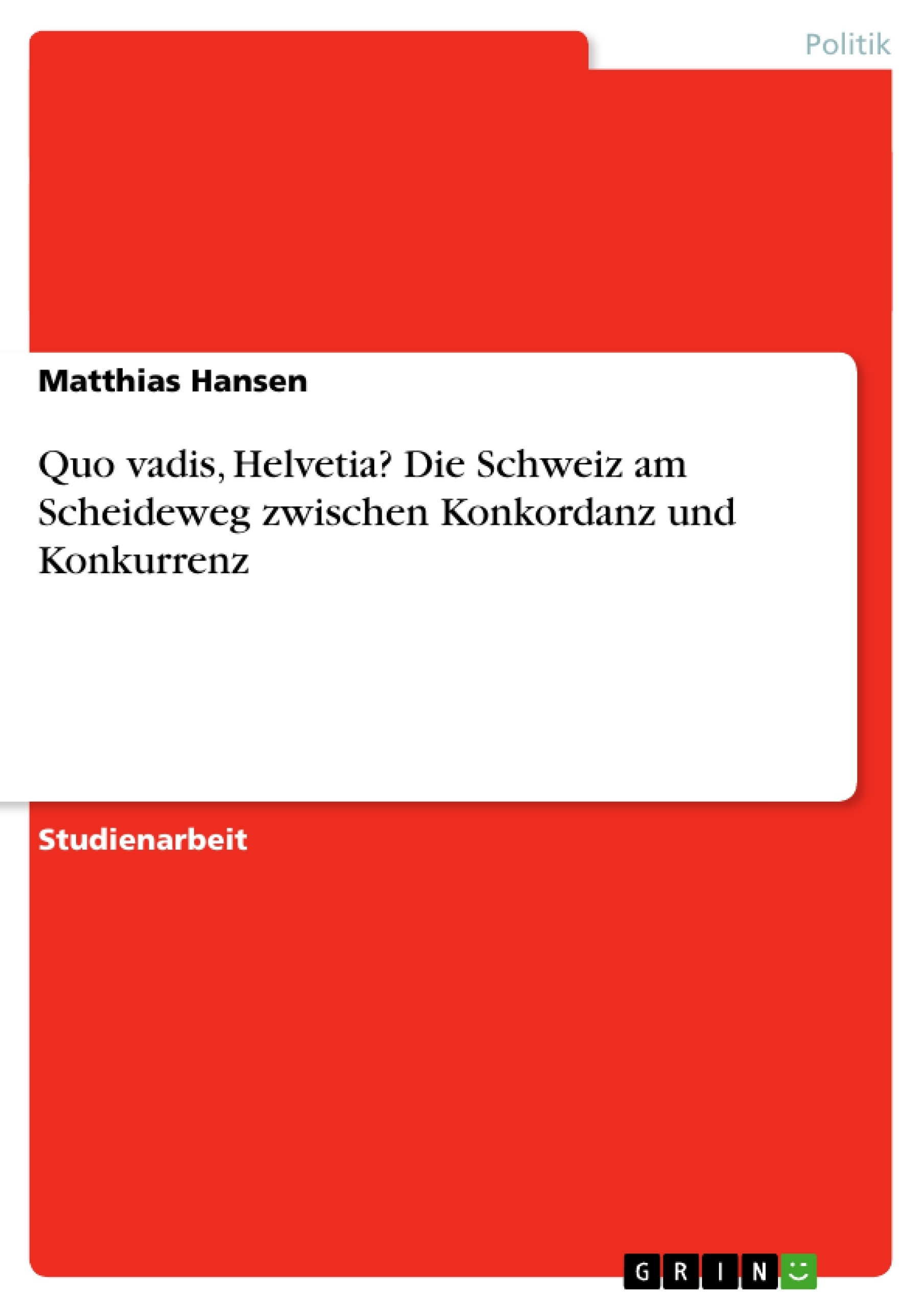Die deutsche Öffentlichkeit erlebt den politischen Alltag in der Bundesrepublik nicht selten als eine Agglomeration unpopulärer Entscheidungen und haarspalterischer Parteifehden. Scheinbar regelmäßig opfern die konkurrierenden Parteien in ihren Positionsbezügen das für das Gemeinwohl langfristig Sinnvolle dem kurzfristig Nützlichen: nämlich dem raschen Wahlerfolg. Schuldig für diese Misere werden zunehmend die Legitimations- und Steuerungsdefizite unseres repräsentativen Systems gesprochen. Forderungen nach einem Ausbau plebiszitärer Elemente werden laut. Dabei mag der eine oder andere neidvoll auf unseren südlichen Nachbarn blicken: Die Schweiz ist traditionell eine halbdirekte Konkordanzdemokratie. Die direktdemokratischen Elemente sind dort ebenso fester Bestandteil des politischen Lebens wie die Proporzpolitik. Meist entbehrt solch ein ekstatischer Blick auf das eidgenössische Konsensprinzip einer weitergehenden Analyse der Bedingtheiten des politischen Systems der Schweiz. Schließlich lässt sich das von uns nicht selten als exotisch verklärte schweizerische „Aushandlungsverfahren“ auf politisch-institutionelle wie auch kulturell-historische Spezifika zurückführen, wie sie in Deutschland jeher nicht gegeben und auch nicht realisierbar sind. Um dieser Eindimensionalität vorzubeugen sowie als elementares Fundament für die folgenden Untersuchungen sollen im zweiten Kapitel zunächst die schweizerischen Besonderheiten im Überblick und ohne Anspruch auf Vollständigkeit illustriert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schweizer Eigenart: verfassungsmäßige Besonderheiten und deren Folgen
- Parlamentswahlen und Gesamterneuerung des Bundesrates 2003
- Die Ergebnisse der Nationalratswahlen vom 19. Oktober 2003
- Die Neukonstituierung des Bundesrates nach einer neuen Zauberformel
- Uno anno post: Eine Zwischenbilanz zu Blochers Arbeit im Bundesrat
- Blocher - nur einer unter sieben Exekutivräten?
- Blocher der „,halboppositionelle Regierungsrat”
- Der Bundesrat am Ende? - Zur Befangenheit des Regierungsorgans
- Das Konkordanzsystem: Ein Auslaufmodell?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie lange das schweizerische Konkordanzsystem angesichts tiefgreifender Veränderungen, wie der Modifizierung der Zauberformel 2003, der abnehmenden Wählerbindungen und der neuen Möglichkeiten der Politikprofilierung durch moderne Massenmedien, zeitgemäß und realisierbar ist. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des Bundesrates, insbesondere der Arbeit von Christoph Blocher im ersten Jahr seiner Amtszeit, um die Auswirkungen auf das Konkordanzprinzip und das Kollegialitätsprinzip zu beleuchten.
- Entwicklung des schweizerischen Konkordanzsystems
- Einfluss von Christoph Blochers Wirken auf das Konkordanzsystem
- Die Rolle des Bundesrates in der Schweizer Politik
- Herausforderungen und Chancen für das Konkordanzsystem
- Relevanz von Reformansätzen für das schweizerische politische System
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des schweizerischen Konkordanzsystems im Kontext der aktuellen politischen Veränderungen dar und benennt die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Die Schweiz als halbdirekte Konkordanzdemokratie wird im Vergleich zum deutschen politischen System beleuchtet, wobei die Besonderheiten des schweizerischen „Aushandlungsverfahrens“ hervorgehoben werden.
- Die Schweizer Eigenart: Dieses Kapitel beleuchtet die verfassungsmäßigen Besonderheiten des schweizerischen Konkordanzsystems und deren Folgen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem ausgeprägten Föderalismus und dessen Einfluss auf die Struktur der Parteien und die Entscheidungsfindungsprozesse. Die „typisch schweizerische“ Lösung, Aufgaben zu delegieren statt den Staatsapparat auszubauen, wird im Vergleich zu Deutschland dargestellt.
- Parlamentswahlen und Gesamterneuerung des Bundesrates 2003: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse der Nationalratswahlen 2003 und die Neukonstituierung des Bundesrates unter Variation der „Zauberformel“. Es werden die Auswirkungen dieser Zäsur auf die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die Arbeitsweise des Exekutivorgans beleuchtet.
- Uno anno post: Eine Zwischenbilanz zu Blochers Arbeit im Bundesrat: Dieses Kapitel bilanziert das Wirken und Schaffen von Christoph Blocher im ersten Jahr als Bundesrat. Es analysiert seine inhaltlichen Schwerpunkte, seine Einordnung in die kollegialen Gepflogenheiten der Regierung und die Auswirkungen seiner Arbeit auf die Befangenheit des Regierungsorgans.
- Das Konkordanzsystem: Ein Auslaufmodell?: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen für das Konkordanzsystem in der Schweiz und der Frage, ob es ein Auslaufmodell ist. Die hohe Zahl der im Jahr 2004 vom Volk verworfenen behördlichen Abstimmungsvorlagen wird als Indiz für die Belastungen des Systems interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem schweizerischen Konkordanzsystem, dem Bundesrat, der Zauberformel, den Nationalratswahlen 2003, Christoph Blocher, dem Kollegialitätsprinzip, der Befangenheit des Regierungsorgans, dem Föderalismus, der direktdemokratischen Elemente und den Herausforderungen für die Stabilität des schweizerischen politischen Systems. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der veränderten Machtverhältnisse auf die Arbeitsweise des Bundesrates und die Zukunft des Konkordanzsystems.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das schweizerische Konkordanzsystem?
Es ist ein politisches System, das auf Konsens und der Einbindung aller großen Parteien in die Regierung (Bundesrat) basiert, statt auf einer harten Trennung von Regierung und Opposition.
Was bedeutet die "Zauberformel" in der Schweiz?
Die Zauberformel regelte von 1959 bis 2003 die feste parteipolitische Zusammensetzung des siebenköpfigen Bundesrates (2:2:2:1 Verteilung).
Welchen Einfluss hatte Christoph Blocher auf das System?
Seine Wahl 2003 forderte das traditionelle Kollegialitätsprinzip heraus, da er oft eine "halboppositionelle" Haltung innerhalb der Regierung einnahm.
Wie unterscheidet sich die Schweiz von Deutschland?
Die Schweiz ist eine halbdirekte Demokratie mit starken plebiszitären Elementen und einer Proporzpolitik, die in Deutschland so nicht existiert.
Ist das Konkordanzsystem ein Auslaufmodell?
Steigende Polarisierung und die Ablehnung von Behördenvorschlägen durch das Volk setzen das System unter Druck und führen zu Debatten über Reformen.
- Quote paper
- Matthias Hansen (Author), 2005, Quo vadis, Helvetia? Die Schweiz am Scheideweg zwischen Konkordanz und Konkurrenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45876