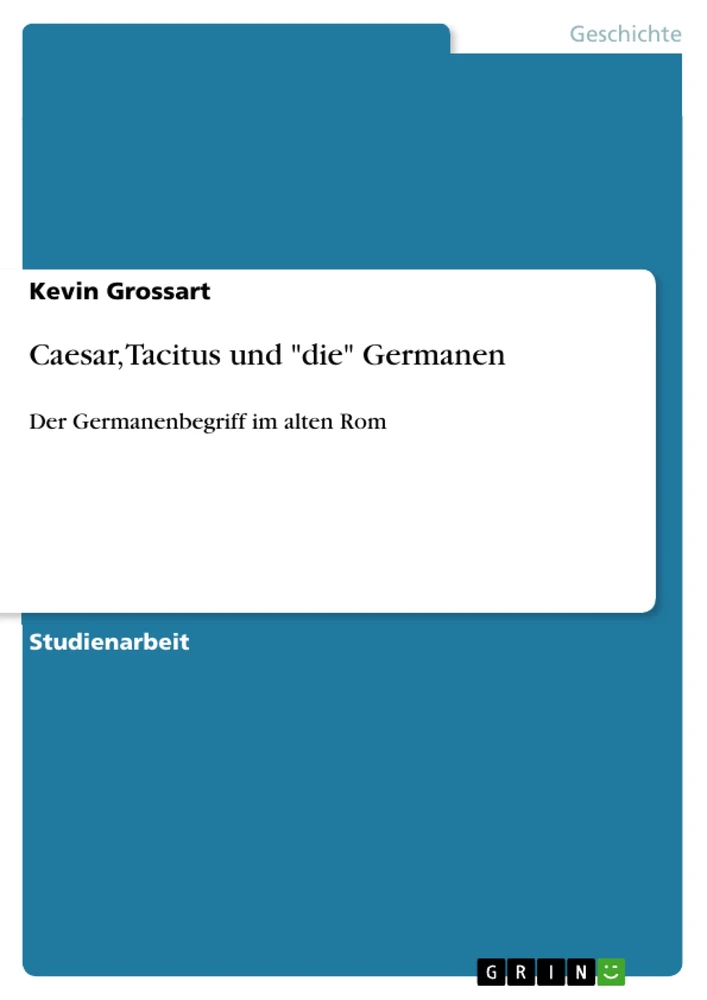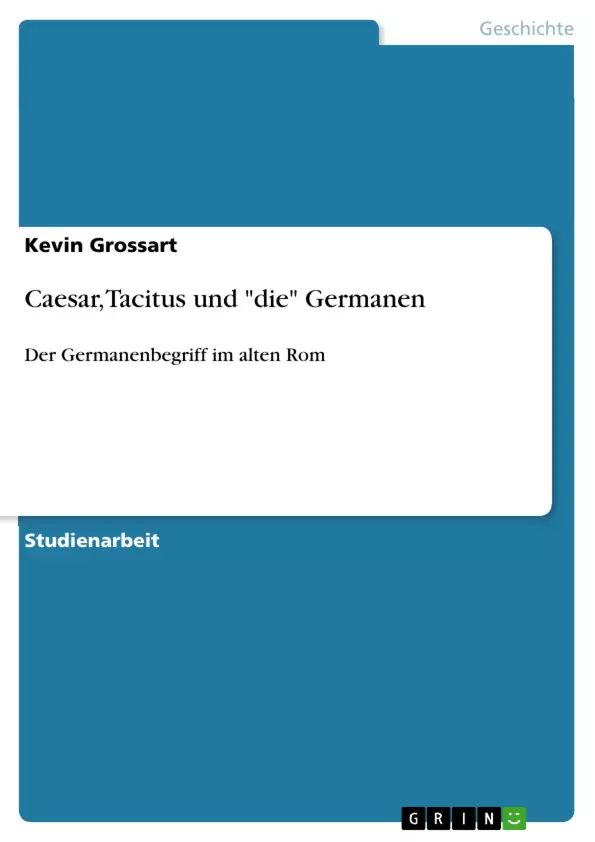Wer waren diese Germanen von denen Caesar und Tacitus in ihren Werken berichten? Vor Caesars Beschäftigung mit ihnen wurden sie bei den Römern kaum als eigene ethnische Gruppe wahrgenommen, was vermutlich auch mit der räumlichen Distanz zwischen Rom und Germanien zusammenhing. Diesem Umstand könnte es geschuldet sein, dass der Germanenbegriff erst an Relevanz gewinnen und geläufig werden konnte, als das römische Reich sich bis in das nördliche Europa hinein ausgebreitet hatte und die Römer so auch auf einige neue und vorher unbeachtete Völkerschaften stießen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenlage
- Stand der Forschung
- Caesars Germanenbegriff
- Das cäsarische Germanenbild
- Ariovist, ein typischer Germane?
- Der Germanenexkurs
- Der Germanenbegriff des Tacitus
- Das Germanenbild des Tacitus
- Die politische Organisation der Germanen
- Die Religion der Germanen
- Die Germanische Frau
- Die Sittlichkeit der Germanen
- Die germanische Kampfeslust
- Die germanische Kunst
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Prägung des Germanenbegriffes durch Caesar und Tacitus und analysiert die Germanenbilder der beiden antiken Autoren. Es werden die cäsarischen und taciteischen Quellen kritisch beleuchtet und die Forschungsgeschichte zum Germanenbegriff und Germanenbild der beiden Autoren zusammengefasst. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Germanenbegriffes von Caesar zu Tacitus nachzuvollziehen und die unterschiedlichen Bilder der Germanen, die beide Autoren zeichnen, zu analysieren.
- Die Entwicklung des Germanenbegriffes von Caesar zu Tacitus
- Das cäsarische und das taciteische Germanenbild
- Die Quellenkritik der cäsarischen und taciteischen Quellen
- Die Rezeption des Germanenbegriffes in der Forschung
- Die Verwendung antiker ethnographischer Topoi in den Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Relevanz des Germanenbegriffes in der Antike. Sie zeigt auf, wie der Germanenbegriff im Laufe der römischen Expansion an Bedeutung gewann und wie sich die Griechen und Römer von den nördlichen Ethnien unterschieden.
- Quellenlage: Dieses Kapitel analysiert die wichtigsten Primärquellen für die Untersuchung des Germanenbegriffes und Germanenbildes, nämlich Caesars Commentarii de Bello Gallico und Tacitus' Germania. Es geht auf die Entstehungszeit der Quellen, den Kontext ihrer Entstehung und die Besonderheiten der jeweiligen Werke ein.
- Stand der Forschung: Der Stand der Forschung beleuchtet die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Germanenbegriff und Germanenbild von Caesar und Tacitus und geht auf die unterschiedlichen Interpretationen der Quellen im Laufe der Geschichte ein. Er zeigt, wie die Rezeption des Germanenbegriffes von nationalistischen Motiven geprägt war und wie sich die wissenschaftliche Sichtweise im 20. Jahrhundert veränderte.
- Caesars Germanenbegriff: Dieses Kapitel untersucht den cäsarischen Germanenbegriff und analysiert, wie Caesar die Germanen von anderen Völkern unterschied. Es werden die möglichen etymologischen Herleitungen des Begriffs diskutiert und Caesars Intention, die Germanen in seinen Schriften als eine eigenständige Gruppe darzustellen, beleuchtet.
- Das cäsarische Germanenbild: Das cäsarische Germanenbild wird anhand von Caesars Darstellung des Ariovist und des Germanenexkurses im Bellum Gallicum analysiert. Es werden die von Caesar beschriebenen Eigenschaften der Germanen und die Unterschiede zwischen den Germanen und den Kelten herausgearbeitet.
- Der Germanenbegriff des Tacitus: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Germanenbegriff des Tacitus und untersucht seine Unterschiede zu Caesars Germanenbegriff. Es werden die Besonderheiten des taciteischen Germanenbegriffes und die möglichen Gründe für die Abweichungen von Caesars Darstellung erörtert.
- Das Germanenbild des Tacitus: Das taciteische Germanenbild wird anhand von Beispielen aus Tacitus' Germania analysiert. Es werden die von Tacitus beschriebenen Bereiche der germanischen Kultur und Gesellschaft, wie die politische Organisation, die Religion, die Rolle der Frau und die Sittlichkeit, untersucht und mit Caesars Darstellung verglichen. Der Fokus liegt dabei auf den genuin taciteischen Elementen im Germanenbild.
Schlüsselwörter
Germanenbegriff, Germanenbild, Caesar, Tacitus, Commentarii de Bello Gallico, Germania, antike Ethnographie, ethnographische Topoi, Quellenkritik, Forschungsgeschichte, politische Organisation, Religion, Sittlichkeit, Kampfeslust, Kunst, Quellenlage, Stand der Forschung.
- Citation du texte
- Kevin Grossart (Auteur), 2013, Caesar, Tacitus und "die" Germanen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458897