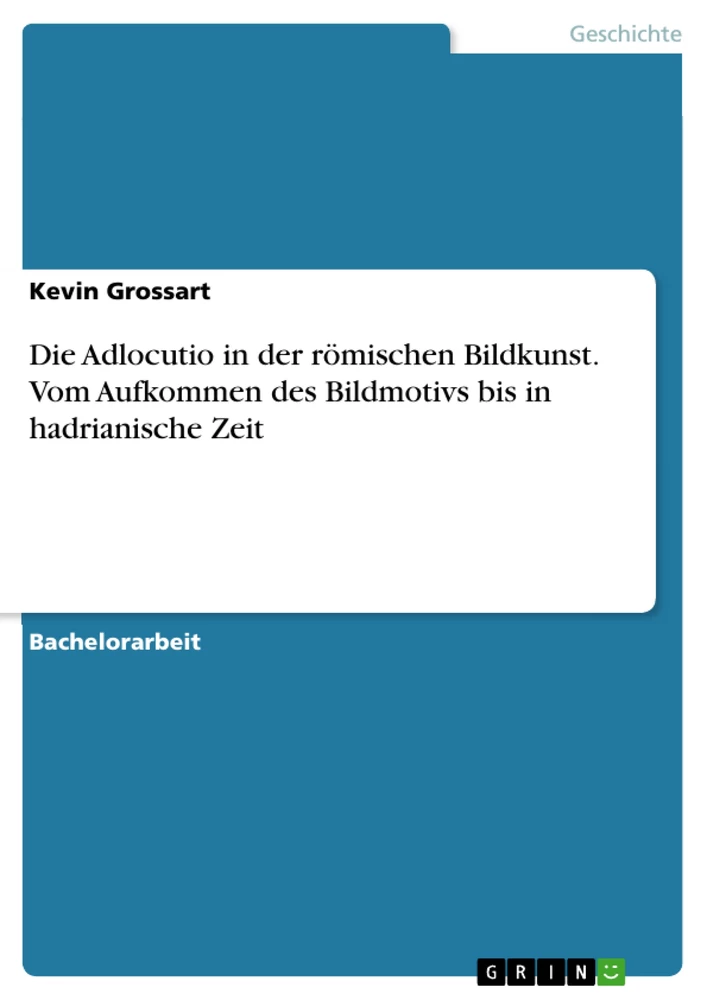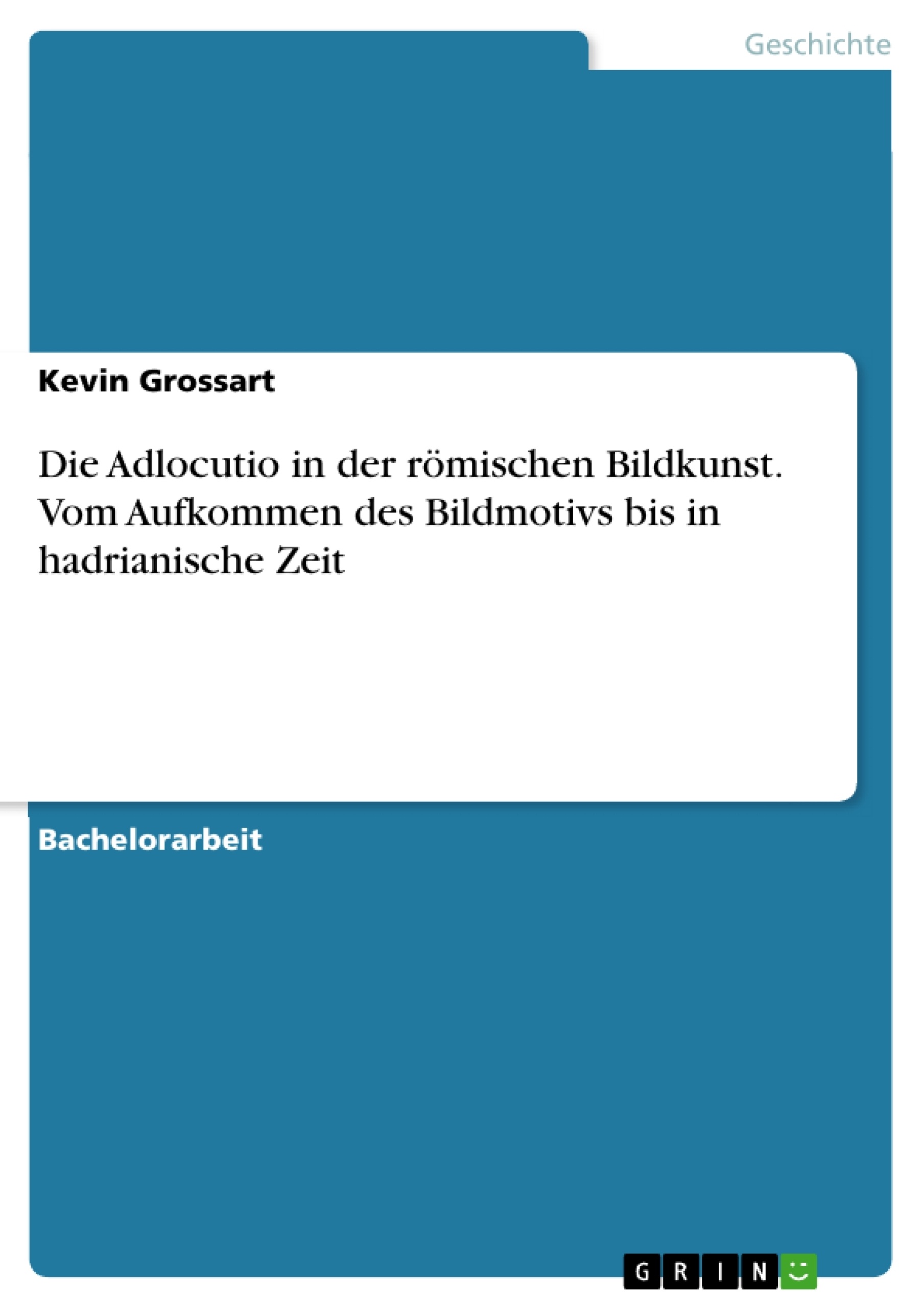Wert und Bedeutung der öffentlichen Rede im antiken Rom preist Quintilian an einer Stelle seines Rhetoriklehrbuchs auf folgende Weise: »Wird es etwa bestritten werden, dass den unschönen Frieden mit Pyrrhus jener Blinde, Appius, durch der Rede Kraft beendete? Oder dass die göttliche Eloquenz des Marcus Tullius Cicero sowohl gegen die Landreformgesetze beim Volke beliebt war als auch die Dreistigkeit des Catilina zerbrach und Cicero in seiner Toga Dankfeste verdiente, die man als höchste Ehrung den siegreichen Anführern im Kriege gewährt? Ruft die Rede nicht häufig die erschrockenen Seelen der Soldaten von der Furcht zurück und überzeugt sie, dass in den vielen Gefahren, die sie im Kampfe auf sich nehmen, der Ruhm mächtiger sei als das Leben?«. Diese letztgenannte Ansprache zur Ermunterung der Soldaten ist ein Phänomen das bereits zu Quintilians Lebzeiten im 1. Jh. n. Chr. Eingang in die römische Bildkunst gefunden hatte und als Adlocutio bezeichnet wurde. Adlocutio, oder Allocutio, ist eine substantivierte Verbindung der lateinischen Vorsilbe ad und dem Deponens loqui und meint somit wörtlich die Ansprache. Vor der stark militärischen Konnotation und hauptsächlichen Verwendung des Wortes zur Bezeichnung einer Heeresansprache ist Adlocutio in der Tat auch im allgemeinen Sinne des ermunternden oder tröstenden Zuredens bezeugt. Im Rahmen dieser Arbeit wird unter Adlocutio die Ansprache jedweder Person verstanden werden die Träger eines Imperiums ist und sich an ein ziviles oder militärisches Publikum wendet. Gleichwohl bedingt die politische Struktur der römischen Gesellschaft ab dem Beginn der Kaiserzeit eine Konzentration jener imperialen Gewalt auf die Person des Kaisers. In der Hauptsache werden somit Adlocutiones der Principes behandelt werden, die darüber hinaus zumeist an Soldaten gerichtet sind. Insbesondere im Hinblick auf den republikanischen Ursprung der Adlocutio scheint die vorgenommene Differenzierung dennoch sinnvoll, da der Besitz des Imperiums zu allen Zeiten die notwendige Voraussetzung gewesen ist, eine formelle Rede an die Soldaten halten zu dürfen und somit eine Adlocutio durchzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Einleitung: Der Begriff der Adlocutio
- 1.2 Forschungsstand
- 2. Der Ursprung der Adlocutio in der Tradition der römischen Republik
- 3. Die Adlocutio vom beginnenden Prinzipat bis zum Tode Neros
- 4. Die Adlocutio im Vierkaiserjahr
- 5. Die Adlocutio von flavischer Zeit bis zum Tode Nervas
- 6. Die Adlocutio als Motiv der trajanischen Staatskunst
- 6.1 Die Münzprägung
- 6.2 Die Trajanssäule
- 6.3 Die Anaglypha Traiani
- 7. Die Adlocutio in hadrianischer Zeit
- 7.1 Die Münzprägung
- 7.2 Die Reliefs vom Arco di Portogallo
- 7.3 Das Adlocutio-Monument von Lambaesis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung der Adlocutio in der römischen Bildkunst. Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Motivs von seinem Ursprung in der römischen Republik bis in die hadrianische Zeit zu untersuchen und dabei die verschiedenen Erscheinungsformen und Bedeutungen des Bildmotivs aufzuzeigen.
- Der Begriff der Adlocutio und seine historische Entwicklung
- Die Verwendung der Adlocutio in der römischen Republik
- Die Adlocutio als Propagandainstrument der römischen Kaiserzeit
- Die Darstellung der Adlocutio in verschiedenen Denkmälergattungen
- Die Bedeutung der Adlocutio für das Verständnis der römischen Staatskunst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Adlocutio ein und erläutert den Begriff sowie den Forschungsstand. Kapitel 2 beleuchtet den Ursprung des Motivs in der Tradition der römischen Republik und analysiert die Statue des Aulus Metellus, den sog. Arringatore, als frühes Beispiel. Kapitel 3 untersucht die Entwicklung der Adlocutio vom beginnenden Prinzipat bis zum Tode Neros, während Kapitel 4 die Adlocutio im Vierkaiserjahr behandelt. Kapitel 5 betrachtet das Motiv in der flavischen Zeit bis zum Tode Nervas und Kapitel 6 widmet sich der Adlocutio als Motiv der trajanischen Staatskunst, wobei die Münzprägung, die Trajanssäule und die Anaglypha Traiani im Fokus stehen. Kapitel 7 schließlich analysiert die Adlocutio in hadrianischer Zeit anhand der Münzprägung, der Reliefs vom Arco di Portogallo und dem Adlocutio-Monument von Lambaesis.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Arbeit sind: Adlocutio, römische Bildkunst, Staatskunst, Propaganda, Imperium, Heeransprache, Münzen, Reliefs, Statuen, römische Republik, Kaiserzeit, Trajan, Hadrian, Arringatore, Anaglypha Traiani, Trajanssäule.
- Quote paper
- Kevin Grossart (Author), 2016, Die Adlocutio in der römischen Bildkunst. Vom Aufkommen des Bildmotivs bis in hadrianische Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458903