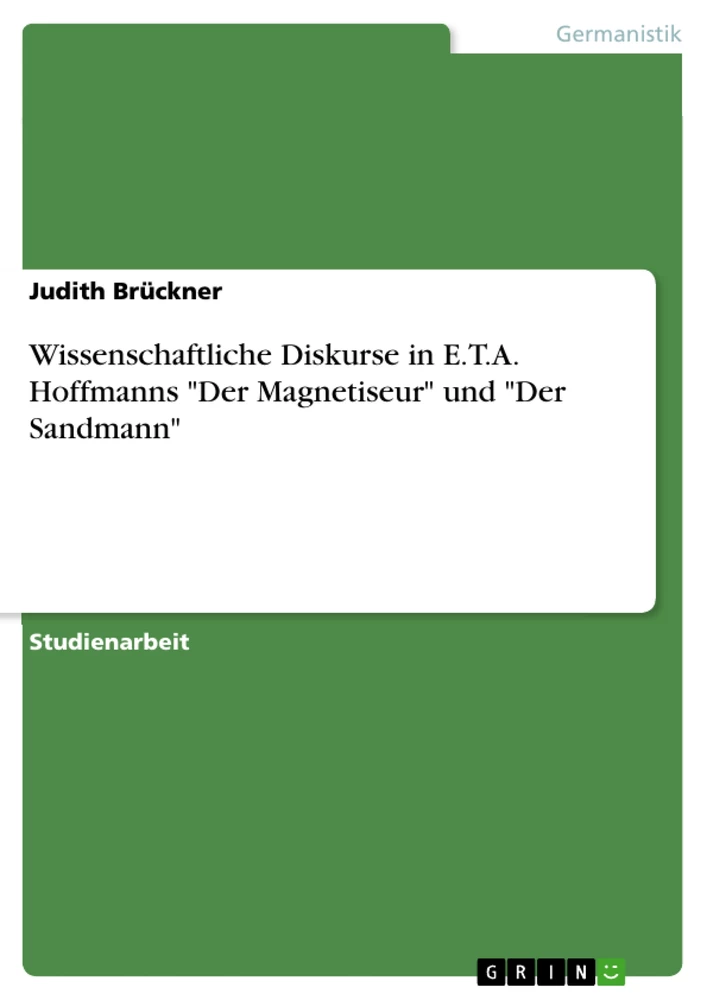Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, die Haltungen der Protagonisten sowohl im Magnetiseur als auch im Sandmann herauszuarbeiten und darin möglicherweise eine Stellungnahme des Autors selbst zu entdecken. Die von Elsner aufgeworfene Hypothese des mit wissenschaftlichen Kenntnissen ausgestatteten Schriftstellers werde ich, zumindest was Hoffmann anbelangt, im Folgenden stützen. Der Königsberger Schriftsteller hat sich nicht nur ausführlich mit den Themen Magnetismus und Automatenmenschen sondern auch mit den zugrunde liegenden philosophischen Menschenbildern und psychologischen Entwicklungen auseinandergesetzt. Bei der Analyse der naturwissenschaftlichen Grundlagen beider Texte sollen zudem epochentypische Motive und Charakteristika herausgearbeitet werden, um Strömungen und zu dieser Zeit aktuelle und auch kontrovers diskutierte Themen aufzuspüren und Hoffmann innerhalb seiner Werke zu verorten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Der Magnetiseur
- Inhalt
- Form
- Wissenschaftlicher Diskurs
- Bamberger Naturphilosophen
- Mesmer und sein animalischer Magnetismus
- Konkrete Bezüge zur Wissenschaft im „Magnetiseur“
- Der Sandmann
- Inhalt
- Form
- Wissenschaftlicher Diskurs
- Automaten
- Reil
- Konkrete Bezüge zur Wissenschaft im „Sandmann“
- Hoffmanns Positionierung und Romantik Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss wissenschaftlicher Diskurse auf die Erzählungen "Der Magnetiseur" und "Der Sandmann" von E.T.A. Hoffmann. Dabei werden die wissenschaftlichen Themen im Kontext der Zeit analysiert und in Bezug zu den literarischen Mitteln und Inhalten der Erzählungen gesetzt.
- Die Rezeption und Darstellung des Magnetismus in "Der Magnetiseur"
- Die Rolle der Automatentheorie und der psychophysiologischen Thesen in "Der Sandmann"
- Die Positionierung Hoffmanns zur Wissenschaft und seine Kritik an der Romantik
- Das Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlicher Rationalität und romantischer Fantasie in den Erzählungen
- Die Darstellung von Wissen und Macht in den beiden Erzählungen
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit analysiert die Erzählung "Der Magnetiseur" von E.T.A. Hoffmann. Es wird auf die Entstehung und den Inhalt der Erzählung eingegangen sowie die verschiedenen Perspektiven auf den Magnetismus dargestellt. Anschließend wird der wissenschaftliche Diskurs um den Magnetismus in der Zeit Hoffmanns beleuchtet, insbesondere die Rolle der Bamberger Naturphilosophen und die Lehre Mesmers. Die Analyse der konkreten Bezüge zur Wissenschaft im "Magnetiseur" zeigt auf, wie Hoffmann die wissenschaftlichen Theorien in die literarische Handlung integriert.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich "Der Sandmann". Zunächst werden der Inhalt und die Form der Erzählung zusammengefasst. Im Anschluss daran wird der wissenschaftliche Diskurs der Zeit um das Thema Automaten und künstliche Intelligenz beleuchtet. Die psychophysiologischen Thesen Reils werden in diesem Zusammenhang vorgestellt. Die Analyse der konkreten Bezüge zur Wissenschaft im "Sandmann" zeigt auf, wie Hoffmann die wissenschaftlichen Theorien in die literarische Handlung integriert.
Der letzte Teil der Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und versucht Hoffmanns Positionierung zur Wissenschaft aus den beiden Erzählungen herauszuarbeiten. Die Verortung des Autors im Epochengefüge wird skizziert, um seine Ansichten über den Fortschritt zu beleuchten.
Schlüsselwörter
E.T.A. Hoffmann, Der Magnetiseur, Der Sandmann, Magnetismus, Mesmer, Automaten, Reil, Romantik, Wissenschaft, Literatur, Wissen, Macht, Fantasie, Rationalität, Fortschritt.
Häufig gestellte Fragen
Welche wissenschaftlichen Themen verarbeitet E.T.A. Hoffmann in seinen Werken?
Hoffmann thematisiert insbesondere den animalischen Magnetismus (Mesmerismus) und die Automatenlehre (künstliche Menschen).
Worum geht es im wissenschaftlichen Diskurs von "Der Magnetiseur"?
Die Erzählung behandelt die Lehren von Franz Anton Mesmer und den Einfluss unsichtbarer Kräfte auf die menschliche Psyche.
Welche Rolle spielen Automaten in "Der Sandmann"?
Automaten wie die Figur Olimpia werfen Fragen nach der Grenze zwischen lebendigen Wesen und leblosen Maschinen sowie nach der menschlichen Wahrnehmung auf.
Wer war Johann Christian Reil im Kontext von Hoffmanns Werk?
Reil war ein bedeutender Mediziner, dessen psychophysiologische Thesen Hoffmann als Grundlage für die psychologische Tiefe seiner Figuren nutzte.
Wie steht Hoffmann zur Wissenschaft der Romantik?
Hoffmann nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse seiner Zeit, um das Unheimliche und die Grenzen der rationalen Welt auszuleuchten.
- Quote paper
- Judith Brückner (Author), 2015, Wissenschaftliche Diskurse in E.T.A. Hoffmanns "Der Magnetiseur" und "Der Sandmann", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458940