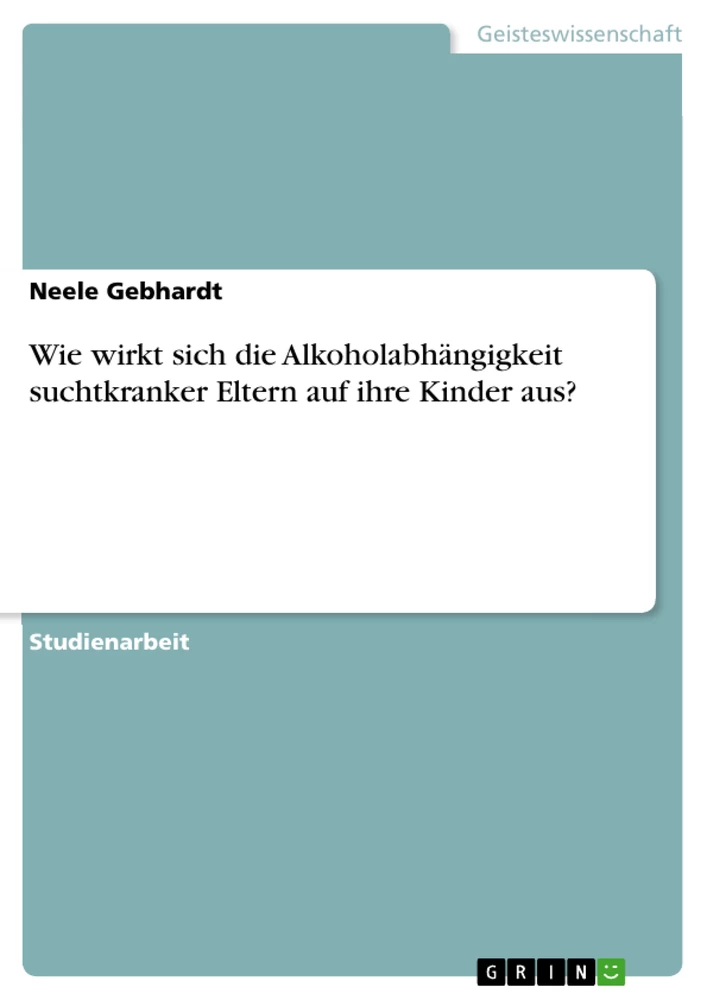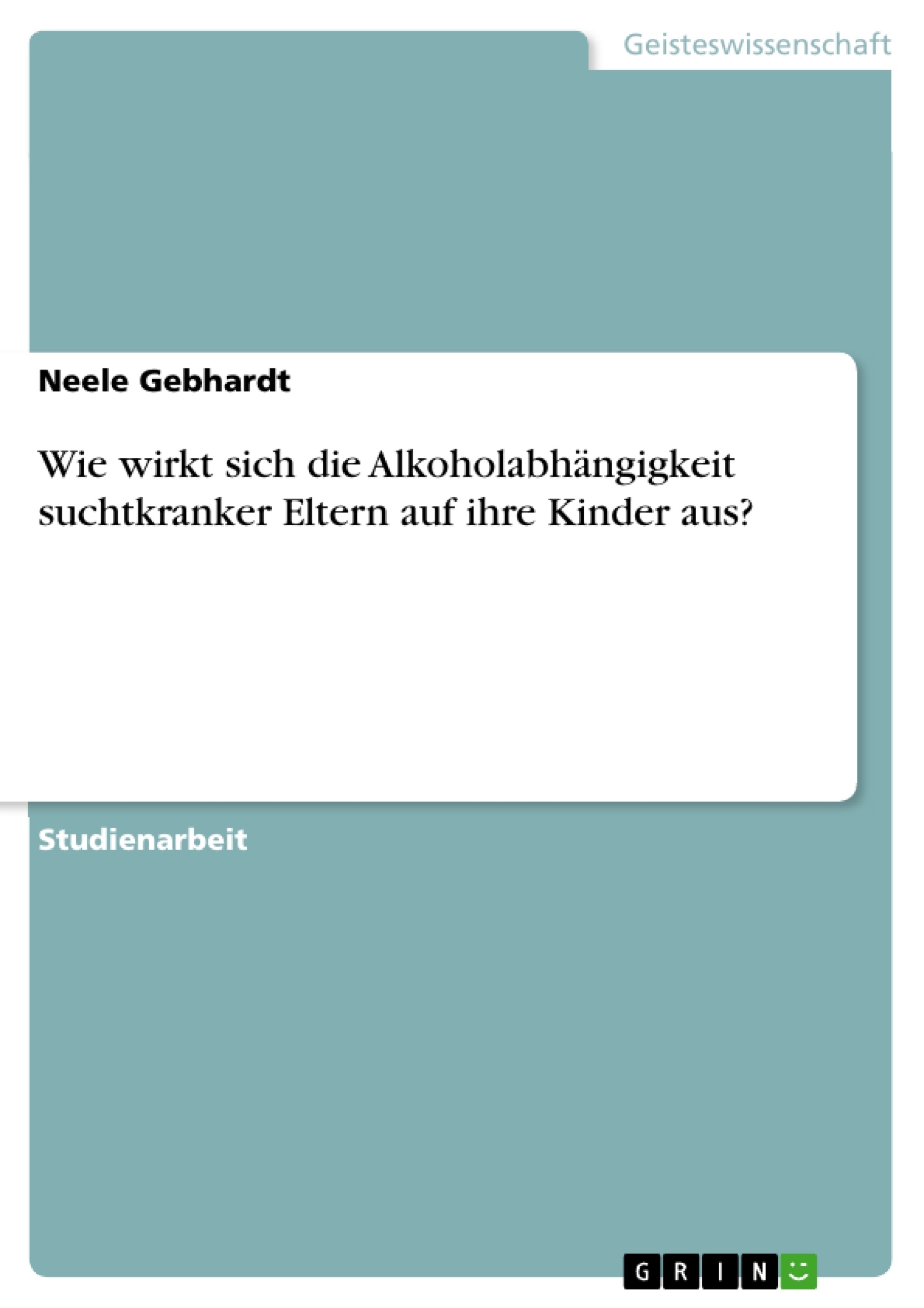Alkohol ist seit vielen Jahrhunderten ein fester Bestandteil unseres alltäglichen Lebens. Er kann in Deutschland legal und vor allem in großen Mengen erworben werden. Das Trinken von Alkohol ist fest in das soziale Leben integriert und wird auch weitgehend toleriert. Dabei konsumieren viele Deutsche Alkohol in gesundheitsgefährdenden Mengen, 1,7 Millionen Bürger gelten als alkoholabhängig. Im Umfeld jedes abhängigen Erwachsenen gibt es Angehörige, die oft die Leidtragenden des Alkoholmissbrauchs sind. Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den Konsequenzen von elterlichem Alkoholkonsum für Kinder auseinander.
Dazu setzt sich diese Projektarbeit zunächst mit der Definition von Alkoholabhängigkeit auseinander und beleuchtet die verschiedenen Formen dieser Sucht. Danach wird ein Blick auf die Familie als soziales System geworfen. Dabei wird die Familie aus systemischer Sicht betrachtet, um auf die verschiedenen Rollenverhalten der Kinder aus Familien mit alkoholabhängigen Eltern einzugehen. Außerdem beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Co-Abhängigkeit. Es werden mögliche Problematiken während der Entwicklung des Kindes untersucht, unterteilt in seelische Probleme, Misshandlung und Umgang mit Alkohol.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Alkoholabhängigkeit
- Nach ICD-10
- Formen der Alkoholabhängigkeit
- Familie als soziales System
- Familie aus systemischer Sicht
- Rollenverhalten der Kinder
- Co-Abhängigkeit
- Mögliche Problematiken während der Entwicklung des Kindes
- Seelische Probleme
- Misshandlung
- Umgang mit Alkohol
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Auswirkungen von Alkoholabhängigkeit auf Kinder suchtkranker Eltern. Sie analysiert die Problematik aus verschiedenen Perspektiven, beleuchtet die Entwicklung des Kindes im Kontext der Sucht und untersucht die möglichen Folgen für die betroffenen Kinder.
- Definition und Klassifizierung von Alkoholabhängigkeit nach ICD-10
- Die Familie als soziales System und die Rolle der Kinder in alkoholbelasteten Familien
- Mögliche psychische und soziale Folgen für Kinder, die mit Alkoholabhängigkeit eines Elternteils aufwachsen
- Die Bedeutung von präventiven Maßnahmen und unterstützenden Hilfesystemen für betroffene Familien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Alkoholabhängigkeit und deren Auswirkungen auf Kinder ein. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas im deutschen Kontext und stellt die verschiedenen Facetten der Problematik dar.
Alkoholabhängigkeit
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und Klassifizierung von Alkoholabhängigkeit nach dem ICD-10. Es werden verschiedene Formen der Alkoholabhängigkeit vorgestellt und die diagnostischen Kriterien erläutert.
Familie als soziales System
Dieses Kapitel betrachtet die Familie als soziales System und beleuchtet die Auswirkungen von Alkoholabhängigkeit auf die Familiendynamik. Es werden die Rollen und Verhaltensmuster der Kinder in alkoholbelasteten Familien untersucht und der Begriff der Co-Abhängigkeit erläutert.
Mögliche Problematiken während der Entwicklung des Kindes
Dieses Kapitel widmet sich den möglichen psychischen und sozialen Problemen, die bei Kindern in alkoholbelasteten Familien auftreten können. Es werden Themen wie seelische Probleme, Misshandlung und der Umgang mit Alkohol im Kontext der Sucht betrachtet.
Schlüsselwörter
Alkoholabhängigkeit, ICD-10, Familie, soziales System, Kinder, Entwicklung, psychische Probleme, Misshandlung, Umgang mit Alkohol, Co-Abhängigkeit, Prävention, Hilfesysteme.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Menschen sind in Deutschland alkoholabhängig?
In Deutschland gelten etwa 1,7 Millionen Bürger als alkoholabhängig.
Welche Auswirkungen hat die Sucht der Eltern auf Kinder?
Kinder leiden oft unter seelischen Problemen, Vernachlässigung oder Misshandlung und tragen ein höheres Risiko, später selbst eine Sucht zu entwickeln.
Was bedeutet der Begriff „Co-Abhängigkeit“?
Co-Abhängigkeit beschreibt ein Verhaltensmuster von Angehörigen, die das Suchtsystem unbewusst unterstützen, indem sie den Süchtigen decken oder dessen Aufgaben übernehmen.
Welche Rollen nehmen Kinder in Suchtfamilien ein?
Aus systemischer Sicht nehmen Kinder oft spezifische Rollen an, wie den „Helden“, das „Sündenbock-Kind“ oder das „verlorene Kind“, um das Familiengleichgewicht zu halten.
Was ist der ICD-10 im Zusammenhang mit Alkoholismus?
Der ICD-10 ist ein internationales Klassifikationssystem, das medizinische Kriterien zur Diagnose von Alkoholabhängigkeit festlegt.
- Arbeit zitieren
- Neele Gebhardt (Autor:in), 2018, Wie wirkt sich die Alkoholabhängigkeit suchtkranker Eltern auf ihre Kinder aus?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459066