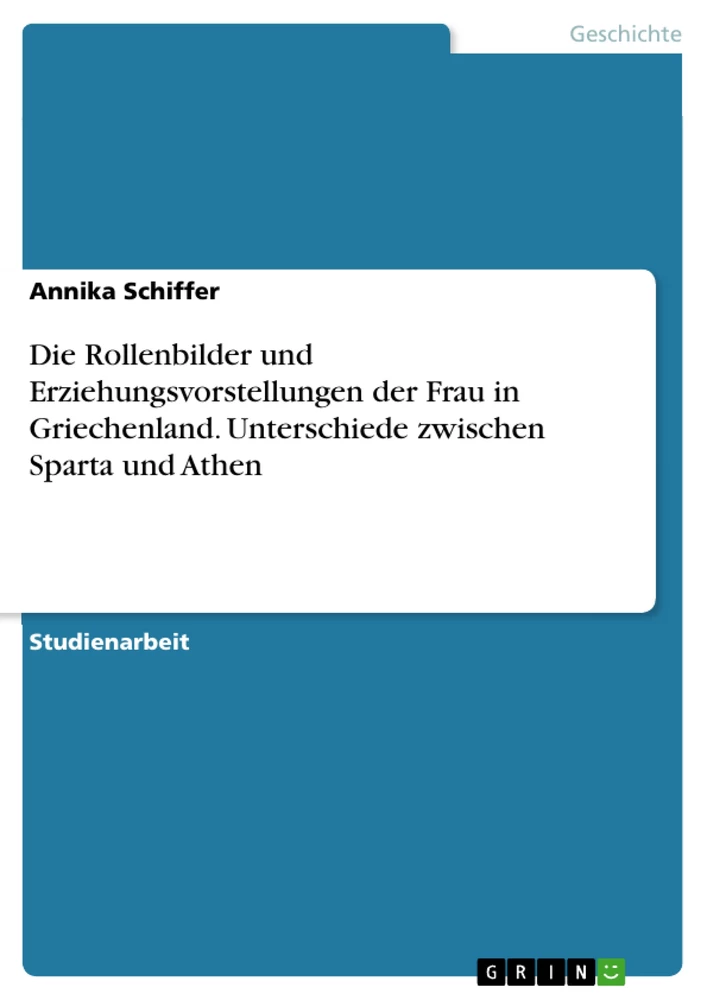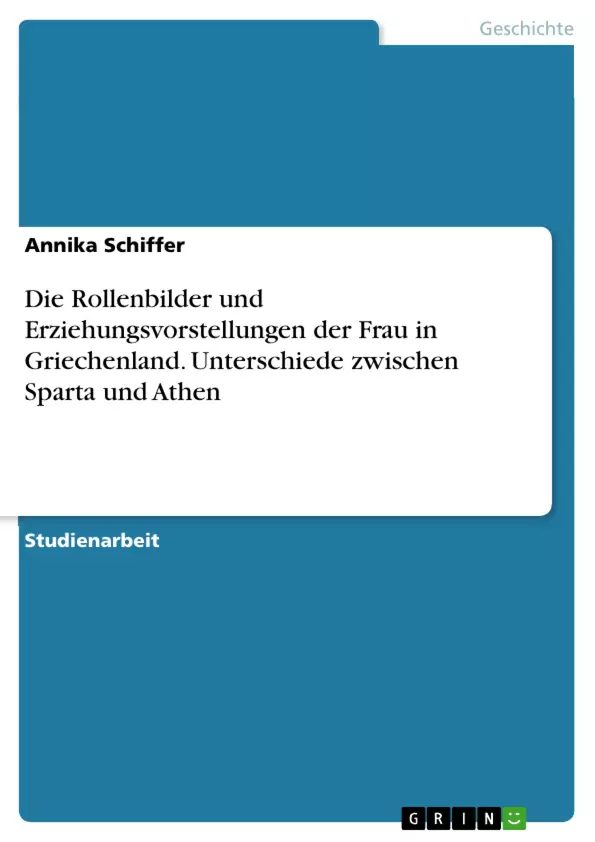Ziel ist es, die gesonderte Stellung Spartas anhand des vorherrschenden Mythos über spartanische Frauen und der staatlichen Erziehung, sowie dessen Intention analytisch zu betrachten. Dabei wird eine Einschränkung auf die beide poleis, Athen und Sparta, sowie auf den Zeitraum der Archaik und Klassik der antiken Geschichte vorgenommen.
Diese Einschränkung begründet sich darin, dass Historiker Athen und Sparta in der Forschung bereits vielschichtig durchleuchteten und verglichen, eine Gegenüberstellung dieser beiden Regionen aber gleichwohl einen optimalen Kontrast des Lebens einer Frau in Griechenland aufweist. Begonnen wird die Arbeit mit einer Quelleneinführung, welche die Schwierigkeit genauer zeitgenössischer Aussagen aufzeigt. Anschließend wird die Rolle der Frau in Sparta hinsichtlich ihrer sozialen Stellung, Kleidung und politischen Entscheidungsgewalt dargestellt und im direkten Vergleich mit dem Rollenbild der athenischen Frau ana-lysiert. Hierzu wird der Diskurs über die Freiheit der Frau in Athen, sowie ihre politische und soziale Stellung in der Gesellschaft aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Rollenbild und Erziehung der Frau in Athen und Sparta
- 2.1 Erziehungsideale und Intention
- 2.2 Staatliches Erziehungssystem in Sparta
- 2.3 Mädchenerziehung
- 2.4 Eheschließung
- 3 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Rollenbild der Frau und die Erziehungsvorstellungen spartanischer Mädchen im Vergleich zu Athen. Ziel ist die Analyse der besonderen Stellung Spartas anhand des Mythos um spartanische Frauen und des staatlichen Erziehungssystems. Der Fokus liegt auf der Archaik und Klassik, da diese Periode in der Forschung bereits intensiv behandelt wurde und einen guten Kontrast zwischen Athen und Sparta bietet.
- Das Rollenbild der Frau in Sparta und Athen
- Das staatliche Erziehungssystem in Sparta und seine Auswirkungen auf Frauen
- Der Vergleich der Mädchenerziehung in Sparta und Athen
- Die Rolle der Ehe und der gesellschaftlichen Normen für Frauen
- Die Interpretation antiker Quellen zur spartanischen Frau
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung skizziert die Zielsetzung der Arbeit: einen Vergleich des Rollenbildes der Frau und der Erziehungsvorstellungen in Sparta und Athen, insbesondere in der Archaik und Klassik. Sie betont die umfangreiche Forschung zu diesen Poleis und die damit verbundene Möglichkeit eines aussagekräftigen Kontrastes. Die Arbeit fokussiert auf spartanische Frauen und benennt die Herausforderungen, die sich aus der begrenzten Anzahl zeitgenössischer Quellen ergeben. Die methodische Vorgehensweise wird kurz umrissen: Analyse der Quellen, Darstellung des Rollenbildes in beiden Poleis, Vergleich der Erziehungsideale und -praktiken, und schließlich Betrachtung der Ehe und deren gesellschaftlicher Bedeutung.
2 Rollenbild und Erziehung der Frau in Athen und Sparta: Dieses Kapitel analysiert das Rollenbild der Frau in Sparta und Athen, wobei die Knappheit der Quellen zu spartanischen Frauen hervorgehoben wird. Es werden die Aussagen von Xenophon, Aristoteles und Plutarch kritisch gewürdigt, wobei die pro-spartanische Haltung Xenophons berücksichtigt wird. Das Kapitel beschreibt die gesellschaftliche Struktur Spartas, die hierarchische Ordnung der Spartiaten, Heloten, Periöken und Sklaven, und wie diese die Aufgaben der Frauen prägte. Die zentrale Rolle der Frau als Gebärende zukünftiger Krieger wird betont, im Gegensatz zu den häuslichen Pflichten der athenischen Frauen. Der spartanische Staat akzeptierte lockerere Ehebündnisse und außerehelichen Verkehr aus eugenischen Gründen. Der Kontrast zur athenischen Frau, die als Besitztum galt und im häuslichen Bereich blieb, wird deutlich herausgestellt. Die spartanische Frau wird als körperlich aktiv, öffentlich präsent und im Besitz von Eigentum dargestellt, im Gegensatz zur eher zurückgezogenen und rechtlich benachteiligten athenischen Frau.
Schlüsselwörter
Sparta, Athen, Frauenrolle, Mädchenerziehung, antikes Griechenland, Erziehungsideale, staatliches Erziehungssystem, Ehe, gesellschaftliche Normen, Quellenkritik, Xenophon, Aristoteles, Plutarch, Eugenik, Archaik, Klassik.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Rollenbild und Erziehung der Frau in Athen und Sparta
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit vergleicht das Rollenbild der Frau und die Erziehungsvorstellungen in Sparta und Athen, insbesondere in der Archaik und Klassik. Der Fokus liegt auf der Analyse der besonderen Stellung spartanischer Frauen im Kontext des staatlichen Erziehungssystems und des Mythos um diese Frauen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Rollenbild der Frau in Sparta und Athen, das staatliche Erziehungssystem in Sparta und dessen Auswirkungen auf Frauen, einen Vergleich der Mädchenerziehung in beiden Poleis, die Rolle der Ehe und gesellschaftlicher Normen für Frauen sowie die Interpretation antiker Quellen zur spartanischen Frau.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hausarbeit bezieht sich auf die Aussagen von Xenophon, Aristoteles und Plutarch, wobei deren jeweilige Positionen und mögliche Voreingenommenheiten kritisch betrachtet werden. Die Arbeit thematisiert auch die Herausforderungen, die sich aus der begrenzten Anzahl zeitgenössischer Quellen ergeben.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Rollenbild und Erziehung der Frau in Athen und Sparta"), welches die Rollenbilder und Erziehung der Frauen in beiden Stadtstaaten vergleicht, und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung skizziert die Zielsetzung und Methodik, das Hauptkapitel analysiert die Quellen und vergleicht die gesellschaftlichen Strukturen und Erziehungspraktiken, und die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Unterschiede im Rollenbild der Frau zwischen Sparta und Athen werden herausgestellt?
Die Hausarbeit hebt den Kontrast zwischen der spartanischen Frau, die als körperlich aktiv, öffentlich präsent und im Besitz von Eigentum dargestellt wird, und der athenischen Frau, die eher zurückgezogen und rechtlich benachteiligt war, hervor. Sparta akzeptierte lockerere Ehebündnisse und außerehelichen Verkehr aus eugenischen Gründen, im Gegensatz zu Athen, wo die Frau als Besitztum galt.
Welche Rolle spielte der Staat in der Erziehung der Frauen in Sparta?
In Sparta spielte der Staat eine zentrale Rolle in der Erziehung der Frauen. Das staatliche Erziehungssystem war darauf ausgerichtet, Frauen als Mütter zukünftiger Krieger auszubilden, im Gegensatz zu Athen, wo die Erziehung der Frauen primär im häuslichen Bereich stattfand.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die methodische Vorgehensweise umfasst die Analyse antiker Quellen, die Darstellung des Rollenbildes der Frau in beiden Poleis, den Vergleich der Erziehungsideale und -praktiken, sowie die Betrachtung der Ehe und deren gesellschaftliche Bedeutung. Dabei wird eine kritische Quellenanalyse durchgeführt, um die verschiedenen Perspektiven und potenziellen Voreingenommenheiten der Autoren zu berücksichtigen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Sparta, Athen, Frauenrolle, Mädchenerziehung, antikes Griechenland, Erziehungsideale, staatliches Erziehungssystem, Ehe, gesellschaftliche Normen, Quellenkritik, Xenophon, Aristoteles, Plutarch, Eugenik, Archaik, Klassik.
- Quote paper
- Annika Schiffer (Author), 2019, Die Rollenbilder und Erziehungsvorstellungen der Frau in Griechenland. Unterschiede zwischen Sparta und Athen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459098