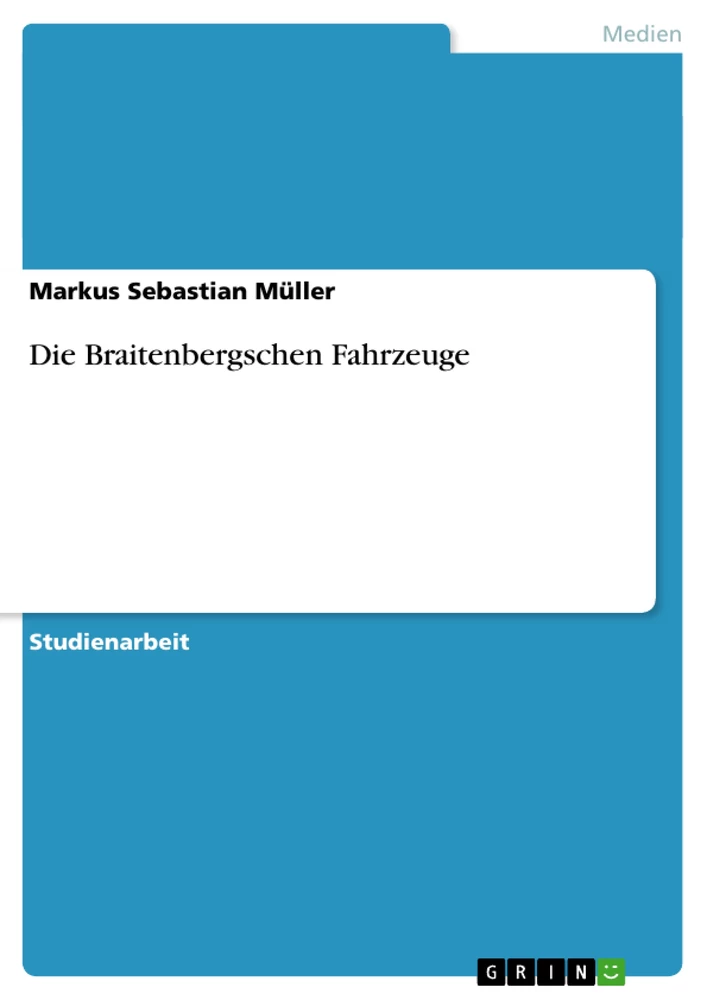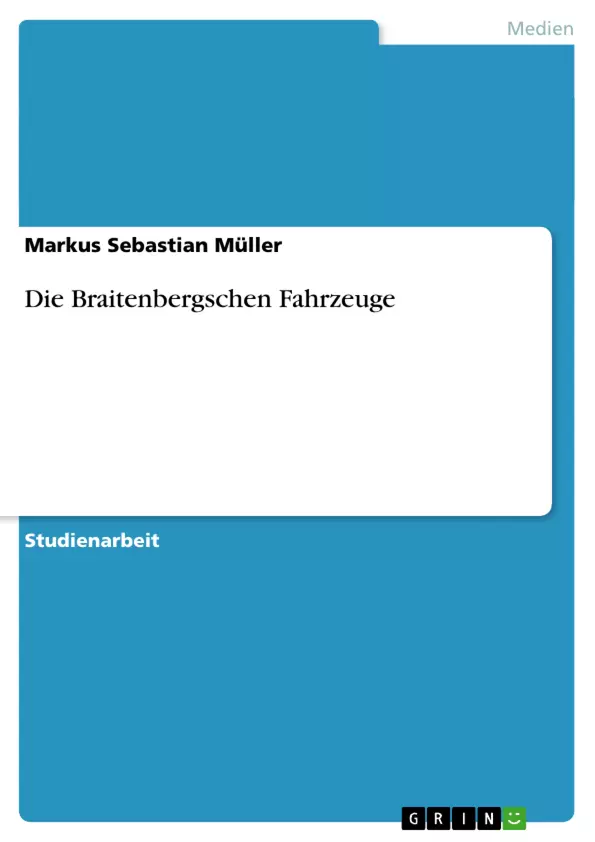„Mein Rechner spinnt mal wieder!“ – „Die Karre will nicht anspringen!“ Aussagen wie diese kennt und verwendet fast jeder Mensch. Oftmals schreiben wir technischen Geräten menschliches Verhalten zu. Selbst bei Maschinen äußerst einfacher Bauart neigen wir dazu, ihr Können mit psychologischen Begriffen zu beschreiben. Mit diesem Phänomen beschäftigt sich der Hirnforscher Prof. Dr. Valentin Braitenberg. In seinem dieser Hausarbeit zu Grunde liegenden Buch „Vehikel – Experimente mit künstlichen Wesen“ konstruiert der Forscher nacheinander 14 verschiedene roboterähnliche Fahrzeuge. Jede Generation baut auf ihrem Vorgängerwesen auf, wird jedoch schrittweise immer mehr verbessert, verfeinert und komplexer.
Braitenberg entwickelt seine Vehikel hin zu „denkenden“ Wesen. Der Fortschritt der Fahrzeuge von Generation zu Generation erweist sich als interessant und oftmals verblüffend. Daher soll in dieser Arbeit auf keinen Typ verzichtet werden; vielmehr sollen alle 14 Wesen vorgestellt werden. Schwerpunkt bilden dabei die wesentlichen Neuerungen im Vergleich zum jeweiligen Vorgängerwesen sowie die sich daraus ergebenden neuen Eigenschaften. Es ist faszinierend, zu welchen Verhaltensweisen die mit einfachen technischen Mitteln konstruierten Fahrzeuge in der Lage sind. Vor der Vorstellung der einzelnen Wesen werden zunächst grundlegende Begriffe geklärt sowie die bedeutenden Ansätze aus der Roboterarchitektur erläutert. Im Anschluss an die „Evolution“ der Vehikel wird ein Anwendungsgebiet dieser Art von Robotern vorgestellt. An Hand des „RoboCup“ wird verdeutlicht, wozu die künstlichen Wesen heutzutage konkret in der Lage sind, wie sich die Forschungsarbeit und der Austausch unter den Wissenschaftlern gestalten kann und wie ein konkretes Ziel der Roboterentwicklung aussieht.
Die folgende Arbeit basiert zu großen Teilen auf Braitenbergs Werk „Vehikel – Experimente mit künstlichen Wesen“. Zitate ohne nähere Buchbezeichnung beziehen sich auf diese Publikation. Abbildungen ohne Seitenangabe in Braitenbergs Werk wurden vom Verfasser dieser Arbeit selbst erstellt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Braitenbergschen Fahrzeuge
- 1. Der hierarchisch-planende und der reaktive Ansatz
- 2. Biographie Valentin Braitenbergs
- 3. Braitenbergs Wesen
- 3.1 Wesen 1: Streunen
- 3.2 Wesen 2: Furcht und Aggression
- 3.3 Wesen 3: Liebe
- 3.4 Zusammenfassung der Wesen 1 bis 3: Multisensorische Vehikel
- 3.5 Wesen 4: Wertung und Geschmack
- 3.6 Das Gesetz der leichten Synthese und der mühevollen Analyse
- 3.7 Wesen 5: Logik
- 3.8 Wesen 6: Selektion, der unpersönliche Ingenieur
- 3.9 Wesen 7: Begriffe
- 3.10 Wesen 8: Raum, Dinge, Bewegung
- 3.11 Wesen 9: Gestalt
- 3.12 Wesen 10: Ideen haben
- 3.13 Wesen 11: Gesetze und Regelmäßigkeiten
- 3.14 Wesen 12: Verkettung von Gedanken
- 3.15 Wesen 13: Vorhersage
- 3.16 Wesen 14: Egoismus und Optimismus
- 4. Der RoboCup
- 4.1 Vorstellung des RoboCups
- 4.2 Die Geschichte des RoboCups
- 4.3 Das Reglement
- 4.4 Der Grundaufbau eines Roboterfußballers
- 4.5 Ziel des RoboCups
- III. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die "Braitenbergschen Fahrzeuge", die der Hirnforscher Valentin Braitenberg in seinem Buch "Vehikel - Experimente mit künstlichen Wesen" entworfen hat. Sie beleuchtet die Entwicklung der 14 verschiedenen Roboterwesen und ihre zunehmend komplexen Fähigkeiten. Die Arbeit untersucht die Neuerungen, die jedes Wesen im Vergleich zu seinem Vorgänger aufweist, und analysiert die daraus resultierenden Eigenschaften. Ziel ist es, die faszinierenden Verhaltensmuster der Braitenbergschen Fahrzeuge zu verstehen, die trotz ihrer simplen Konstruktion erstaunliche Fähigkeiten aufweisen.
- Entwicklung der Braitenbergschen Fahrzeuge von einfachen Reiz-Reaktions-Mechanismen zu komplexen, "denkenden" Wesen
- Vergleich der einzelnen Wesen und ihre Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger
- Bedeutung der "Braitenbergschen Fahrzeuge" im Kontext der Roboterarchitektur
- Anwendungen der Braitenbergschen Fahrzeuge im RoboCup
- Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von reaktiven Robotern in der heutigen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Hausarbeit vor und erläutert die Forschungsfrage. Sie verdeutlicht, warum die von Valentin Braitenberg entwickelten "Braitenbergschen Fahrzeuge" ein interessantes Forschungsfeld für die Kognitionswissenschaft darstellen. Anschließend wird der hierarchisch-planende und der reaktive Ansatz in der Roboterarchitektur beleuchtet und der Begriff des "Roboters" definiert.
Im zweiten Kapitel werden zunächst die wichtigsten Fakten zur Biografie von Valentin Braitenberg dargestellt. Im Hauptteil des Kapitels werden die "Braitenbergschen Fahrzeuge" vorgestellt. Dabei wird jedes der 14 Wesen in seiner Konstruktion und seinen Eigenschaften detailliert beschrieben. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung der Fahrzeuge von Generation zu Generation und den Neuerungen, die jedes Wesen im Vergleich zu seinem Vorgänger aufweist. Die jeweiligen Eigenschaften werden mit Hilfe von Abbildungen und Beispielen verdeutlicht.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem RoboCup, einem internationalen Wettbewerb für Roboterfußball. Hier werden die Ziele des RoboCups, seine Geschichte und die wichtigsten Regeln dargestellt. Der Aufbau eines Roboterfußballers wird erläutert und die Bedeutung des RoboCups für die Entwicklung von reaktiven Robotern sowie für den Austausch zwischen Wissenschaftlern hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den "Braitenbergschen Fahrzeugen", reaktiven Robotern, der Roboterarchitektur, der Kognitionswissenschaft, Valentin Braitenberg, dem RoboCup, künstlicher Intelligenz, Reiz-Reaktions-Mechanismen und der Entwicklung von "denkenden" Wesen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Valentin Braitenberg?
Valentin Braitenberg war ein Hirnforscher, der durch seine Gedankenexperimente mit einfachen Robotern (Vehikeln) die Entstehung komplexen Verhaltens erklärte.
Was sind Braitenbergsche Fahrzeuge?
Es sind 14 fiktive Fahrzeugtypen, die durch einfache Verschaltungen von Sensoren und Motoren Verhaltensweisen wie Furcht, Liebe oder Logik simulieren.
Was ist das Gesetz der leichten Synthese und der mühevollen Analyse?
Es besagt, dass es einfach ist, ein System zu bauen, das komplexes Verhalten zeigt, aber sehr schwierig, von diesem Verhalten auf die innere Struktur zurückzuschließen.
Was ist der RoboCup?
Ein internationaler Wettbewerb für Roboterfußball, der als Anwendungsgebiet für die Forschung an reaktiven und intelligenten Systemen dient.
Wie unterscheiden sich die Fahrzeuge 2 und 3?
Fahrzeug 2 zeigt "Furcht" oder "Aggression" durch direkte Verschaltung, während Fahrzeug 3 durch gekreuzte Verbindungen ein Verhalten zeigt, das als "Liebe" interpretiert wird.
- Citar trabajo
- Markus Sebastian Müller (Autor), 2004, Die Braitenbergschen Fahrzeuge, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45914