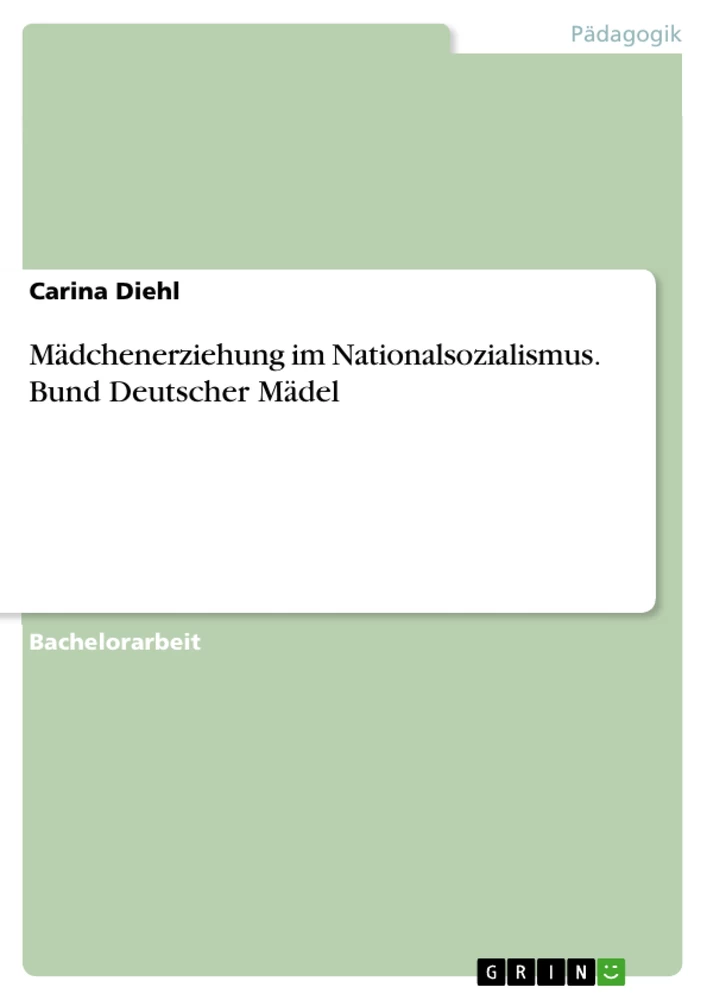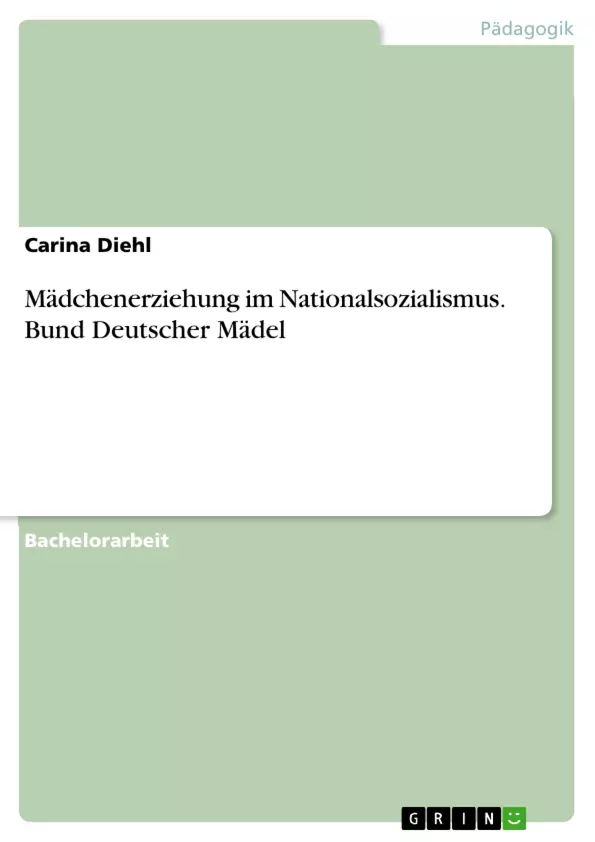Die folgende Bachelorarbeit soll einen Einblick in die Erziehungsgrundsätze des BDM (Bund Deutscher Mädel) geben, weshalb der Fragestellung nachgegangen wird, wie die Erziehung im BDM aussah. Ergänzend soll herausgefunden werden, ob im BDM überhaupt von Erziehung oder Sozialisation gesprochen werden kann oder ob diese Begriffe für die Mädchenformung im Dritten Reich veraltet sind. Um diese Fragen beantworten zu können, wird sich anfangs mit der Weimarer Republik, der Zeit vor dem Nationalsozialismus, beschäftigt. Hier soll vorerst die rechtliche Stellung von Mädchen und Frauen herausgearbeitet werden. Anschließend wird auf die Mädchen- und Frauenvolksbildung eingegangen, damit deutlich wird, dass in der Weimarer Republik „Bildung“ kein Fremdwort für Frauen war. Danach beschäftigt sich diese Bachelorarbeit mit den allgemeinen Lebensumständen und der Erziehung von Mädchen und Frauen in der Weimarer Republik, die anhand von der Freizeitgestaltung deutlich gemacht werden soll. Dieser Einstieg ist insofern wichtig, weil er die Unterschiede zwischen der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus in den eben genannten Punkten deutlich macht. Im Nationalsozialismus hat sich die Haltung gegenüber Frauen im Vergleich zur Weimarer Republik deutlich verschlechtert und die Hauptaufgaben von Frauen und Mädchen haben sich verändert, wie im Verlauf der Arbeit erkennbar wird. Nach der Weimarer Republik wird sich mit der nationalsozialistischen Erziehung auseinandergesetzt sowie mit der Frage, wie die Frauenideologie aussah. Weiterhin wird auf die grundlegenden Gedanken zur Mädchenerziehung im Dritten Reich eingegangen. Der Hauptteil der Arbeit bezieht sich auf den Bund Deutscher Mädel. Anhand dieses Bundes soll die Erziehung von Mädchen deutlich gemacht werden. Hier wird vorerst die Organisation und der Aufbau des BDM beschrieben sowie dessen Vorgeschichte und Gründung bis hin zur Machtübernahme. Fraglich ist hierbei insbesondere, warum der BDM für die Mädchen derart attraktiv war und welche Gründe existierten, diesem beizutreten. Bevor sich mit der faschistischen Ordnung des weiblichen Körpers – den Erziehungsgrundsätzen im BDM – beschäftigt wird, liegt das Augenmerk zuvor auf den allgemeinen Erziehungsansprüchen und dem Mädchenbild im BDM. Zu der faschistischen Ordnung des weiblichen Körpers zählen die körperliche Ertüchtigung, Kleidung und Körperpflege, Sexualität, die gewünschte Arbeitshaltung der Mädchen sowie die Schulungsarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Weimarer Republik
- 2.1 Die rechtliche Stellung der Frauen und Mädchen in der Weimarer Republik
- 2.2 Die Frauen- und Mädchenvolksbildung in der Weimarer Republik
- 2.3 Das Leben von Frauen und Mädchen in der Weimarer Republik
- 2.4 Erziehung von Mädchen in der Weimarer Republik – die Freizeitgestaltung
- 2.4.1 Die Jugendbewegung
- 2.4.2 Die Sozialistische Arbeiterjugend
- 2.4.3 Sport
- 3 Die nationalsozialistische Erziehung
- 3.1 Frauenideologie
- 3.2 Grundlegende Gedanken zur Mädchenerziehung im Dritten Reich
- 4 Bund Deutscher Mädel
- 4.1 Organisation und Aufbau des BDM
- 4.2 Vorgeschichte und Gründung des BDM bis hin zur Machtübernahme
- 4.3 Gründe für den Eintritt in den BDM
- 4.4 Erziehungsansprüche im BDM und das Mädchenbild
- 4.5 Die faschistische Ordnung des weiblichen Körpers
- 4.5.1 Die „körperliche Ertüchtigung“
- 4.5.2 Kleidung und Körperpflege
- 4.5.3 Sexualität
- 4.5.4 Die gewünschte Arbeitshaltung der Mädchen
- 4.5.5 Die Schulungsarbeit
- 5 Realität der BDM - „Erziehung“
- 5.1 Begriffsdefinitionen
- 5.1.1 Erziehung
- 5.1.2 Sozialisation
- 5.1.3 Manipulation
- 5.2 Was war der BDM wirklich?
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Erziehung von Mädchen im Nationalsozialismus am Beispiel des Bund Deutscher Mädel (BDM). Ziel ist es, die Erziehungsgrundsätze des BDM zu analysieren und herauszufinden, inwiefern von Erziehung, Sozialisation oder Manipulation gesprochen werden kann.
- Die rechtliche Stellung von Frauen und Mädchen in der Weimarer Republik
- Die nationalsozialistische Frauenideologie und ihre Auswirkungen auf die Mädchenerziehung
- Die Organisation, Ziele und Methoden des Bund Deutscher Mädel
- Die Rolle des BDM in der nationalsozialistischen Sozialisation
- Die Auswirkungen der faschistischen Ordnung des weiblichen Körpers auf die Mädchen im BDM
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der rechtlichen Stellung von Frauen und Mädchen in der Weimarer Republik, um die Unterschiede zur nationalsozialistischen Zeit deutlich zu machen. Anschließend werden die grundlegenden Gedanken zur Mädchenerziehung im Dritten Reich sowie die Frauenideologie des Nationalsozialismus beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Bund Deutscher Mädel, wobei die Organisation und der Aufbau des BDM, die Gründe für den Eintritt in den Bund, die Erziehungsansprüche und das Mädchenbild sowie die faschistische Ordnung des weiblichen Körpers im Fokus stehen. Schließlich wird die Frage aufgeworfen, ob es sich bei der Erziehung im BDM um Erziehung, Sozialisation oder Manipulation handelte.
Schlüsselwörter
Mädchenerziehung, Nationalsozialismus, Bund Deutscher Mädel, Frauenideologie, faschistische Ordnung, körperliche Ertüchtigung, Kleidung und Körperpflege, Sexualität, Arbeitshaltung, Schulungsarbeit, Erziehung, Sozialisation, Manipulation.
- Quote paper
- Carina Diehl (Author), 2017, Mädchenerziehung im Nationalsozialismus. Bund Deutscher Mädel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459290