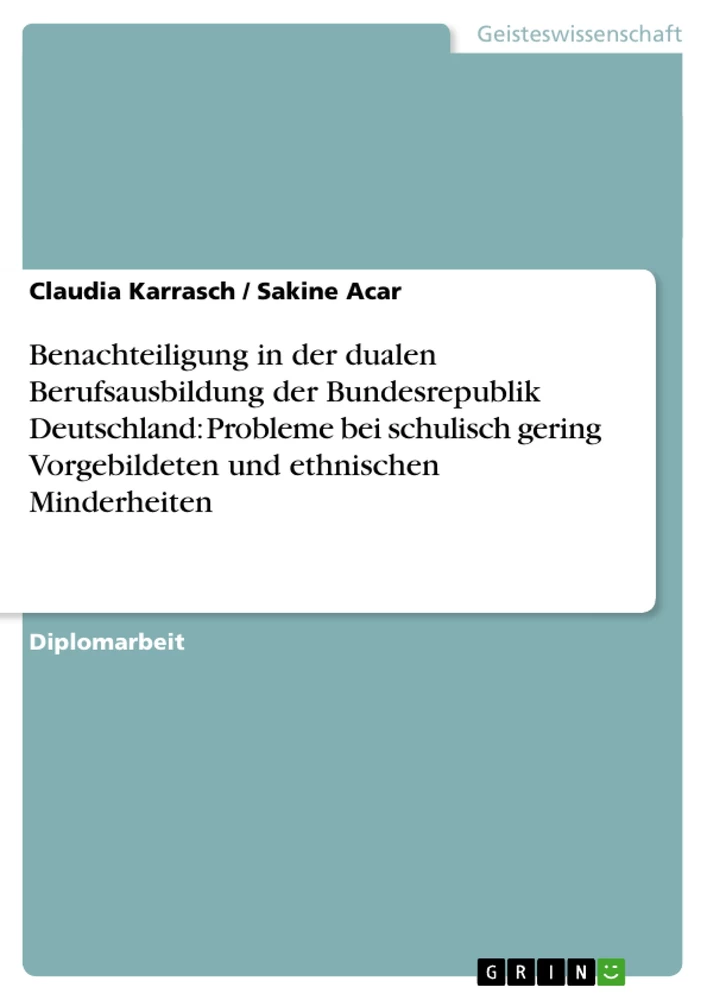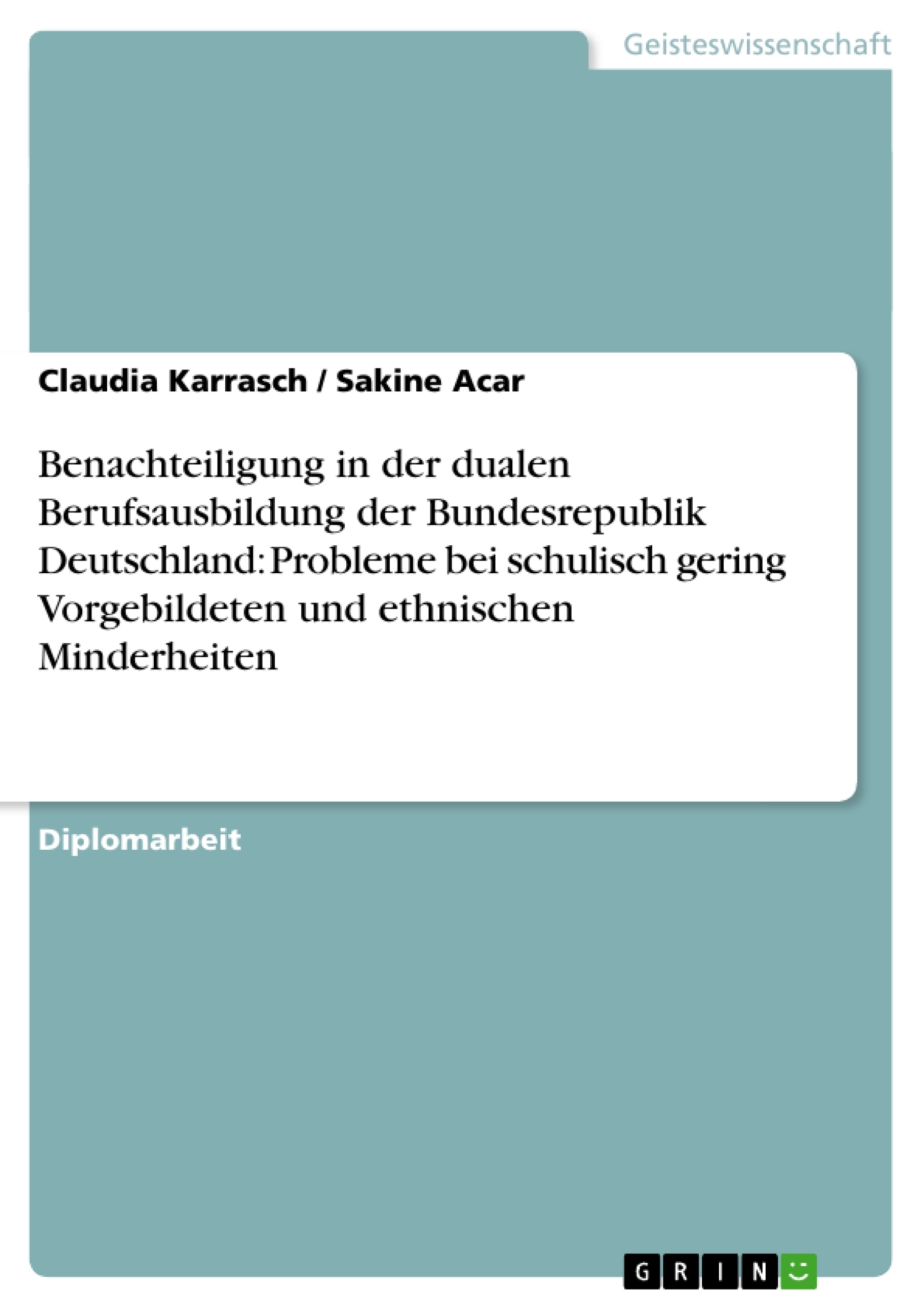Im 20. Jahrhundert nahm das duale Ausbildungssystem in Deutschland einen entscheidenden, für die Wirtschaft vorteilhaften Platz ein. Die im 18. Jahrhundert entstandene industriegesellschaftliche Basis des dualen Systems baut sich in der heutigen Zeit aufgrund wirtschaftlicher Strukturveränderungen langsam ab. Dabei spielen der globale Wettbewerb und die sich immer schneller entwickelnde Technologie eine große Rolle.
So lassen sich viele negative Resultate beobachten, wie beispielsweise eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, die nicht als vorübergehend betrachtet werden darf, sondern eventuell auf fehlerhafte, modifizierungsbedürftige Grundlagen des Systems zurückzuführen ist.
Diese Arbeit befasst sich mit dem dualen Berufsausbildungssystem in Deutschland. Im Besonderen geht sie auf die Benachteiligungen ethnischer Minderheiten und der schulisch wenig qualifizierten Jugendlichen ein. Diese Schwerpunkte der Arbeit werden zeigen, dass Qualifikationsdefizite nicht ausschließlich den Auszubildenden zugeschrieben werden dürfen, sondern auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Einflüsse mitwirken.
Nach einem kurzen historischen Überblick über die Entstehung und Entwicklung des dualen Systems wird der gegenwärtige Aufbau des Ausbildungssystems erörtert. Dabei konnte das allgemeinbildende Schulsystem nicht außer Acht gelassen werden, da eine erfolgreiche Absolvierung dessen, Grundvoraussetzung für den Einstieg in eine Berufsausbildung ist. So können Benachteiligungen bereits in der Schule entstehen und verstärkt, oder es kann ihnen dort bewusst entgegengewirkt werden.
Die Tatsache, dass diese Benachteiligung Gegenstand der sozialwissenschaftlichen Untersuchung ist, verdeutlicht die Tragweite dieser Problematik. Inhalt dieser Analysen sind mögliche Ursachen für die gegenwärtige Situation, für die theoretische Erklärungsansätze dargelegt werden. Zu den bedeutendsten Theorien gehören der Habitus und die Integrationstheorie.
Aktuelle Zahlen und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt unterstreichen nochmals die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Benachteiligten im Schul- und Ausbildungssystem. Im Februar 2005 betrug die Quote der arbeitslosen Jugendlichen 11,4 %. Allein in NRW lag die Arbeitslosenzahl der unter 25-Jährigen bei 71.466, von denen 22,5 % auf Ausländer und 36 % auf gering Qualifizierte (einschließlich der ausländischen jungen Arbeitslosen) entfallen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung (Acar & Karrasch)
- 2. Die historische Entwicklung der institutionellen Rahmenbedingungen im deutschen Ausbildungssystem (Karrasch)
- 2.1 Die Gründungsphase des Berufsausbildungssystems (1870 – 1920)
- 2.2 Die Konsolidierungsphase (1920 – 1970)
- 2.2.1 Die industrietypische Ausbildung und die Entwicklung der Berufsschule während der Weimarer Republik und des NS-Staates
- 2.2.2 Die Reformbestrebungen nach 1945
- 2.3 Die Ausbauphase des dualen Systems der Berufsausbildung ab 1970: Staatseinfluss und Rationalisierung
- 2.3.1 Einführung der beruflichen Grundbildung
- 2.3.2 Die Finanzierungsfrage
- 2.3.3 Der Ausbau und die Stabilisierung der Überbetrieblichen Ausbildungsstätten (ÜBS)
- 2.3.4 Die Neuordnung und Reduktion der Ausbildungsordnungen im System der anerkannten Ausbildungsberufe
- 2.3.5 Die Institutionalisierung der Abstimmung zwischen schulischer und betrieblicher Ausbildung
- 2.3.6 Die Qualifikation der betrieblichen Ausbilder
- 2.4 Versuche einer Bildungsreform: die politischen Auseinandersetzungen der 70er Jahre
- 3. Die Grundstrukturen der beruflichen Bildung im gegenwärtigen Ausbildungssystem (Karrasch)
- 3.1 Das deutsche Schul- und Bildungssystem (Karrasch)
- 3.1.1 Elementar- und Primarbereich (Karrasch)
- 3.1.2 Der Sekundarbereich I (Karrasch)
- 3.1.3 Der Sekundarbereich II (Karrasch)
- 3.1.4 Das Hochschulwesen (Karrasch)
- 3.1.5 Die Bedeutung formaler Bildungsabschlüsse (Karrasch)
- 3.2 Das duale System und seine Funktionselemente (Karrasch)
- 3.2.1 Der Ausbildungs- und Beschäftigungsmarkt der Bundesrepublik (Karrasch)
- 3.2.1.1 Alte Bundesländer (Acar)
- 3.2.1.2 Die neuen Bundesländer und Berlin (Acar)
- 3.2.2 Funktionselement: Berufsbildungsrecht (Karrasch)
- 3.3 Die Lernorte im dualen System der Berufsausbildung (Karrasch)
- 3.3.1 Der Lernort Betrieb (Karrasch)
- 3.3.2 Der Lernort Berufsschule (Acar)
- 3.3.3 Die „Überbetrieblichen Berufsbildungsstätten“ (ÜBS) (Acar)
- 4. Theoretische Ansätze zur Erklärung von Benachteiligungen im dualen Ausbildungssystem (Karrasch)
- 4.1 Soziale Ungleichheit durch Habitus und Lebensstil (Karrasch)
- 4.1.1 Auswirkungen des Habitus auf das Schulsystem (Karrasch)
- 4.1.2 Auswirkungen des Habitus auf die Erwerbstätigkeit (Karrasch)
- 4.2 Integrationstheorie: Der soziale Prozess der Ein- und Zuordnung verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen (Acar)
- 4.2.1 Die vier Integrationsprozesse nach Eisenstadt (Acar)
- 4.3 Extremfälle der Integration (Acar)
- 4.3.1 Die drei Integrationsformen nach Esser (Acar)
- 4.4 Die begriffliche Dimension der Eingliederung von Migranten (Acar)
- 5. Benachteiligung von Jugendlichen mit geringer Schulbildung (Schwerpunkt: Karrasch)
- 5.1 Schulische Sozialisation
- 5.2 Was vermittelt Schule?
- 5.3 Die Selektion der Schule
- 5.3.1 "Schulversager": Warum fällt das Lernen (zu lernen) so schwer?
- 5.3.2 Schulverweigerer
- 5.3.3 Schulabbrecher
- 5.3.4 Individuelle Beeinträchtigung und Lernbeeinträchtigte
- 5.4 Verschlechterte Zukunftschancen bei einer geringen Schulbildung im Kontext der Bildungsexpansion
- 5.5 Jugendliche mit und ohne Hauptschulabschluss in Ausbildungsberufen
- 5.6 Resümee
- 6. Benachteiligung ethnischer Minderheiten im System der dualen Ausbildung (Schwerpunkt: Acar)
- 6.1 Die Entstehung und Entwicklung der Ausländerpolitik
- 6.1.1 Die drei größten Zuwanderergruppen in der BRD
- 6.2 Nichtdeutsche Jugendliche zwischen zwei Kulturen und ihre Probleme der Anpassung
- 6.3 Integration in die Arbeits- und Lebenswelt
- 6.4 Die berufliche Integration der Migranten in Deutschland
- 6.5 Der Ausbildungsstand ausländischer Jugendlicher in Deutschland
- 6.5.1 Ursachen und Erklärungsansätze für die geringe Bildung und somit für den Rückgang der Ausbildungsquoten ethnischer Minderheiten
- 6.5.1.1 Ausbildungsbeteiligung und Berufswahl
- 6.5.1.2 Das Sprachdefizit – Die Bedeutung der Sprache für die Integration und für die Berufsausbildung ausländischer Jugendlicher
- 6.5.1.3 Das Elternhaus
- 6.5.1.4 Das Selektionsverhalten der Ausbildungsbetriebe
- 6.6 Resümee
- 7. Perspektiven in der beruflichen Benachteiligtenförderung (Karrasch)
- 7.1 (Gesetzliche) Grundlagen bei der Förderung von benachteiligten Jugendlichen (Karrasch)
- 7.1.1 Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (Karrasch)
- 7.1.2 Ausbildungsbegleitende Hilfen (Karrasch)
- 7.2 Berufsvorbereitende Maßnahmen als intermediäre Sozialisationsinstanz (Karrasch)
- 7.2.1 Die Sozialisationsrelevanz berufsvorbereitender Maßnahmen (Karrasch)
- Die historische Entwicklung des dualen Berufsausbildungssystems und seine institutionellen Rahmenbedingungen
- Soziale Ungleichheit im Bildungssystem und die Rolle von Habitus und Lebensstil
- Theoretische Ansätze zur Integration und die Auswirkungen auf die berufliche Integration von Migranten
- Die Auswirkungen von geringer Schulbildung auf die Zukunftschancen von Jugendlichen
- Die Herausforderungen der beruflichen Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik der Benachteiligung von Jugendlichen mit geringer Schulbildung und ethnischen Minderheiten im dualen Berufsausbildungssystem vor und skizziert die Forschungsfragen und methodische Vorgehensweise.
- Kapitel 2: Die historische Entwicklung des dualen Berufsausbildungssystems: Dieses Kapitel untersucht die institutionellen Rahmenbedingungen der Berufsausbildung in Deutschland, beginnend mit der Gründungsphase und den Veränderungen im Laufe der Zeit.
- Kapitel 3: Die Grundstrukturen der beruflichen Bildung im gegenwärtigen Ausbildungssystem: Dieses Kapitel analysiert das deutsche Schul- und Bildungssystem sowie die Funktionselemente des dualen Systems, einschließlich des Ausbildungs- und Beschäftigungsmarktes, des Berufsbildungsrechts und der Lernorte.
- Kapitel 4: Theoretische Ansätze zur Erklärung von Benachteiligungen: Dieses Kapitel stellt verschiedene soziologische Theorien zur Erklärung sozialer Ungleichheit und Integration vor, mit einem Fokus auf Habitus und Lebensstil sowie Integrationstheorien.
- Kapitel 5: Benachteiligung von Jugendlichen mit geringer Schulbildung: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von geringer Schulbildung auf die Zukunftschancen von Jugendlichen und analysiert die Ursachen und Folgen von "Schulversagern", "Schulverweigerern" und "Schulabbrechern".
- Kapitel 6: Benachteiligung ethnischer Minderheiten: Dieses Kapitel beleuchtet die Situation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im dualen Berufsausbildungssystem und analysiert die Ursachen für die geringere Ausbildungsbeteiligung und die Schwierigkeiten bei der beruflichen Integration.
- Kapitel 7: Perspektiven in der beruflichen Benachteiligtenförderung: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Maßnahmen zur Förderung benachteiligter Jugendlicher, um die Chancen auf eine erfolgreiche Berufsausbildung zu verbessern.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit analysiert die Benachteiligung von Jugendlichen mit geringer Schulbildung und ethnischen Minderheiten im dualen Berufsausbildungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, die Ursachen und Mechanismen dieser Benachteiligungen zu untersuchen und verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung dieser Phänomene aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Benachteiligung, Berufsausbildung, duales System, ethnische Minderheiten, Integration, Schulbildung, Sozialisation, Habitus, Lebensstil, Migranten, Sprachdefizit, Selektion, Ausbildungsbetriebe, Förderung, Berufsvorbereitende Maßnahmen
- Quote paper
- Claudia Karrasch (Author), Sakine Acar (Author), 2005, Benachteiligung in der dualen Berufsausbildung der Bundesrepublik Deutschland: Probleme bei schulisch gering Vorgebildeten und ethnischen Minderheiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45996