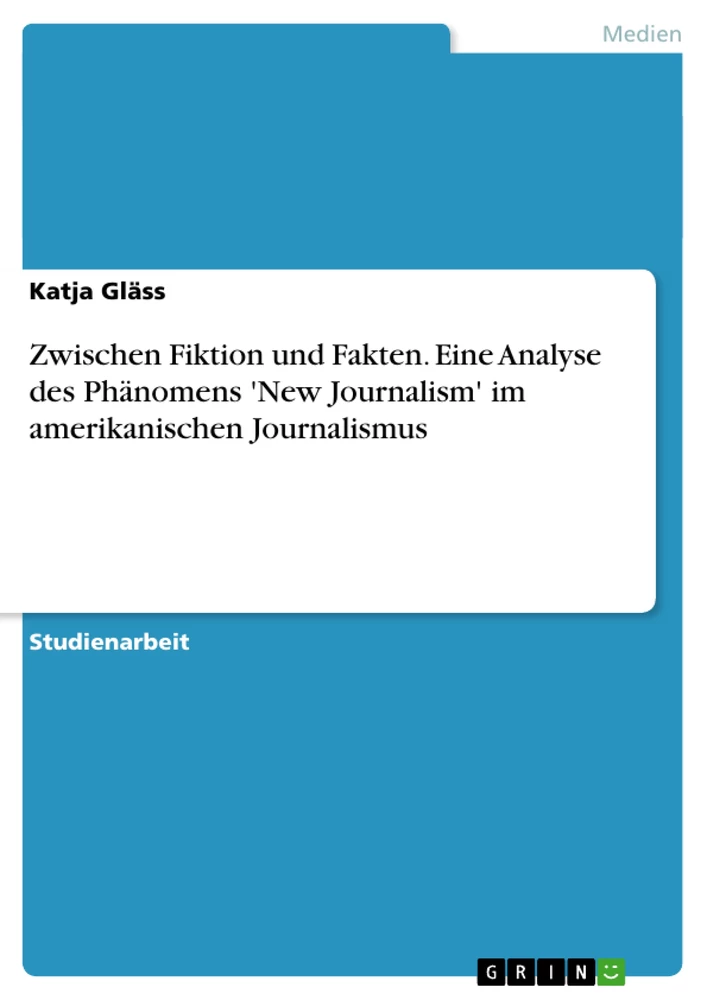Der New Journalism war ein Phänomen seiner Zeit. In einer Periode, in der tradierte Formen der journalistischen Berichterstattung ausgedient zu haben schienen, suchten Autoren nach einer alternativen Methode, mit der sie das Lebensgefühl, das sie in den 60er und 70er Jahren in den Vereinigten Staaten vorfanden, adäquat wiedergeben konnten.
Autoren wie Tom Wolfe, Gay Talese oder Jimmy Breslin begannen, die tradierten Regeln und Hierarchien zwischen Literatur und Journalismus aufzubrechen. Die Vertreter nutzten die Schwäche der Medien, die sich von heiklen Themen fernhielten. Problematiken wie Gewalt in Großstädten, Rassenunruhen oder die sich wandelnde Sexualmoral fanden in Zeitungen keine Plattform, wohl aber in den Arbeiten der New Journalists.
Die Bewegung war – trotz der massiven Kritik – sowohl für den Journalismus als auch für die Literatur von erheblicher Bedeutung. Abseits der reinen Fakten näherte er sich seinen Themen und Protagonisten auf einer emotionalen Ebene – und brachte damit eine Objektivitätsdebatte ins Rollen.
Das Ziel der Arbeit ist, die kritische Betrachtung des Phänomens New Journalism und der Frage, inwieweit diese Richtung ihrer selbstgestellten Aufgabe gerecht wurde. Es wird beleuchtet, welche Mittel eingesetzt wurden und weshalb es der New Journalism nicht schaffte, sich dauerhaft zu etablieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eingrenzung - Versuch einer Definition
- Literatur und Journalismus als Systeme
- Hintergründe
- Geschichtliche und Gesellschaftliche Entwicklung
- Selbstverständnis der neuen Autoren
- Emotionalität durch Recherche
- Szenen statt Fakten
- Fokussierung der Unbekannten
- Methodik - New Journalism als Grenzgänger zwischen Journalismus und Literatur
- Techniken des New Journalism
- Themen des New Journalism
- Darstellungsformen des New Journalism
- Kritische Betrachtung
- Ideologiekriege
- Fakt oder Fiktion
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist eine kritische Betrachtung des Phänomens New Journalism und die Frage, inwieweit diese Richtung ihrer selbstgestellten Aufgabe gerecht wurde. Es soll beleuchtet werden, welche Mittel eingesetzt wurden und weshalb es der New Journalism nicht schaffte, sich dauerhaft zu etablieren.
- Definition und Einordnung des New Journalism
- Ursachen für die Entstehung und Entwicklung des New Journalism
- Techniken und Themen des New Journalism
- Kritische Aspekte des New Journalism
- Bewertung der Nachhaltigkeit des New Journalism
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den New Journalism als journalistisch-literarische Strömung vor, die in den 1960er und 1970er Jahren in den USA für Aufsehen sorgte. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich der New Journalism von traditionellen Formen des Journalismus abgrenzt und welche Auswirkungen er auf den Journalismus hatte.
- Hintergründe: Dieser Abschnitt beleuchtet die geschichtlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die zur Entstehung des New Journalism führten. Darüber hinaus wird das Selbstverständnis der neuen Autoren diskutiert, die die strikte Trennung von Fakten und Fiktion aufbrachen und neue Techniken aus der Literatur in ihre journalistische Arbeit einbezogen.
- Methodik - New Journalism als Grenzgänger zwischen Journalismus und Literatur: Dieser Abschnitt untersucht die spezifischen Techniken, Themen und Darstellungsformen, die den New Journalism charakterisieren. Es wird analysiert, wie die neuen Autoren literarische Elemente in ihre journalistischen Arbeiten integrierten und so eine neue Form der Berichterstattung schufen.
- Kritische Betrachtung: Dieser Abschnitt beleuchtet die Kontroversen und Debatten, die der New Journalism auslöste. Es wird diskutiert, inwieweit der New Journalism tatsächlich eine „neue“ Form des Journalismus darstellte und welche Auswirkungen er auf das Verständnis von Objektivität im Journalismus hatte.
Schlüsselwörter
New Journalism, Literatur, Journalismus, Fakten, Fiktion, Objektivität, Techniken, Themen, Darstellungsformen, Kritik, Kontroversen, Objektivitätsbegriff, Amerikanisches Mediensystem
- Quote paper
- Katja Gläss (Author), 2005, Zwischen Fiktion und Fakten. Eine Analyse des Phänomens 'New Journalism' im amerikanischen Journalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46013