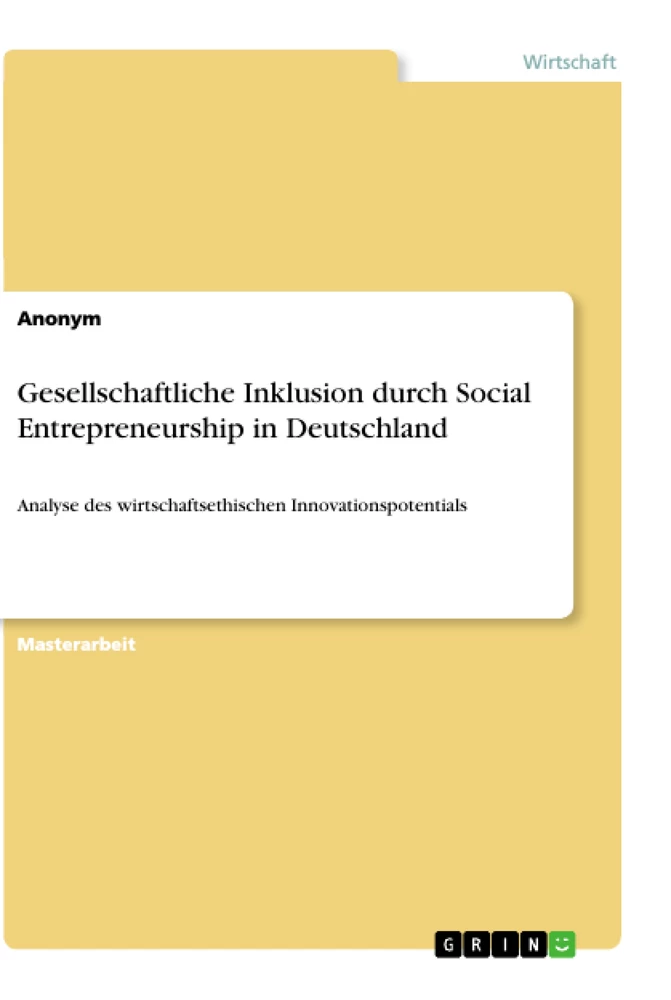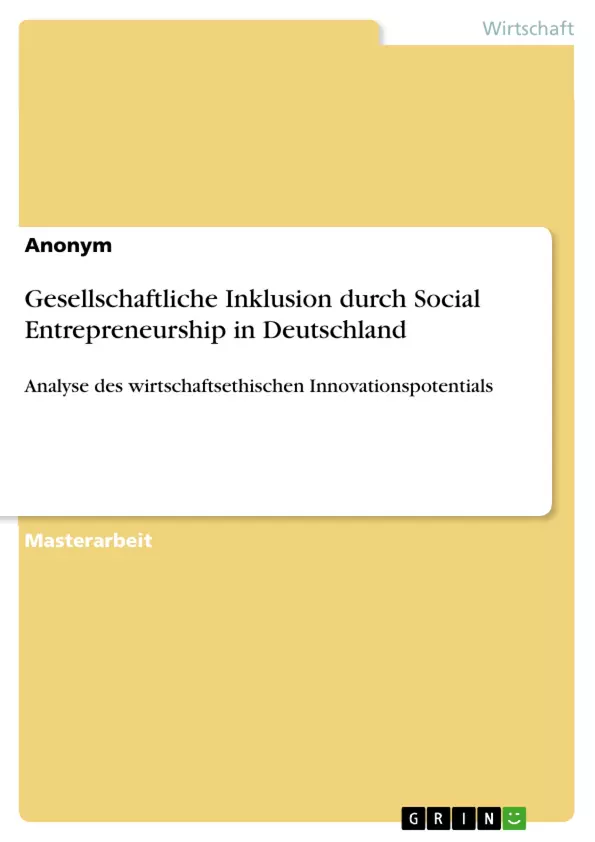Die vorliegende Arbeit untersucht das Phänomen Social Entrepreneurship in Deutschland. Die Begrenzung auf den Standort Deutschland wurde vorgenommen, weil sich die Bundesrepublik Deutschland durch individuelle Standortfaktoren auszeichnet und so eine Vergleichbarkeit der Modelle innerhalb des nationalen Kontexts gegeben ist.
Ziel der Arbeit ist es, dem Konzept Social Entrepreneurship anhand von Kernmerkmalen auf den Grund zu gehen und sich nach der theoretischen Kenntnis des Konzeptes, erfolgreichen Sozialunternehmen aus der Praxis zuzuwenden. Die Begutachtung ausgewählter Fallbeispiele beabsichtigt, ein Verständnis für die Besonderheiten der sozialunternehmerischen Herangehensweise zu erlangen.
Zur Erreichung dieses Verständnisses sollen insbesondere die Innovativität der Sozialunternehmen und deren konkrete Dimensionen eruiert werden. Als weiteren Untersuchungsschwerpunkt widmet sich die Arbeit der ethischen Dimension des SE-Phänomens, wobei vor allem Bezug auf das Prinzip der Anerkennung genommen wird. Es soll dabei erfasst werden, in welcher Form sich Sozialunternehmen der Thematik Inklusion widmen und ob sich in den Konzepten normative Risiken erkennen lassen.
Aus den Ergebnissen lässt sich schließlich ableiten, welches wirtschaftsethische Potential zur Inklusion von Minderheiten in den Initiativen von Social Entrepreneurs zu finden ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Motivation und Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2. Social Entrepreneurship: Begriffsklärung und Gegebenheiten in Deutschland
- 2.1 Geschichtliche Einordnung des Phänomens
- 2.1.1 Historische Beispiele
- 2.1.2 Entwicklung in der Wissenschaft, Praxis und der Öffentlichkeit
- 2.2 Definitionen von Social Entrepreneurship
- 2.2.1 Definitionsüberblick und Analyse
- 2.2.2 Merkmal #1: Unternehmerisches Handeln
- 2.2.3 Merkmal #2: Social Value
- 2.2.4 Merkmal #3: Innovation
- 2.2.5 Exkurs: Verwandte Begriffe und weitere soziale Organisationsformen
- 2.3 Zwischenfazit und Arbeitsdefinition
- 2.4 Gegebenheiten in Deutschland
- 2.4.1 Tätigkeitsfelder von Sozialunternehmen
- 2.4.2 Deutsche Sozialpolitik und der Dritte Sektor
- 2.4.3 Möglichkeiten der Rechtsform
- 2.4.4 Möglichkeiten der Finanzierung
- 2.4.5 Zwischenfazit
- 3. Analyserahmen
- 3.1 Methodik und Auswahl der Organisationen
- 3.2 Bestimmung des Innovationspotentials
- 3.3 Social Entrepreneurship und Ethik
- 3.4 Inklusion und Ethik
- 3.4.1 Zum Inklusionsbegriff
- 3.4.2 Zur Bedeutung von Anerkennung und Freiheit
- 3.4.3 Von der Fürsorge zur Autonomie
- 4. Fallanalysen
- 4.1 auticon
- 4.1.1 Unternehmensprofil auticon
- 4.1.2 Innovationsanalyse auticon
- 4.2 discovering hands
- 4.2.1 Unternehmensprofil discovering hands
- 4.2.2 Innovationsanalyse discovering hands
- 4.3 Dialog im Dunkeln
- 4.3.1 Unternehmensprofil Dialog im Dunkeln
- 4.3.2 Innovationsanalyse Dialog im Dunkeln
- 4.4 Verba Voice
- 4.4.1 Unternehmensprofil VerbaVoice
- 4.4.2 Innovationsanalyse VerbaVoice
- 4.5 Zusammenfassung Innovativität
- 4.6 Ethische Analyse
- 4.6.1 Stärken im Hinblick auf Inklusion
- 4.6.2 Risiken im Hinblick auf Inklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert das wirtschaftsethische Innovationspotential von Social Entrepreneurship in Deutschland. Im Zentrum steht die Frage, wie Social Entrepreneurship zur gesellschaftlichen Inklusion beitragen kann. Dabei werden die wichtigsten Definitionen und Merkmale von Social Entrepreneurship sowie die relevanten Akteure und Strukturen in Deutschland beleuchtet. Die Arbeit untersucht die Innovationspotenziale von ausgewählten Social Entrepreneurship-Organisationen und analysiert deren ethische Dimension im Hinblick auf Inklusion.
- Begriffsbestimmung und Entwicklung von Social Entrepreneurship
- Soziales Unternehmertum in Deutschland: Rahmenbedingungen und Akteure
- Analyse des Innovationspotentials von Social Entrepreneurship-Organisationen
- Die ethische Dimension von Social Entrepreneurship im Hinblick auf Inklusion
- Zusammenhänge zwischen Social Entrepreneurship und gesellschaftlicher Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Motivation und Problemstellung der Arbeit vor und erläutert die Forschungsfrage sowie die gewählte Vorgehensweise.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel wird der Begriff Social Entrepreneurship definiert und seine Entwicklung in Deutschland beleuchtet. Die verschiedenen Definitionen werden analysiert und die wichtigsten Merkmale des Phänomens herausgearbeitet.
- Kapitel 3: Der Analyserahmen der Arbeit wird vorgestellt. Es werden die Methodik der Untersuchung, die Auswahl der Organisationen und die Definition des Innovationspotentials erläutert. Des Weiteren werden die ethischen Dimensionen von Social Entrepreneurship und Inklusion beleuchtet.
- Kapitel 4: Die Fallanalysen stellen vier ausgewählte Social Entrepreneurship-Organisationen vor. Für jede Organisation werden das Unternehmensprofil, die Innovationsanalyse und die ethische Analyse im Hinblick auf Inklusion dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Social Entrepreneurship, Inklusion, Innovation, Wirtschaftsethik, Deutschland, Fallanalysen, Social Value, Unternehmensprofile, ethische Analyse und gesellschaftliche Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Social Entrepreneurship (SE)?
Social Entrepreneurship bezeichnet unternehmerisches Handeln, das primär auf die Lösung gesellschaftlicher Probleme und die Schaffung von "Social Value" (sozialem Wert) statt auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist.
Wie fördert Social Entrepreneurship die Inklusion?
Sozialunternehmen entwickeln innovative Geschäftsmodelle, die Minderheiten (z.B. Menschen mit Autismus oder Sehbehinderung) aktiv in den Arbeitsmarkt integrieren und ihre Autonomie stärken.
Welche Fallbeispiele werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert vier deutsche Organisationen: auticon, discovering hands, Dialog im Dunkeln und VerbaVoice.
Welche Rolle spielt die Innovation bei Sozialunternehmen?
Innovation ist ein Kernmerkmal von SE. Es geht darum, neue Wege zu finden, um gesellschaftliche Herausforderungen effizienter zu lösen als traditionelle wohlfahrtsstaatliche Ansätze.
Gibt es ethische Risiken beim Social Entrepreneurship?
Ja, die Arbeit untersucht auch normative Risiken, wie etwa die Gefahr, dass Inklusion nur unter wirtschaftlichen Verwertungsaspekten betrachtet wird.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Gesellschaftliche Inklusion durch Social Entrepreneurship in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/460509