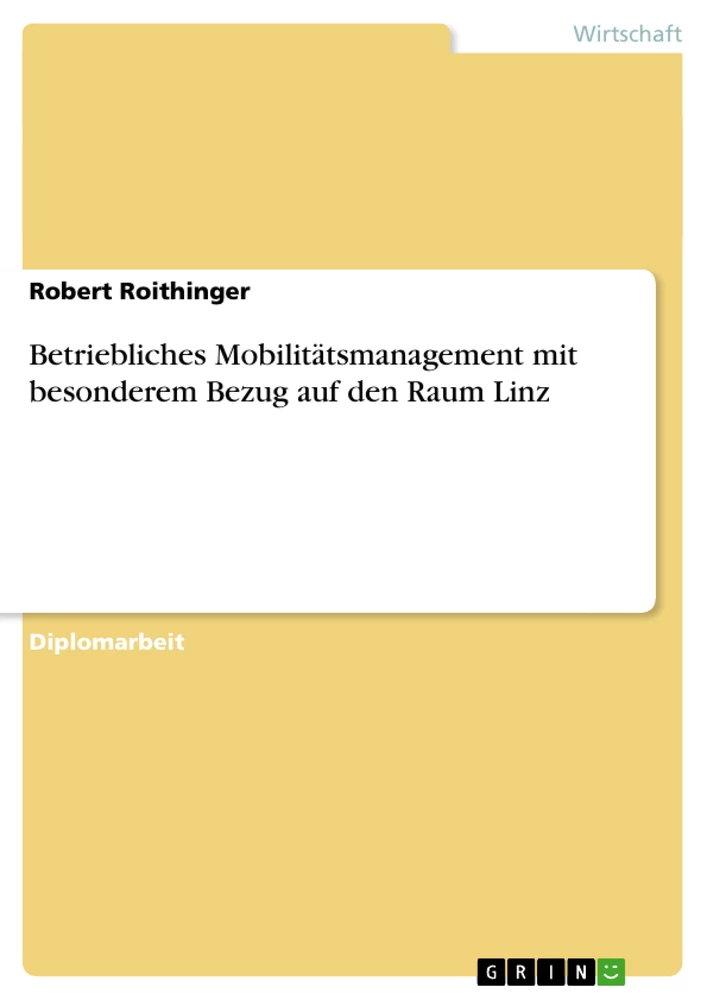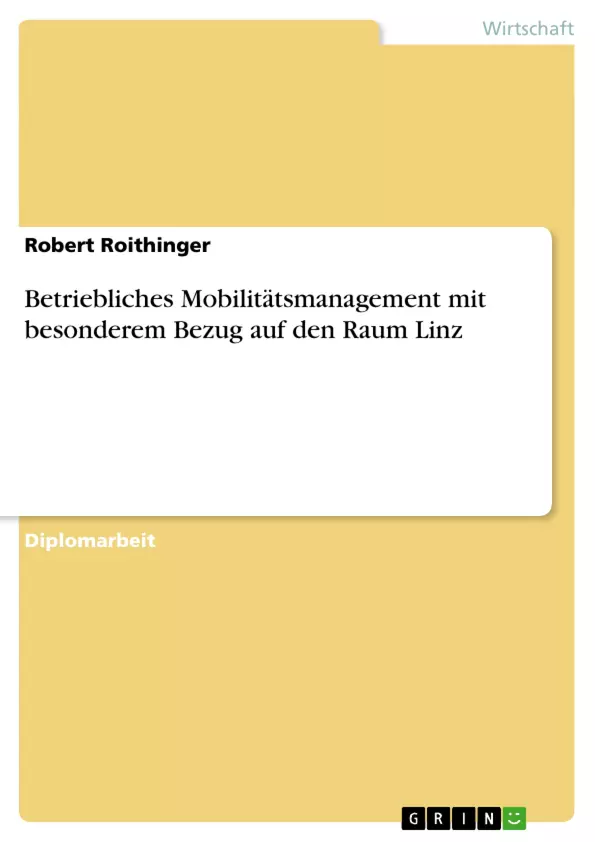Die Stadt Linz bietet beinahe doppelt so vielen Beschäftigten einen Arbeitsplatz, als wie sie selbst beherbergt, das heißt in Linz verdoppelt sich die Anzahl der werktags anwesenden Beschäftigten aufgrund der vielen Einpendler aus den angrenzenden Bezirken (Linz-Land und Urfahr-Umgebung). Gut zwei Drittel der Einpendler verwenden für die Anreise zur Arbeitsstätte nach Linz das Auto.2 Die Folgen sind gerade in den Hauptverkehrszeiten Kapazitätsengpässe in der Verkehrsinfrastruktur (Staus, Parkplatzmangel) und Belastung von Mensch und Umwelt, da trotz aktueller Tendenzen zur Arbeitszeitflexibilisierung Wege zur und von der Arbeit weitgehend während der morgendlichen und nachmittäglichen Stauzeiten zurückgelegt werden. Gerade für die Stadt Linz, die über keinen Autobahnring oder eine Umfahrung in Nord-Süd Richtung verfügt, bedeutet diese Tatsache zweimal täglich einen Verkehrskollaps mit den neuralgischen Punkten Autobahnknoten A1/A7 im Süden, der Einmündung der A7 in das Stadtgebiet von Linz im Norden und den Knoten Bindermichl im Zentrum der Stadt. Durch den derzeitigen Neubau des Knoten Bindermichl könnte in der nahen Zukunft ein Staupunkt neutralisiert werden. Weitere Zahlen und Erläuterungen zur Verkehrssituation in und um Linz werden in Kapitel 6.1. besprochen. In Österreich ist in den letzten zehn Jahren der Autoanteil im Arbeitspendlerverkehr weiter dramatisch angestiegen.3 Mehr als 60 % der Arbeitspendler fahren heute bereits per Auto zu ihren Arbeitsplatz, während die Anteile der öffentlichen Verkehrsmittel weiter zurückgegangen sind.4
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. AUFGABENSTELLUNG UND ZIELSETZUNG
- 1.2. AUFBAU UND STRUKTUR DER ARBEIT
- 2. BEDEUTUNG U. ZIELE D. BETRIEBLICHEN MOBILITÄTSMANAGEMENTS
- 2.1. WAS IST BETRIEBLICHES MOBILITÄTSMANAGEMENT?
- 2.1.1. Mobilität
- 2.1.2. Mobilitätsmanagement
- 2.1.3. Betriebliches Mobilitätsmanagement
- 2.2. ENTWICKLUNG DES BETRIEBLICHEN MOBILITÄTSMANAGEMENTS
- 2.3. STATUS QUO DES PERSONENVERKEHRS IN ÖSTERREICH
- 2.4. AUSWIRKUNGEN DES VERKEHRS AUF MENSCH UND UMWELT
- 2.4.1. Historische Entwicklung
- 2.4.2. Das Kyoto-Protokoll
- 2.4.3. Emissionen von Luftschadstoffen nach Emittentengruppen
- 2.4.3.1. Stickoxide (NOx)
- 2.4.3.2. Kohlendioxid (CO2)
- 2.4.3.3. Kohlenmonoxid (CO)
- 2.4.3.4. Schwefeldioxid (SO2)
- 2.4.4. Entwicklungstendenzen
- 2.5. EINFLUSSFAKTOREN AUF die VerkehRSMITTELWAHL
- 2.5.1. Zeitaufwand
- 2.5.2. Bequemlichkeit
- 2.5.3. Persönliche Einstellungen und Vorbilder
- 2.5.4. Parkplatzangebot
- 2.6. KOSTEN/NUTZEN VON BETRIEBLICHEN MOBILITÄTSMANAGEMENT
- 2.6.1. Kostenersparnisse
- 2.6.2. Bessere Erreichbarkeit
- 2.6.3. Höhere Mitarbeitermotivation
- 2.6.4. Umweltvorteile
- 2.6.5. Imagegewinn
- 3. UMSETZUNG DES BETRIEBLICHEN MOBILITÄTSMANAGEMENTS
- 3.1. WANN FÜHRT MAN BETRIEBLICHES MOBILITÄTSMANAGEMENT EIN?
- 3.2. DURCHFÜHRUNG DES BETRIEBLICHEN MOBILITÄTSMANAGEMENTS
- 3.2.1. Aktionsorientierte Methode vs. Integrale Methode
- 3.2.2. Ablauf des Betrieblichen Mobilitätsmanagements
- 3.2.3. Kommunikation - Motivation – Information
- 3.2.4. Projektorganisation
- 3.2.5. Datenerhebung
- 3.2.5.1. Daten zum Mobilitätsverhalten der Mitarbeiter
- 3.2.5.2. Daten der betrieblichen Rahmenbedingungen
- 3.2.5.3. Daten zum Verkehrsangebot bzw. Daten zum Betriebsumfeld
- 3.2.6. Datenauswertung
- 3.2.7. Abschätzung der Verlagerungspotentiale
- 3.2.8. Zielfestlegung
- 3.2.9. Ausarbeitung und Umsetzung der Maßnahmenbündel
- 3.2.10. Evaluierung und dauerhafte Implementierung
- 3.2.11. Begleitende Öffentlichkeitsarbeit
- 3.3. DER ÖSTERREICHISCHE WEG - 1997 BIS 2004
- 3.3.1. Die,,sanfte Mobilitätspartnerschaft“
- 3.3.2. Das Klima:aktiv Programm „Betriebliches Mobilitätsmanagement“
- 3.4. HANDLUNGSSPIELRAUM IN DER PRAXIS
- 4. INSTRUMENTE UND MAẞNAHMEN
- 4.1. FÖRDERUNG VON ALTERNATIVEN ZUM PKW
- 4.1.1. Verbesserung des ÖPNV
- 4.1.1.1. Das Jobticket
- 4.1.1.2. Mängel im Verkehrsangebot beheben
- 4.1.1.3. Der Werkverkehr
- 4.1.2. Zu Fuß gehen und Fahrrad fahren erleichtern
- 4.1.2.1. Zu Fuß gehen
- 4.1.2.2. Fahrrad fahren
- 4.2. MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR
- 4.2.1. Parkplatzmanagement
- 4.2.2. Fahrgemeinschaften
- 4.2.3. Car-Sharing
- 4.3. INFORMATION UND MOTIVATION DER MITARBEITER
- 4.4. GESCHÄFTSREISEMANAGEMENT
- 4.5. ARBEITSORGANISATION
- 5. AUSGEWÄHLTE ERFAHRUNGEN AUS DEM AUSLAND
- 5.1. DAS,,MUSTERLAND“ NIEDERLANDE
- 5.1.1. Vorgehen in den Niederlanden
- 5.1.2. Der „ABC - Plan der Standortentwicklung“
- 5.2. GROBBRITANNIEN
- 5.3. STAND UND ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND
- 5.4. ITALIEN
- 5.5. BELGIEN
- 5.6. USA - KALIFORNIEN
- 6. BETRIEBLICHES MOBILITÄTSMANAGEMENT IM RAUM LINZ
- 6.1. DIE VERKEHRSSITUATION IN DER STADT LINZ
- 6.1.1. Massenindividualverkehr
- 6.1.2. Öffentlicher Verkehr
- 6.1.3. Arbeits- und Pendlersituation
- 6.1.4. Das Linzer Verkehrskonzept
- 6.2. DIE LINZER MOBILITÄTSBERATUNG
- 6.2.1. Betriebliche Mobilitätsberatungen
- 6.2.1.1. Erste Betriebsberatungen 2001/2002 - 6 Betriebe
- 6.2.1.2. Zweite Staffel der Betriebsberatungen ab Sommer 2002 – 7 Betriebe
- 6.2.1.3. Gesundheitscoaching
- 6.2.1.4. Ergebnisse der Betriebsberatungen
- 6.2.2. Hausinterne Mobilitätsprojekte beim Magistrat Linz
- 6.3. DAS LAND OBERÖSTERREICH
- 7. SCHLUSSBETRACHTUNG & EMPFEHLUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema des Betrieblichen Mobilitätsmanagements, insbesondere im Raum Linz. Sie analysiert die Bedeutung und Ziele des Betrieblichen Mobilitätsmanagements sowie die aktuellen Herausforderungen und Chancen in Österreich und im internationalen Kontext.
- Entwicklung und Bedeutung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements
- Einflussfaktoren auf die Verkehrsmittelwahl
- Kosten und Nutzen von Betrieblichem Mobilitätsmanagement
- Umsetzung und Erfolgsfaktoren von Betrieblichem Mobilitätsmanagement
- Erfahrungen aus dem In- und Ausland
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Aufgabenstellung und Zielsetzung der Arbeit vor und erläutert den Aufbau und die Struktur der Arbeit.
- Kapitel 2: Bedeutung und Ziele des Betrieblichen Mobilitätsmanagements: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Betrieblichen Mobilitätsmanagements und beleuchtet dessen Entwicklung sowie den Status quo des Personenverkehrs in Österreich. Zudem werden die Auswirkungen des Verkehrs auf Mensch und Umwelt analysiert.
- Kapitel 3: Umsetzung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements: Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der praktischen Umsetzung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements. Es werden unterschiedliche Methoden zur Durchführung des Managements vorgestellt, sowie wichtige Schritte wie Datenerhebung, Zielfestlegung und Evaluation erläutert.
- Kapitel 4: Instrumente und Maßnahmen: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Instrumente und Maßnahmen, die im Rahmen des Betrieblichen Mobilitätsmanagements eingesetzt werden können. Der Fokus liegt auf der Förderung von Alternativen zum PKW, dem Parkplatzmanagement und der Information sowie Motivation der Mitarbeiter.
- Kapitel 5: Erfahrungen aus dem Ausland: Dieses Kapitel gibt Einblicke in die Praxis des Betrieblichen Mobilitätsmanagements in verschiedenen Ländern, wie z.B. den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland und den USA.
- Kapitel 6: Betriebliches Mobilitätsmanagement im Raum Linz: Das Kapitel widmet sich der spezifischen Verkehrssituation in Linz und stellt die Linzer Mobilitätsberatung vor, die Unternehmen bei der Einführung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements unterstützt.
Schlüsselwörter
Betriebliches Mobilitätsmanagement, Verkehr, Umwelt, Nachhaltigkeit, Mobilitätsverhalten, Pendler, ÖPNV, Mitarbeitermotivation, Kostenersparnisse, Parkplatzmanagement, Fahrgemeinschaften, Car-Sharing, Linz, Österreich
Häufig gestellte Fragen
Was ist betriebliches Mobilitätsmanagement?
Es umfasst Maßnahmen von Unternehmen, um den Berufs- und Pendlerverkehr effizienter, umweltfreundlicher und kostensparender zu gestalten, etwa durch Förderung von ÖPNV, Fahrgemeinschaften oder Radverkehr.
Warum ist das Thema für die Stadt Linz besonders relevant?
Linz hat fast doppelt so viele Beschäftigte wie Einwohner. Da zwei Drittel der Einpendler das Auto nutzen, kommt es täglich zu massiven Kapazitätsengpässen und Staus an Knotenpunkten wie dem Bindermichl.
Welche Instrumente können Unternehmen einsetzen?
Zu den Instrumenten gehören das „Jobticket“, Parkplatzmanagement, die Förderung von Car-Sharing, die Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer sowie flexibles Geschäftsreisemanagement.
Welchen Nutzen hat ein Betrieb von Mobilitätsmanagement?
Betriebe profitieren von Kostenersparnissen (z. B. weniger Parkplatzbau), besserer Erreichbarkeit, höherer Mitarbeitermotivation, Imagegewinn und einem Beitrag zum Umweltschutz.
Was ist das „Klima:aktiv“ Programm?
Es ist ein österreichisches Programm, das Betriebe bei der Umsetzung von Mobilitätsprojekten unterstützt, um die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken.
- Arbeit zitieren
- Robert Roithinger (Autor:in), 2005, Betriebliches Mobilitätsmanagement mit besonderem Bezug auf den Raum Linz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46060