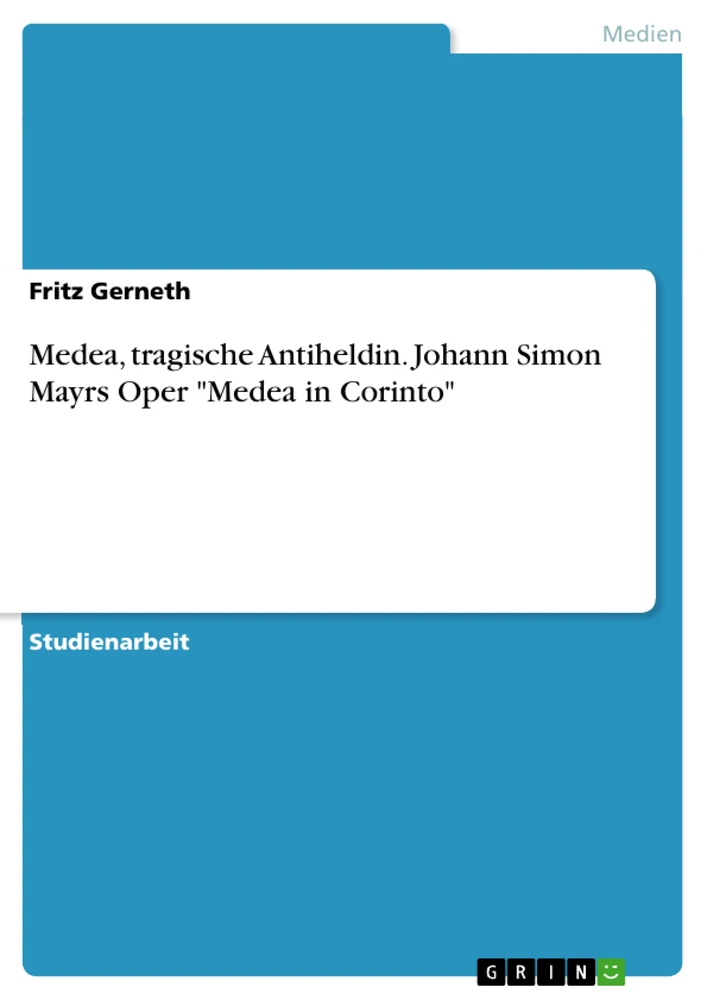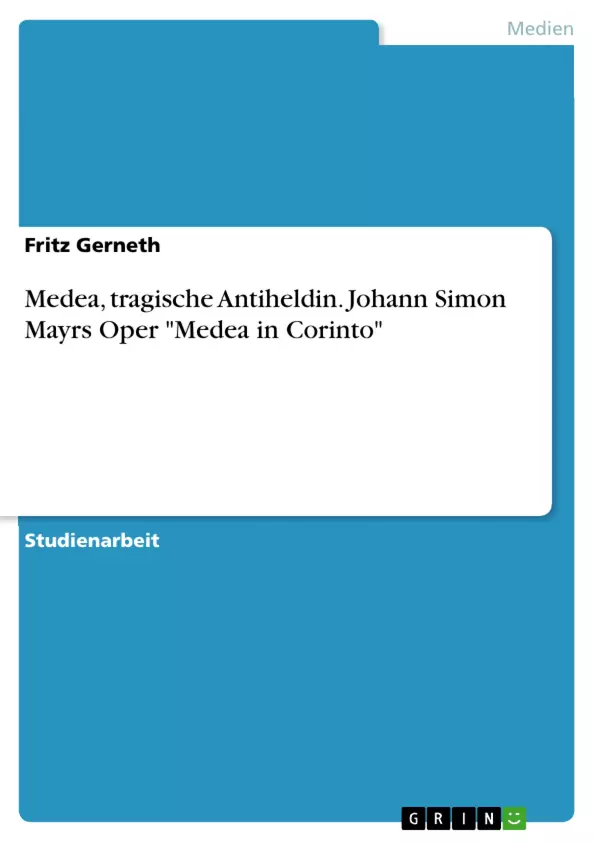Die düstere Gestalt der kinder-mordenden Mutter Medea, die trotz der Schrecklichkeit ihrer Tat nicht frei von menschlichen Zügen ist, erfuhr in mehr als 2000 Jahren eine Fülle an Bearbeitungen. Es erstaunt auf den ersten Blick, dass trotz dieser intensiven Auseinandersetzung mit dem Medea-Mythos erst spät, 1813, eine italienische Oper seria mit Medea als Hauptfigur entstand. In dieser Arbeit soll gezeigt werden, dass die metastasianische Oper weder in ihrer sozialen Funktion, noch in ihrer Ästhetik der Künstlichkeit, noch in ihrer starren Form geeignet war, das widersprüchliche, irrationale Wesen der Medea zu vermitteln. Schlaglichtartig werden Entwicklungen der italienischen Oper im ausklingenden 18. Jahrhunderts aufgezeigt, die schließlich Simon Mayr die Mittel in die Hand gaben, die zerrissene Gefühlswelt der Medea musikalisch überzeugend umzusetzen und einem, am Vorabend der Epoche der Romantik ebenfalls gewandelten, Publikum nahe zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Medea - ein geeigneter Stoff für eine Opera seria?
- 1.1. Ein Gegenentwurf zum metastasianischen Ideal
- 1.2. Ästhetische und moralische Erwartungshaltung des Publikums
- 2. Die neapolitanische Oper zur Zeit Mayrs
- 2.1. Opernreformen des 18. Jahrhunderts
- 2.2. Der Wandel der Opernarie
- 3. Mayrs Oper Medea in Corinto
- 4. Der Auftritt Medeas - eine Charakterstudie
- 4.1. Aufbau der erweiterten Auftrittsszene Medeas
- 4.2. Medea vor und nach der Überbringung des Verbannungsspruches
- 4.3. Die Vertonung des Gebets - die Arie „Sommi dei“
- 4.4. Das Bild Medeas als Ergebnis der eingesetzten musikalischen Mittel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht die Oper "Medea in Corinto" von Johann Simon Mayr und analysiert, warum dieser mythologische Stoff erst spät im 18. Jahrhundert als Oper seria verarbeitet wurde. Der Aufsatz beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus den konventionellen Erwartungen der metastasianischen Oper ergaben und wie Mayr diese mit den veränderten musikalischen und gesellschaftlichen Bedingungen seiner Zeit meisterte.
- Die Eignung des Medea-Mythos für die Opera seria im Kontext des metastasianischen Ideals
- Die ästhetischen und moralischen Erwartungen des Publikums an die Opera seria
- Die Entwicklungen der italienischen Oper im späten 18. Jahrhundert
- Die musikalische Umsetzung der zerrissenen Gefühlswelt Medeas in Mayrs Oper
- Die Darstellung Medeas als tragische Antiheldin
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die vielfältigen Bearbeitungen des Medea-Mythos ein und stellt die Frage, warum erst 1813 mit Mayrs "Medea in Corinto" eine italienische Oper seria zu diesem Stoff entstand, obwohl mythologische Stoffe im 18. Jahrhundert in der Opera seria weit verbreitet waren. Der Aufsatz kündigt die Untersuchung der Ungeeignetheit des metastasianischen Opernstils für die Darstellung der komplexen Figur Medeas an und verspricht, die Entwicklungen aufzuzeigen, die Mayr die Mittel gaben, Medeas Gefühlswelt musikalisch umzusetzen.
1. Medea - ein geeigneter Stoff für eine Opera seria?: Dieses Kapitel untersucht die grundlegende Frage nach der Vereinbarkeit des Medea-Mythos mit den Konventionen der Opera seria, insbesondere im Hinblick auf das metastasianische Ideal. Es wird argumentiert, dass Medeas irrationales und widersprüchliches Wesen im Gegensatz zu den rationalen und idealisierten Figuren der metastasianischen Oper steht. Die emotional getriebene, von Rache und Leidenschaften bestimmte Medea passt nicht zum rationalen Kalkül der metastasianischen Ästhetik.
2. Die neapolitanische Oper zur Zeit Mayrs: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel der neapolitanischen Oper im ausklingenden 18. Jahrhundert. Es beschreibt die Opernreformen und den Wandel der Opernarie, die Mayr schließlich die Mittel an die Hand gaben, um Medeas zerrissene Gefühlswelt musikalisch darzustellen. Es wird gezeigt, dass die Entwicklungen der italienischen Oper im 18. Jahrhundert eine neue Grundlage für die Vertonung eines komplexen und emotional vielschichtigen Charakters wie Medea schufen.
3. Mayrs Oper Medea in Corinto: Das Kapitel bietet einen Überblick über Mayrs Oper "Medea in Corinto" selbst und liefert Kontextinformationen über die Quellenlage und die Herausforderungen, die mit der Auswahl und Beurteilung der Quellen verbunden waren. Es stellt die verwendeten Quellen und das verwendete Notenmaterial vor, um die Grundlage der weiteren Analyse zu erläutern.
4. Der Auftritt Medeas - eine Charakterstudie: Dieses Kapitel analysiert den Auftritt Medeas als zentrale Szene der Oper. Es untersucht den Aufbau der Szene, Medeas Zustand vor und nach der Verkündung des Verbannungsspruches sowie die musikalische Gestaltung ihres Gebets. Die Analyse konzentriert sich auf die verwendeten musikalischen Mittel und wie diese dazu beitragen, Medeas Charakter und ihre Gefühlswelt zu vermitteln. Das Kapitel untersucht, wie Mayrs musikalische Gestaltung das Bild Medeas als tragische Antiheldin prägt.
Schlüsselwörter
Medea, Opera seria, Johann Simon Mayr, Metastasio, Neapolitanische Oper, Opernreformen 18. Jahrhundert, tragische Antiheldin, musikalische Gestaltung, Gefühlswelt, Rache, Mythos.
Häufig gestellte Fragen zu "Medea in Corinto" von Johann Simon Mayr
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Johann Simon Mayrs Oper "Medea in Corinto" und untersucht, warum dieser mythologische Stoff erst spät im 18. Jahrhundert als Oper seria verarbeitet wurde. Im Fokus steht die Auseinandersetzung mit den konventionellen Erwartungen der metastasianischen Oper und wie Mayr diese mit den veränderten musikalischen und gesellschaftlichen Bedingungen seiner Zeit meisterte. Die Arbeit beinhaltet eine detaillierte Analyse der Oper, insbesondere der Darstellung Medeas als tragische Antiheldin.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Eignung des Medea-Mythos für die Opera seria im Kontext des metastasianischen Ideals; die ästhetischen und moralischen Erwartungen des Publikums an die Opera seria; die Entwicklungen der italienischen Oper im späten 18. Jahrhundert; die musikalische Umsetzung der zerrissenen Gefühlswelt Medeas in Mayrs Oper; und die Darstellung Medeas als tragische Antiheldin.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung: Einführung in den Medea-Mythos und die Fragestellung, warum Mayrs Oper erst 1813 entstand. Kapitel 1: Untersucht die Vereinbarkeit des Medea-Mythos mit den Konventionen der Opera seria und dem metastasianischen Ideal. Kapitel 2: Beleuchtet den Wandel der neapolitanischen Oper im späten 18. Jahrhundert und die damit verbundenen Opernreformen. Kapitel 3: Bietet einen Überblick über Mayrs Oper "Medea in Corinto" selbst, einschließlich der Quellenlage und des Notenmaterials. Kapitel 4: Analysiert den Auftritt Medeas als zentrale Szene, inklusive Aufbau, Medeas Zustand vor und nach der Verbannung und die musikalische Gestaltung ihres Gebets.
Welche Rolle spielt das metastasianische Ideal?
Das metastasianische Ideal, das rationale und idealisierte Figuren in der Opera seria bevorzugte, wird als zentraler Bezugspunkt betrachtet. Die Arbeit argumentiert, dass Medeas irrationales und widersprüchliches Wesen im Gegensatz zu diesem Ideal steht und Mayr neue Wege finden musste, um diese Figur musikalisch darzustellen.
Wie wird die musikalische Gestaltung der Oper analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die verwendeten musikalischen Mittel in Mayrs Oper, insbesondere in der Schlüsselszenen des Auftritts Medeas. Es wird untersucht, wie die Musik dazu beiträgt, Medeas Charakter und ihre Gefühlswelt zu vermitteln und ihr Bild als tragische Antiheldin zu prägen. Die Arie „Sommi dei“ wird als Beispiel genauer betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Medea, Opera seria, Johann Simon Mayr, Metastasio, Neapolitanische Oper, Opernreformen 18. Jahrhundert, tragische Antiheldin, musikalische Gestaltung, Gefühlswelt, Rache, Mythos.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich für die Oper "Medea in Corinto", die Opera seria des 18. Jahrhunderts, den Medea-Mythos und die Musikgeschichte interessiert. Sie eignet sich besonders für Studierende der Musikwissenschaft und vergleichbarer Fachgebiete.
- Citar trabajo
- Fritz Gerneth (Autor), 2017, Medea, tragische Antiheldin. Johann Simon Mayrs Oper "Medea in Corinto", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/460851