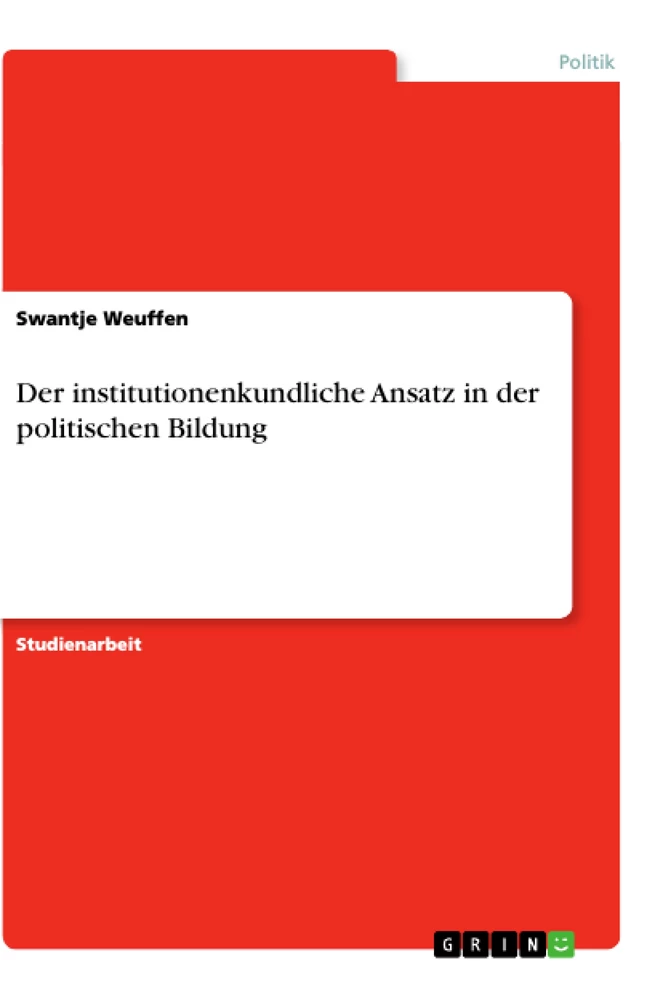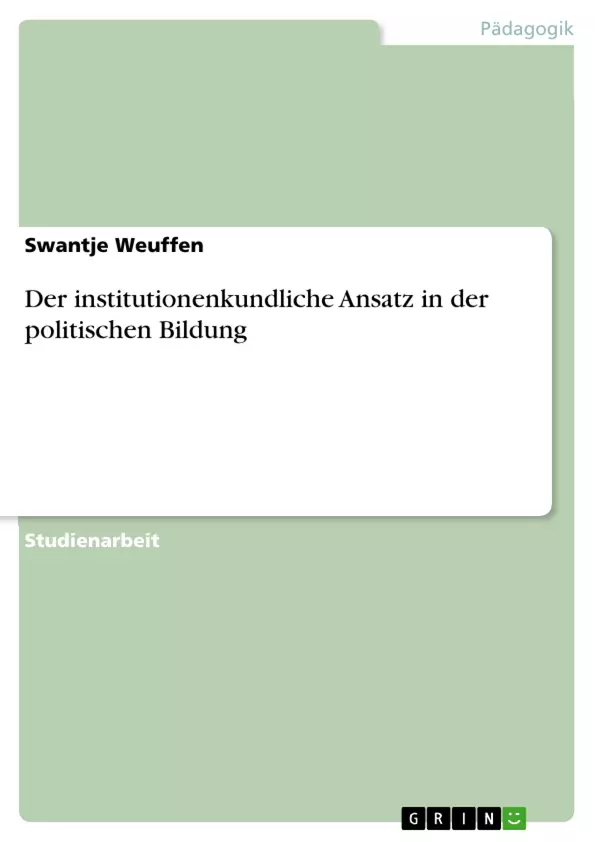Oft ist sie das, was viele Schüler mit dem Politikunterricht verbinden: die Institutionenkunde. Vielfach kritisiert und doch nicht aus dem deutschen Bildungssystem wegzudenken, spaltet sie die Gemüter. Das Ziel des Politikunterrichts in der Schule sei die Befähigung und Aktivierung der jungen Menschen zum Bürgersein, wird vielfach so schön gesagt. Doch was bedeutet das überhaupt? Dieser Frage stellt sich die vorliegende Arbeit und wird dabei einen modernen Ansatz vorstellen, wie Institutionenlehre tatsächlich Schülerinnen und Schüler zum eigenen politischen Handeln motivieren und heranbilden kann. Dieser Ansatz zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er eine Brücke zwischen der Alltagswelt der Lernenden und der Politik herstellt. Zunächst wird das Problem der Distanz zwischen dem Lerner und dem Lernstoff beleuchtet und anschließend der institutionenkundliche Ansatz in seinen verschiedenen Teilaspekten näher vorgestellt. Aufbauend auf der theoretischen Grundlage der Arbeit wird abschließend ein Praxisbeispiel für die Umsetzung im Unterricht gezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Distanz zwischen Lernstoff und Adressat
- Mehrdimensionalität als Bindeglied
- Die Dimensionen der politischen Realität
- Interdependenz der Politik im Fokus des Unterrichts
- Herausbildung eines Deutungs- und Ordnungswissens
- Didaktische Struktur
- Strategien zur Reduktion der Distanz
- Zwei Perspektiven des Institutionenbegriffs
- Beispiel für die unterrichtspraktische Umsetzung
- Planspiel „Industrieansiedlung oder Sportanlage“?
- Außerschulischer Lernort: Kreistagssitzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der modernen Institutionenkunde im Politikunterricht und strebt an, einen Ansatz aufzuzeigen, der die Distanz zwischen dem Lernstoff und der Alltagswelt der Lernenden überwindet. Im Mittelpunkt steht die Motivation und Heranbildung junger Menschen zum eigenen politischen Handeln.
- Die Überwindung der Distanz zwischen Lernstoff und Alltagswelt der Lernenden im Politikunterricht
- Der Ansatz der mehrdimensionalen Institutionenkunde
- Die verschiedenen Dimensionen der politischen Realität: Subjektive Dimension, Dimension der gesellschaftlichen und politischen Objektivationen, Dimension der regulativen Ideen
- Die Interdependenz der drei Dimensionen im Kontext des politischen Unterrichts
- Die Bedeutung eines fundierten Demokratieverständnisses für die politische Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem der Distanz zwischen Politikunterricht und der Alltagswelt der Lernenden heraus und beleuchtet die Notwendigkeit eines modernen Ansatzes, um junge Menschen zum politischen Handeln zu motivieren.
- Die Distanz zwischen Lernstoff und Adressat: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen für die Distanz zwischen Lernstoff und Alltagswelt der Lernenden und verweist auf die geringe Wahlbeteiligung junger Menschen sowie die mangelnde politische Beteiligung.
- Mehrdimensionalität als Bindeglied: Hier wird die Bedeutung der mehrdimensionalen Institutionenkunde im Politikunterricht hervorgehoben, die die Lebenswirklichkeit der Schüler in den Vordergrund stellt und die „alte“ Institutionenkunde transformiert.
- Die Dimensionen der politischen Realität: Dieses Kapitel erläutert die drei Dimensionen der mehrdimensionalen Institutionenkunde: die subjektive Dimension, die Dimension der gesellschaftlichen und politischen Objektivationen und die Dimension der regulativen Ideen.
- Interdependenz der Politik im Fokus des Unterrichts: In diesem Kapitel wird die wechselseitige Abhängigkeit und Beeinflussung der drei Dimensionen im Kontext des Unterrichts beleuchtet und gezeigt, wie die Lernenden die Verbindung zwischen ihrer Alltagswelt und der Politik erkennen können.
Schlüsselwörter
Politikunterricht, Institutionenkunde, Distanz, Alltagswelt, Mehrdimensionalität, subjektive Dimension, gesellschaftliche und politische Objektivationen, regulative Ideen, Interdependenz, Demokratieverständnis, politische Bildung
Häufig gestellte Fragen
Warum wird klassische Institutionenkunde oft kritisiert?
Oft wird sie als trocken und fern von der Lebensrealität der Schüler empfunden, was zu Desinteresse am Politikunterricht führen kann.
Was ist der moderne institutionenkundliche Ansatz?
Er schlägt eine Brücke zwischen der Alltagswelt der Schüler und politischen Institutionen, um sie zum aktiven Bürgersein zu motivieren.
Welche Dimensionen der politischen Realität gibt es?
Man unterscheidet die subjektive Dimension, die Dimension gesellschaftlicher Objektivationen und die Dimension der regulativen Ideen.
Wie kann Politikunterricht praxisnah gestaltet werden?
Durch Methoden wie Planspiele (z.B. zur Industrieansiedlung) oder Besuche außerschulischer Lernorte wie Kreistagssitzungen.
Was ist das Ziel der politischen Bildung?
Das Ziel ist die Befähigung und Aktivierung junger Menschen zur Teilhabe an der Demokratie und zur Herausbildung eines eigenen Deutungswissens.
- Arbeit zitieren
- Swantje Weuffen (Autor:in), 2014, Der institutionenkundliche Ansatz in der politischen Bildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/460923