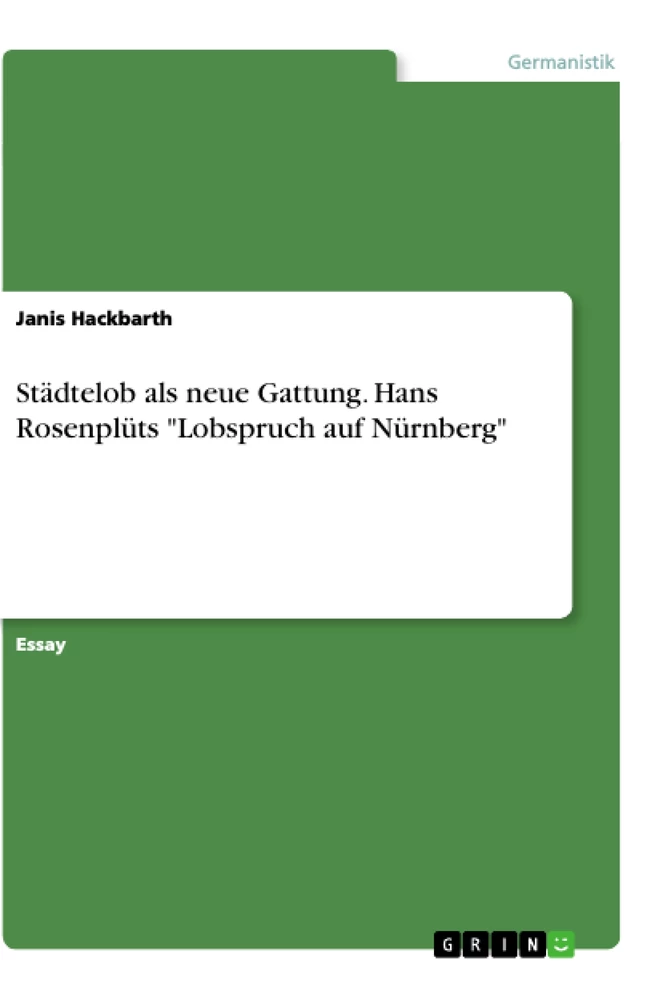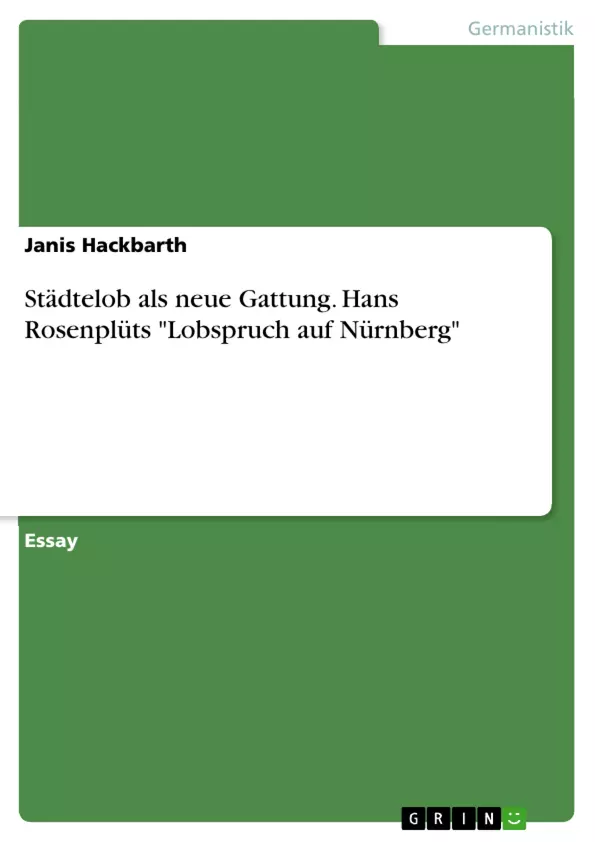Im Spätmittelalter lässt sich ab dem 15. Jahrhundert eine neue Gattung innerhalb des Sangspruches feststellen. Das Städtelob, mit dem viele kleinere und größere Städte gepriesen wurden. Hans Rosenplüt hat im „Lobspruch auf Nürnberg“ eine ausschweifende Lobpreisung in deutscher Sprache verfasst. Mit der Gattung Städtelob „{..} betritt Rosenplüt typologisch wie thematisch Neuland und ist sich dessen auch ausdrücklich bewusst.“ Mein Interesse gilt der Frage, was objektiv den Lobspruch auf Nürnberg rechtfertigt. Außerdem scheint mir wichtig zu betrachten, welchen Einfluss Rosenplüts persönliche Motive sowie seine Lebenssituation auf den Inhalt des Textes haben könnten. Interessant ist für mich auch zu untersuchen, inwieweit es Veränderungen zu frühen Form des Städtelobs der Antike gibt.
Die Analyse von, den Rahmen des Essays beachtend, exemplarischen Textauszügen wird hier Einblicke in die Welt des Stadtbürgers Rosenplüt geben. Zunächst wird die Situation Nürnbergs, eine der wirtschaftlich erfolgreichsten aufstrebenden Städte, ins Auge gefasst. Ein Blick wird auf die Geschichte des Städtelobes geworfen, um eine Entwicklung und Unterschiede zu ersten Tendenzen der Antike gegenüber dem Spätmittelalter aufzeigen zu können. Außerdem findet die Biographie Rosenplüts Beachtung, da seine soziale und gesellschaftliche Stellung vermutlich relevant für die Inhalte seines Lobspruchs sein könnten. Zuletzt folgt die Betrachtung des Lobspruchs selbst.
Inhaltsverzeichnis
- Essay zur Gattung Städtelob am Beispiel von Hans Rosenplüts „Lobspruch auf Nürnberg“
- Situation Nürnbergs
- Geschichte des Städtelobes
- Biographie Rosenplüts
- Der Lobspruch selbst
- Die Stadt Nürnberg
- Nürnberg - ein Wirtschaftszentrum
- Die Regierungsstruktur
- Hans Rosenplüt
- Lebenssituation und literarische Tätigkeit
- Dichterisches Schaffen
- Das Städtelob in der literarischen Vergangenheit
- Der „Lobspruch auf Nürnberg“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Gattung Städtelob anhand des „Lobspruchs auf Nürnberg“ von Hans Rosenplüt. Die Zielsetzung ist es, den Lobspruch im Kontext der städtischen Lebenswelt des Spätmittelalters zu analysieren und zu untersuchen, welche objektiven und persönlichen Motive den Inhalt des Textes prägten.
- Die historische und wirtschaftliche Situation Nürnbergs
- Die Entwicklung des Städtelobs von der Antike zum Spätmittelalter
- Die Rolle von Rosenplüts persönlicher Lebensgeschichte und seiner gesellschaftlichen Stellung
- Der Einfluss von Rosenplüts Arbeit als Büchsenmeister auf den Lobspruch
- Die Analyse des „Lobspruchs auf Nürnberg“ selbst, insbesondere im Hinblick auf seine Inhalte und die Darstellung der Stadt Nürnberg.
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel bietet einen Einblick in die wirtschaftliche und soziale Situation der Stadt Nürnberg im Spätmittelalter. Es werden die wichtigsten Wirtschaftsfaktoren, wie Handel, Handwerk und die Rolle des Stadtrats, beleuchtet.
- Im zweiten Kapitel wird die Biographie Hans Rosenplüts und seine Lebenssituation in Nürnberg erörtert. Es werden seine beruflichen Stationen, seine finanzielle Situation und sein gesellschaftlicher Aufstieg dargestellt.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Städtelobs von der Antike zum Spätmittelalter und stellt die Besonderheiten des Städtelobs im Kontext der Lebenswelt des 15. Jahrhunderts heraus.
- Das vierte Kapitel widmet sich dem „Lobspruch auf Nürnberg“ selbst. Es werden die wichtigsten Inhalte des Textes zusammengefasst, die Lobpreisung Nürnbergs anhand von Beispielen aus dem Text erläutert und die möglichen persönlichen Motive Rosenplüts analysiert.
Schlüsselwörter
Der Essay befasst sich mit dem Städtelob, Hans Rosenplüt, Nürnberg, Spätmittelalter, städtische Lebenswelt, Wirtschaftsgeschichte, Handwerk, Handel, gesellschaftliche Strukturen, Biographie, literarische Gattung, Lobpreisung, Motivforschung, Antike, mittelalterliche Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die literarische Gattung 'Städtelob'?
Das Städtelob ist eine im Spätmittelalter verbreitete Form des Sangspruches, in der Städte für ihren Reichtum, ihre Ordnung und ihre Schönheit gepriesen werden.
Wer war Hans Rosenplüt?
Hans Rosenplüt war ein Nürnberger Dichter und Büchsenmeister des 15. Jahrhunderts, der als einer der ersten bedeutende Städtelobe in deutscher Sprache verfasste.
Warum wurde gerade Nürnberg so stark gelobt?
Nürnberg war im Spätmittelalter ein führendes Wirtschaftszentrum mit blühendem Handwerk, Fernhandel und einer stabilen Regierungsstruktur.
Welchen persönlichen Einfluss hatte Rosenplüt auf den Text?
Seine soziale Stellung als Stadtbürger und Handwerker prägte seinen Blick auf die Stadt; er lobte besonders die technische Meisterschaft und die wirtschaftliche Stärke Nürnbergs.
Wie unterscheidet sich das mittelalterliche Städtelob von antiken Vorbildern?
Während antike Lobreden oft mythologisch oder rhetorisch-idealisiert waren, ist Rosenplüts Lobspruch stärker an der realen wirtschaftlichen und sozialen Situation der Stadt orientiert.
- Quote paper
- Janis Hackbarth (Author), 2018, Städtelob als neue Gattung. Hans Rosenplüts "Lobspruch auf Nürnberg", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461013