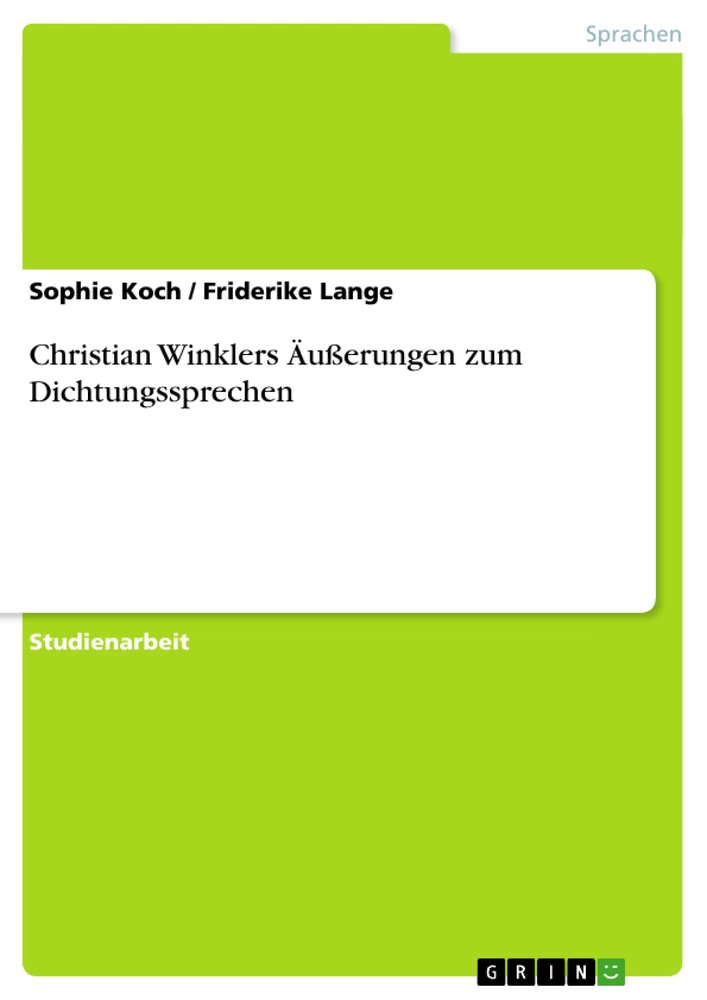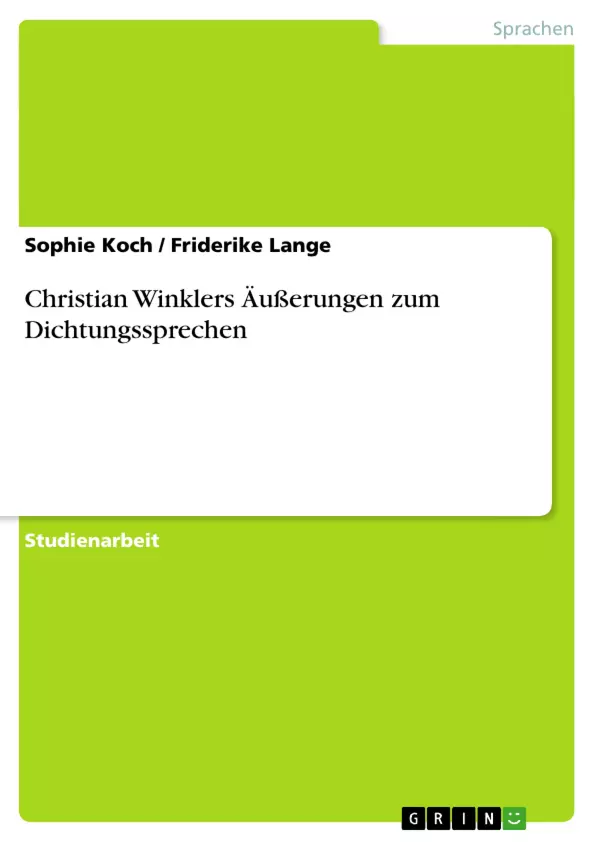Das Anliegen dieser Hausarbeit ist es, Christian Winklers Ansichten zum Dichtungssprechen zu verdeutlichen. Grundlage ist seine ‚Deutsche Sprechkunde und Sprecherziehung’ in der Erstauflage von 1954. Im Hauptteil beziehen sich alle Quellenangaben nach Zitatende auf dieses Werk.
Neben dem großen Komplex des Dichtungsvortrags hielten wir es für wichtig, eine kurze zeitliche Einordnung Winklers vorzunehmen, ebenso wie eine persönliche Stellungnahme zu seinen Konzepten. Als ein weiterer wesentlicher Punkt erschien uns seine Stellungnahme zum Textsprechen im Schulunterricht, die wir ergänzend in den Hauptteil einfügten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze zeitliche Einordnung Winklers
- Der Dichtungsvortrag
- Verstehen und Gestalten (Friderike Lange)
- Ausdruckshaltung - Redelage (Friderike Lange)
- Redelage beim Vortrag von Dramen
- Redelage beim Vortrag von Epik
- Persönliche Beurteilung Winklers aus gegenwärtiger Sicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit hat zum Ziel, Christian Winklers Ansichten zum Dichtungssprechen zu erläutern, wobei seine "Deutsche Sprechkunde und Sprecherziehung" aus dem Jahr 1954 als Grundlage dient. Der Fokus liegt dabei auf dem Dichtungsvortrag und seiner theoretischen Fundierung in Winklers Werk.
- Verstehen und Gestalten als Grundprinzipien des Dichtungsvortrags
- Bedeutung der Ausdruckshaltung und Redelage für den Vortragsakt
- Unterschiede in der Redelage beim Vortrag von Dramen und Epik
- Winklers Kritik an früheren Ansichten zum Dichtungssprechen
- Einordnung von Christian Winklers Werk in die Entwicklung der Sprechkunde
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Anliegen der Hausarbeit dar: eine Verdeutlichung von Christian Winklers Ansichten zum Dichtungssprechen. Es wird die Grundlage des Werkes "Deutsche Sprechkunde und Sprecherziehung" (1954) genannt und der Schwerpunkt auf den Dichtungsvortrag gelegt.
Kurze zeitliche Einordnung Winklers
Dieser Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über Christian Winklers Lebenswerk und seine Bedeutung für die Etablierung der Sprechkunde. Es wird sein Einfluss auf die Sprecherziehung und seine vielfältige Tätigkeit in verschiedenen Bereichen beleuchtet.
Der Dichtungsvortrag
Verstehen und Gestalten (Friderike Lange)
Dieser Abschnitt behandelt Winklers Theorie zum Dichtungsvortrag. Es wird betont, dass Verstehen und Gestalten eng miteinander verbunden sind und die Grundlage für eine erfolgreiche Vortragsgestaltung bilden. Winkler betont dabei die Wichtigkeit des lauten Sprechens bei der Texterschließung.
Ausdruckshaltung - Redelage (Friderike Lange)
Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung der Ausdruckshaltung des Sprechers im Dichtungsvortrag. Es wird deutlich, dass sowohl rationale als auch emotionale Aspekte in der Gestaltung involviert sind. Zudem wird die Rolle der Redelage und ihre Abhängigkeit vom Wissen um die Situation, aus der heraus das Gedicht entstand, dargestellt. Winklers Konzept des "Befragens" des Textes nach Drach wird vorgestellt.
Redelage beim Vortrag von Dramen
Dieser Abschnitt fokussiert auf die Besonderheiten der Redelage beim Vortrag von Dramen. Es werden unterschiedliche Auffassungen zum rollengestaltenden Vortragen von Dramen beleuchtet und Winklers Kritik an der Dramenlesung dargestellt.
Redelage beim Vortrag von Epik
Dieser Abschnitt behandelt die Redelage im Rahmen des Vortrags von Epik. Winklers Sicht auf die "natürlichste Redelage" in der Epik wird erläutert, ebenso wie die Problematik von "stummen" bzw. "erzählten" Texten.
Schlüsselwörter
Dichtungssprechen, Sprechkunde, Sprecherziehung, Dichtungsvortrag, Verstehen, Gestalten, Ausdruckshaltung, Redelage, Dramenlesung, Epik, Christian Winkler, Erich Drach, "Deutsche Sprechkunde und Sprecherziehung".
Häufig gestellte Fragen
Wer war Christian Winkler?
Christian Winkler war ein bedeutender Sprechwissenschaftler, dessen Werk „Deutsche Sprechkunde und Sprecherziehung“ (1954) die theoretische Basis für das moderne Dichtungssprechen legte.
Was bedeutet „Verstehen und Gestalten“ bei Winkler?
Diese Grundprinzipien besagen, dass ein Sprecher den Text erst tiefgreifend verstehen muss, um ihn durch Sprechgestaltung lebendig und angemessen vortragen zu können.
Was versteht man unter der „Redelage“?
Die Redelage bezeichnet die Haltung und den stimmlichen Ausdruck, den ein Sprecher einnimmt, basierend auf der Situation und der Gattung (z. B. Drama oder Epik) des Textes.
Wie unterscheidet sich der Vortrag von Dramen und Epik?
Winkler analysiert spezifische Anforderungen: Beim Drama steht oft die Rollengestaltung im Fokus, während bei der Epik die „natürlichste Redelage“ des Erzählers angestrebt wird.
Welche Bedeutung hat das Textsprechen für den Schulunterricht?
Winkler betont, dass lautes Sprechen im Unterricht hilft, Texte besser zu erschließen und die ästhetische Wahrnehmung von Literatur bei Schülern zu fördern.
- Citation du texte
- Sophie Koch (Auteur), Friderike Lange (Auteur), 2002, Christian Winklers Äußerungen zum Dichtungssprechen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46116