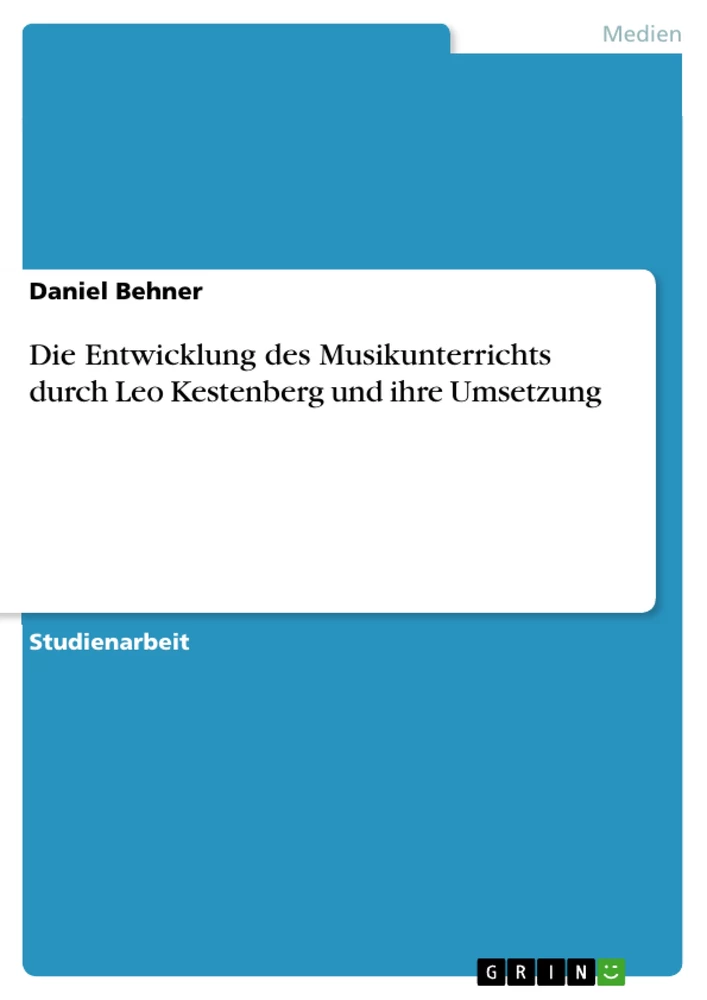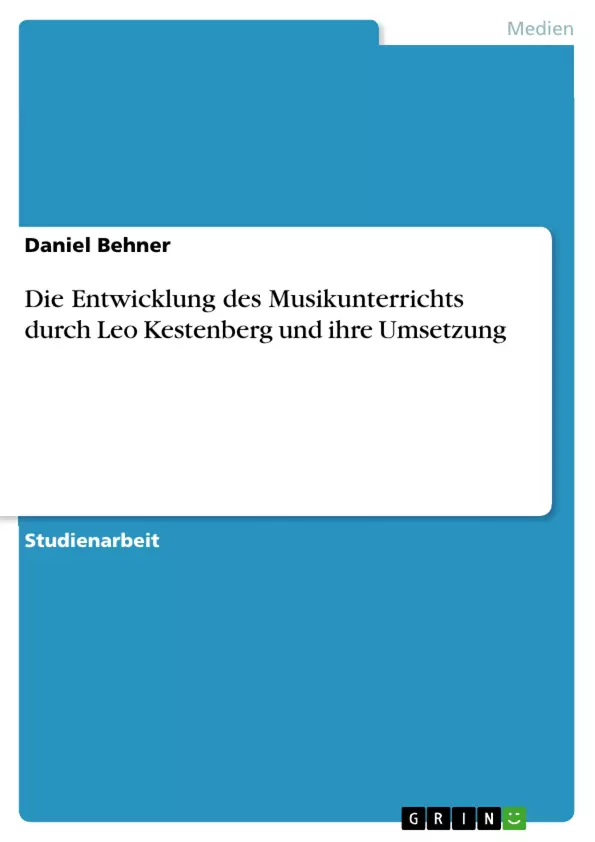Als Musikstudent des ersten oder zweiten Semesters macht man sich anfangs eher selten Gedanken über die wirklichen Hintergründe seines Studienfaches, zum Beispiel wie es entstanden ist, aus welchem Grund oder durch wen es geprägt wurde.
Man ist sich selbst überhaupt nicht darüber im Klaren, dass das Unterrichtsfach Musik als solches vor nicht allzu langer Zeit erst entworfen und geprägt wurde. Musikunterricht, wie er heutzutage erlebt wird, unterscheidet sich stark von dem Musikunterricht wie er vor und kurz nach der Jahrhundertwende – der Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert – noch bestand. Dies gilt auch für das Musikstudium auf Lehramt, dass in keinster Weise mit dem damaligen „Studium“ des Musiklehrers vergleichbar ist.
Vielen Musikpädagogen und -reformern hat man es zu verdanken, dass in den 20er Jahren ein bestimmender Einfluss auf die Musikpädagogik ausgeübt wurde, zugunsten einer bedeutsamen Veränderung des Unterrichtsfaches Musik und der Lehrerausbildung im Bereich Musik.
Doch vor allem ein Musikreformer sticht aus der Masse hervor. Leo Kestenberg – dem vielseitigen, weitblickenden und leidenschaftlichen Pianisten, Politiker, Klavier- und Musikpädagogen - war es zu verdanken, dass konkrete Visionen und Vorstellungen zur Musik als erzieherisches Mittel in der Schule entstanden sind, konkretisiert und schließlich auch schulpolitisch durchgesetzt wurden.
Im Fokus meiner Arbeit stehen die Entwicklung und Umsetzung des Musikunterrichts durch Leo Kestenberg, sowie der Einfluss Kestenbergs auf den heutigen Musikunterricht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kestenbergs Motivation und Gründe für seine ersten globalen Ziele
- Die konkreten Forderungen Kestenbergs in seiner Schrift „Musikpflege und Musikerziehung“
- Der Einfluss von Kestenbergs Gegner auf seine Schriften und seine spätere Reform
- Die Lernziele, -inhalte und -methoden der Ministerialerlasse
- Die höhere Schule
- Die Mittelschule
- Die Volksschule
- Die neue Ordnung der Prüfung für das Künstlerische Lehramt
- Das Scheitern der Kestenberg-Reform
- Der späte (Teil-)Erfolg der Reform in der Nachkriegszeit bis heute
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und Umsetzung des Musikunterrichts durch Leo Kestenberg sowie dessen Einfluss auf den heutigen Musikunterricht. Sie beleuchtet Kestenbergs Motivation und seine ersten globalen Ziele, die zur Verbindung von Musik und Schule führten, und analysiert seine Schrift „Musikerziehung und Musikpflege“. Zudem werden die Auswirkungen von Kestenbergs Kritikern auf seine Reform beleuchtet und die konkreten Ziele und Forderungen der Reform in den Ministerialerlassen, einschließlich der neuen Lernziele, Inhalte und Methoden für den Musikunterricht und die Musiklehrerausbildung, untersucht. Schließlich werden die Folgen der Reform für den Musikunterricht, ihre Gründe für das Scheitern und ihre spätere Durchsetzung von der Nachkriegszeit bis heute betrachtet.
- Kestenbergs Motivation und Ziele für eine umfassende musikalische Volksbildung
- Die konkrete Ausgestaltung der Kestenberg-Reform in der Schrift „Musikpflege und Musikerziehung“
- Der Einfluss von Kritikern und Gegnern auf die Kestenberg-Reform
- Die Lernziele, -inhalte und -methoden des Musikunterrichts nach der Kestenberg-Reform
- Das Scheitern und die späte (Teil-)Erfolgsgeschichte der Kestenberg-Reform
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Entwicklung des Musikunterrichts und den Einfluss der Musikpädagogik auf die heutige Musikerausbildung. Sie stellt Leo Kestenberg als einen der wichtigsten Musikreformer des 20. Jahrhunderts vor und erläutert den Fokus der Arbeit auf seine Visionen und Reformen.
Kestenbergs Motivation und Gründe für seine ersten globalen Ziele
Dieses Kapitel untersucht Kestenbergs sozialdemokratische Prägung und seine Überzeugung von der Einheit von Musik und Sozialismus. Es beschreibt seine Bemühungen um die Aufhebung schichtspezifischer Unterschiede in Kultur und Bildung und seine Vision von Musik als erzieherischem Mittel für das gesamte Volk. Zudem wird die Situation des Musikunterrichts vor Kestenbergs Reform beleuchtet, die vor allem durch mangelndes musikalisches Wissen und pädagogische Methoden geprägt war.
Die konkreten Forderungen Kestenbergs in seiner Schrift „Musikpflege und Musikerziehung“
Dieses Kapitel beleuchtet Kestenbergs Schrift „Musikpflege und Musikerziehung“, die seine wichtigsten Ziele und Reformvorstellungen darlegt. Es werden Kestenbergs Visionen von einer neuen Gesellschaft, die auf Gemeinschaft und Musik basiert, und die Aufhebung der Grenzen zwischen Volk und Kunst analysiert. Zudem wird die Bedeutung der musikalischen Volksbildung und die Notwendigkeit der Musikerziehung in allen pädagogischen Institutionen hervorgehoben.
Der Einfluss von Kestenbergs Gegner auf seine Schriften und seine spätere Reform
Dieses Kapitel behandelt die Kritik und den Widerstand, denen sich Kestenberg während seiner Reformbemühungen gegenübersehen musste. Es beleuchtet, wie diese Opposition seine Schriften und die endgültige Fassung seiner Reform beeinflussten.
Die Lernziele, -inhalte und -methoden der Ministerialerlasse
Dieses Kapitel untersucht die konkreten Ziele und Forderungen der Kestenberg-Reform in Form der Ministerialerlasse. Es beleuchtet die neuen Lernziele, Inhalte und Methoden für den Musikunterricht in verschiedenen Schulformen, wie der höheren Schule, der Mittelschule und der Volksschule, und die Auswirkungen der Reform auf die Musiklehrerausbildung.
Die neue Ordnung der Prüfung für das Künstlerische Lehramt
Dieses Kapitel analysiert die neue Ordnung der Prüfung für das Künstlerische Lehramt, die Teil der Kestenberg-Reform war. Es beleuchtet die Auswirkungen der Reform auf die Ausbildung und die Qualifikation von Musiklehrern.
Das Scheitern der Kestenberg-Reform
Dieses Kapitel beschreibt die Gründe für das Scheitern der Kestenberg-Reform und die Faktoren, die zu ihrer mangelnden Durchsetzung führten.
Der späte (Teil-)Erfolg der Reform in der Nachkriegszeit bis heute
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Kestenberg-Reform in der Nachkriegszeit und ihre spätere (Teil-)Erfolgsgeschichte. Es untersucht, wie die Ideen und Ziele Kestenbergs in der heutigen Musikausbildung umgesetzt werden.
Schlüsselwörter
Musikunterricht, Musikpädagogik, Leo Kestenberg, „Musikpflege und Musikerziehung“, Reform, Ministerialerlasse, Lernziele, Inhalte, Methoden, Musiklehrerausbildung, Volksbildung, Sozialismus, Musik und Gesellschaft.
- Quote paper
- Daniel Behner (Author), 2011, Die Entwicklung des Musikunterrichts durch Leo Kestenberg und ihre Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461260