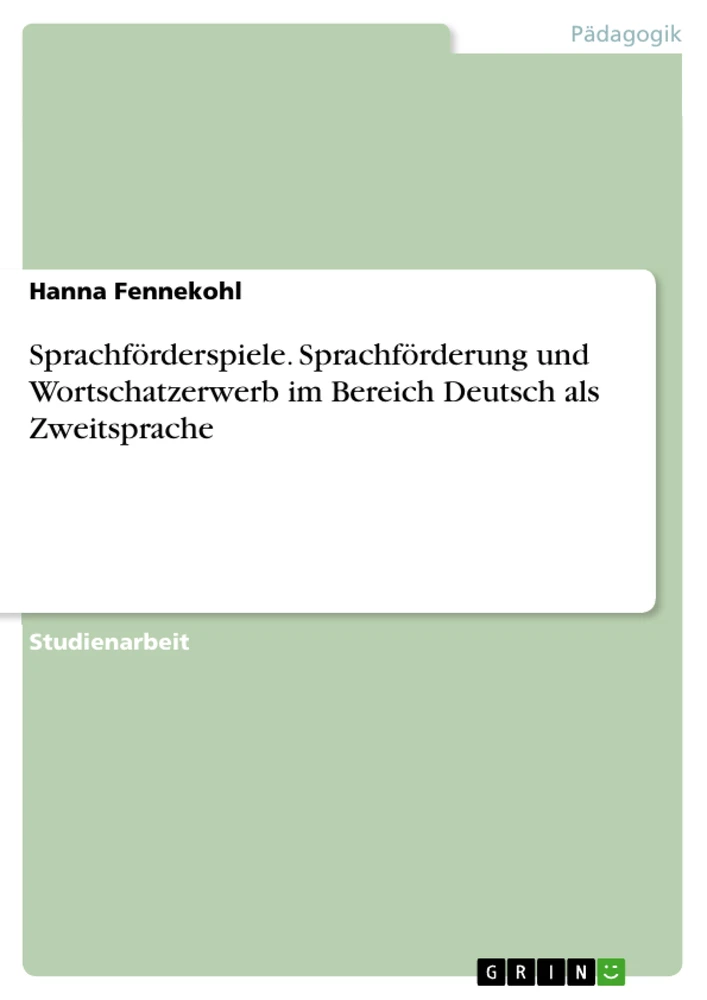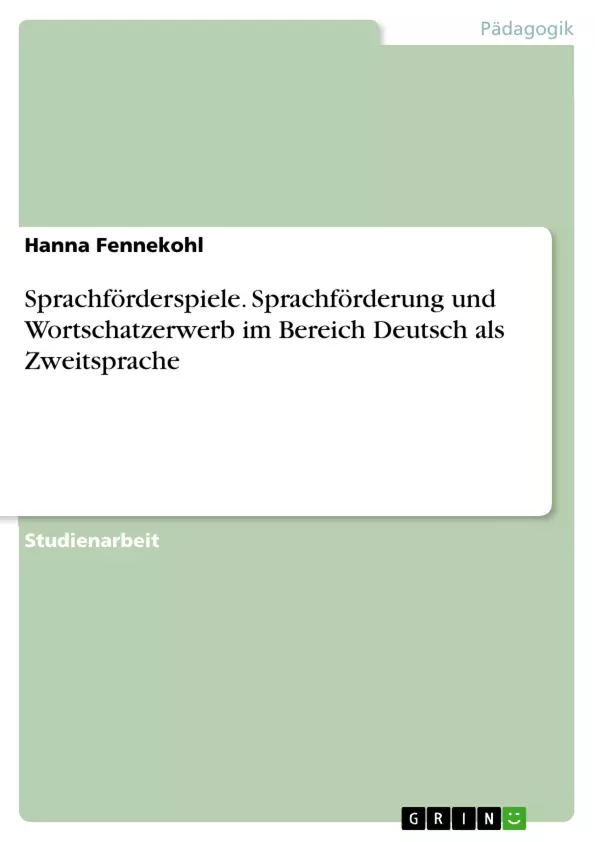Seit den 1960er-Jahren hat sich in Deutschland der Anteil von Bürgern mit nicht deutscher Herkunft durch Zuwanderung verzwanzigfacht und wir in Zukunft weiter ansteigen. In Deutschland haben circa 22,2 % der Kinder und Jugendlichen einen Migrationshintergrund. Dies hat zur Folge, dass in unserer Gesellschaft, speziell im schulischen Bereich, eine zunehmende soziale sowie kulturelle Heterogenität entsteht. Um dieser Heterogenität gerecht zu werden, müssen Kinder individuell unterstützt werden. Besonders Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund benötigen eine spezielle Förderung auf sprachlicher Ebene, um eine Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen. Der Sprachförderunterricht ist seit je her ein fester Bestandteil in deutschen Bildungseinrichtungen und kann in verschiedenen Formen durchgeführt werden. Ein großer Bereich des Materials für den Deutsch als Zweitsprachen -Unterricht ist die Kategorie der Sprachförderspiele. Auf Grund dieser Wichtigkeit, haben wir uns dazu entschlossen, zwei Sprachförderspiele mit dem Schwerpunkt Wortschatzerwerb auf ihre Anwendbarkeit zu testen. Dafür haben wir folgende Forschungsfrage aufgestellt: Können die Sprachförderspiele „Sprachmemo“ und „Sprache betrachten – Was passt nicht?“ als unterstützendes Medium im DaZ-Unterricht eingesetzt werden?.
Um diese beantworten zu können, werden in der vorliegenden Arbeit zuerst theoretische Grundlagen zu den Themen Sprachförderung und Wortschatzerwerb im Bereich Deutsch als Zweitsprache dargelegt. Darauf aufbauend werden die benannten Sprachförderspiele analysiert und in einer Diskussion ausgewertet, um im Fazit die Forschungsfrage klären zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachförderung bei Kindern
- Sprachförderung DaZ
- Sprachförderspiele
- Spielformen
- Kriterien von Sprachförderspielen
- Wortschatzerwerb für DaZ
- Sprachförderspiele in der Anwendung
- Förderspiel 1 – Sprachmemo
- Analyse
- Sprachförderspiel 2 – Sprache betrachten: Was passt nicht? - Oberbegriffe finden
- Analyse
- Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Anwendbarkeit von zwei Sprachförderspielen, „Sprachmemo“ und „Sprache betrachten: Was passt nicht?“, im DaZ-Unterricht mit dem Schwerpunkt Wortschatzerwerb. Die Forschungsfrage lautet: Können diese Spiele als unterstützende Medien im DaZ-Unterricht eingesetzt werden? Die Arbeit beleuchtet dazu zunächst theoretische Grundlagen der Sprachförderung und des Wortschatzerwerbs im Bereich Deutsch als Zweitsprache. Anschließend werden die Spiele analysiert und in einer Diskussion ausgewertet.
- Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund
- Theorien des Spracherwerbs
- Implizite und explizite Sprachfördermethoden
- Analyse von Sprachförderspielen im DaZ-Unterricht
- Wortschatzerwerb im DaZ-Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der zunehmenden sprachlichen Heterogenität in deutschen Bildungseinrichtungen ein, insbesondere im Kontext von Kindern mit Migrationshintergrund. Sie begründet die Notwendigkeit spezieller Sprachförderung und die Auswahl der Sprachförderspiele „Sprachmemo“ und „Sprache betrachten: Was passt nicht?“ als Untersuchungsgegenstand. Die zentrale Forschungsfrage wird formuliert.
Sprachförderung bei Kindern: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Sprachförderung und benennt verschiedene Risikogruppen, die besonderer Unterstützung bedürfen. Es beleuchtet den Stand der Forschung und stellt vier verschiedene Theorien des Spracherwerbs vor: den nativistischen, den lerntheoretischen, den kognitivistischen und den interaktionistischen Ansatz. Des Weiteren werden implizite und explizite Sprachfördermethoden unterschieden und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Die Bedeutung des sprachlichen Umfelds für die kindliche Entwicklung wird hervorgehoben.
Sprachförderung DaZ: Dieses Kapitel fokussiert auf die Sprachförderung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Es zeigt den Zusammenhang zwischen Migration, Bildung und sozialer Teilhabe auf und betont die Bedeutung von DaZ-Förderung für die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Die Herausforderungen im DaZ-Unterricht und die Integration von DaZ-Kindern in den regulären Unterricht werden beleuchtet, ebenso die Unterschiede im Spracherwerb zwischen Kindern der ersten und zweiten Generation von Migrantenfamilien.
Schlüsselwörter
Sprachförderung, DaZ, Wortschatzerwerb, Sprachförderspiele, Migrationshintergrund, Spracherwerbstheorien, implizite und explizite Methoden, Integration, Deutsch als Zweitsprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Anwendbarkeit von Sprachförderspielen im DaZ-Unterricht"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit von zwei spezifischen Sprachförderspielen – „Sprachmemo“ und „Sprache betrachten: Was passt nicht?“ – im Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-Unterricht, insbesondere im Hinblick auf den Wortschatzerwerb. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Können diese Spiele als unterstützende Medien im DaZ-Unterricht eingesetzt werden?
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt theoretische Grundlagen der Sprachförderung und des Wortschatzerwerbs im DaZ-Kontext. Sie umfasst Kapitel zu Sprachförderung bei Kindern allgemein, Sprachförderung im DaZ-Unterricht, die Analyse der beiden ausgewählten Sprachförderspiele, sowie eine Diskussion und ein Fazit zu deren Eignung im DaZ-Unterricht.
Welche Sprachförderspiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei Sprachförderspiele: „Sprachmemo“ und „Sprache betrachten: Was passt nicht?“. Für jedes Spiel wird eine detaillierte Analyse durchgeführt, um dessen Eignung für den DaZ-Unterricht zu bewerten.
Welche Theorien des Spracherwerbs werden berücksichtigt?
Die Arbeit stellt vier verschiedene Theorien des Spracherwerbs vor: den nativistischen, den lerntheoretischen, den kognitivistischen und den interaktionistischen Ansatz. Diese Theorien bilden den theoretischen Rahmen für die Analyse der Sprachförderspiele.
Welche Methoden der Sprachförderung werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen impliziten und expliziten Sprachfördermethoden und diskutiert deren Vor- und Nachteile im Kontext des DaZ-Unterrichts.
Welche Zielgruppe wird betrachtet?
Die Zielgruppe sind Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ), insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen im DaZ-Unterricht und die Bedeutung von Sprachförderung für die Integration dieser Kinder.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit fasst die Ergebnisse der Analyse der Sprachförderspiele zusammen und bewertet deren Eignung als unterstützende Medien im DaZ-Unterricht. Es wird eine abschließende Einschätzung zur Beantwortung der Forschungsfrage gegeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachförderung, DaZ, Wortschatzerwerb, Sprachförderspiele, Migrationshintergrund, Spracherwerbstheorien, implizite und explizite Methoden, Integration, Deutsch als Zweitsprache.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, Sprachförderung bei Kindern, Sprachförderung DaZ, Sprachförderspiele (inkl. Spielformen und Kriterien), Wortschatzerwerb für DaZ, die Anwendung der Sprachförderspiele (inkl. detaillierter Analysen von "Sprachmemo" und "Sprache betrachten: Was passt nicht?"), eine Diskussion und ein Fazit.
- Citation du texte
- Hanna Fennekohl (Auteur), 2018, Sprachförderspiele. Sprachförderung und Wortschatzerwerb im Bereich Deutsch als Zweitsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461331