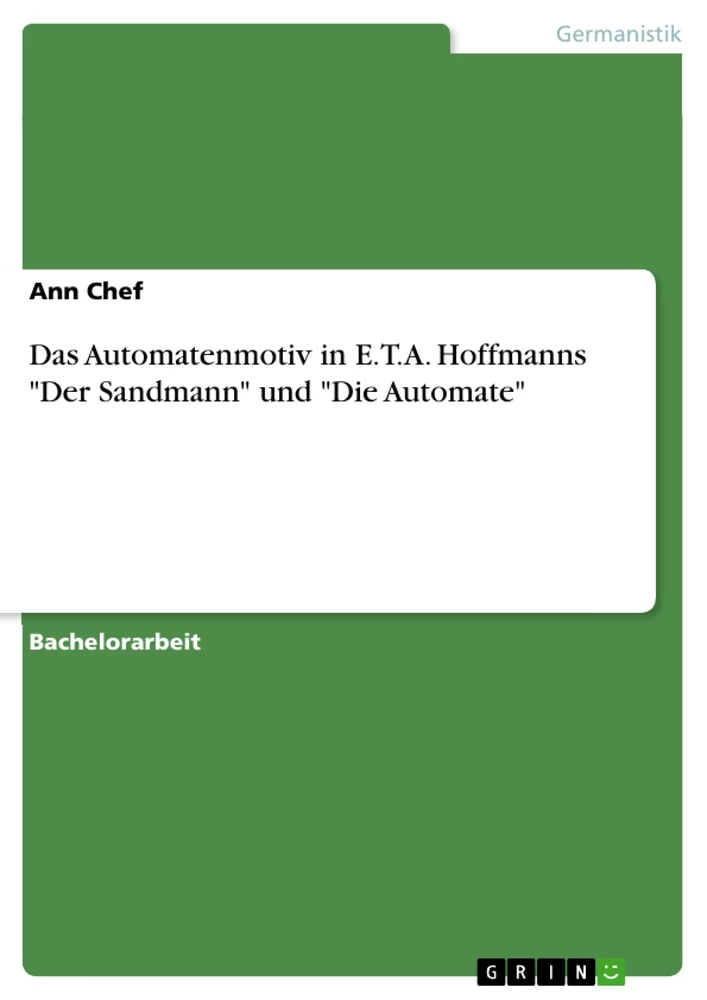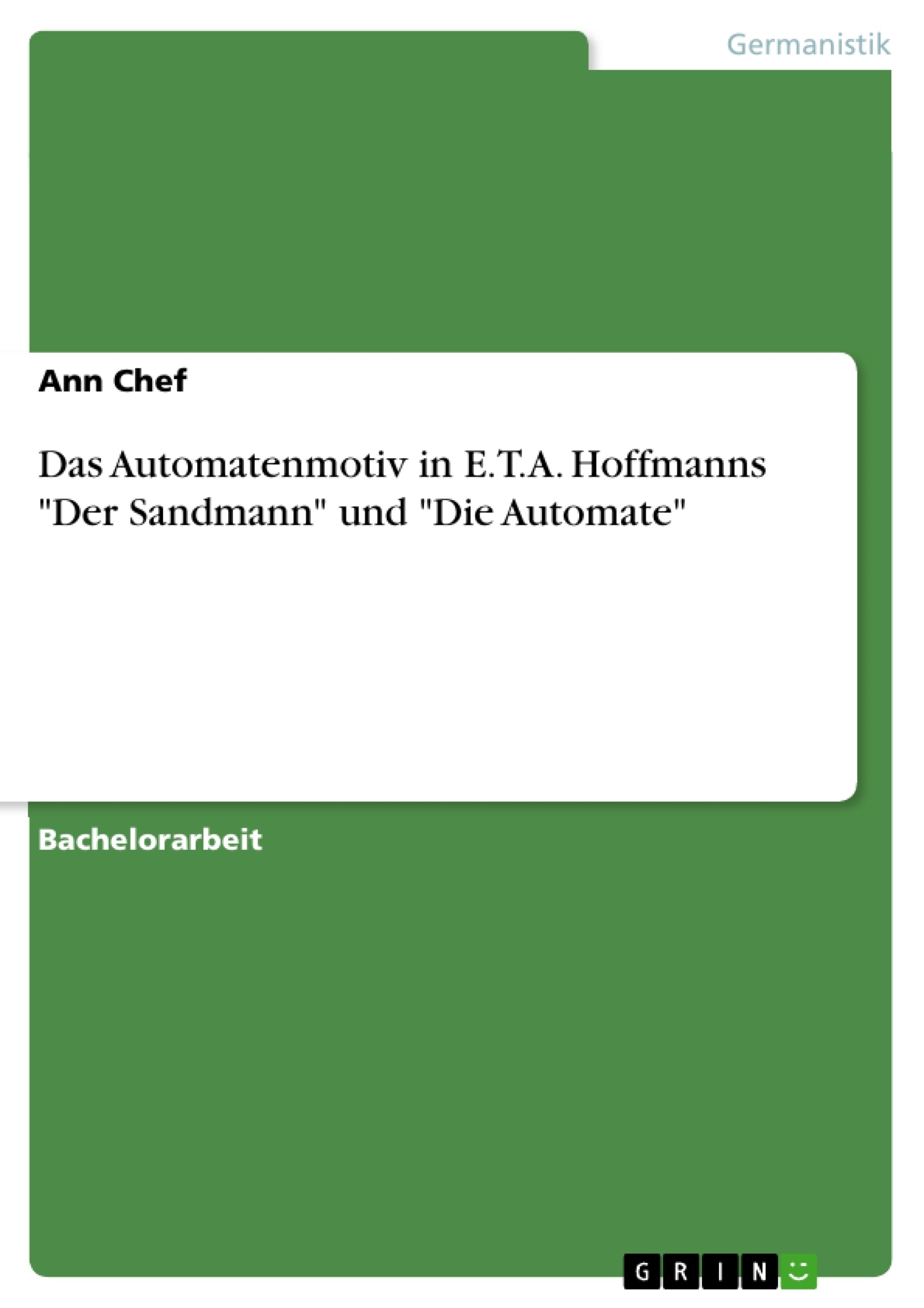Das Erschaffen von künstlichem Leben fasziniert die Menschen seit die Wissenschaft diesen Gedanken technisch zulässt. Etwas, das wie der Mensch sprechen kann, menschenähnlich aussieht, die Tätigkeiten eines Menschen vollbringt und sogar den Anschein erweckt, dass ein Denken und Fühlen möglich ist, ist hochgradig faszinierend. Vor allem E.T.A. Hoffmann hat das Automatenmotiv sehr facettenreich und auf nahezu unheimliche Weise in seine Werke aufgenommen. In der vorliegenden Arbeit soll dieses Motiv detailliert analysiert werden mit Schwerpunkt auf Funktion und Wirkung der Androiden auf die Protagonisten.
Dazu werden zunächst der historische sowie der literarische Kontext dargestellt, da vor allem die technischen Entwicklungen das Automatenthema angestoßen haben. Mit der Popularität der Automaten und ihrer Technik wuchs auch das allgemeine Interesse an ihnen. Auch die Philosophie nahm es sich im achtzehnten Jahrhundert zur Aufgabe, den Menschen mit der künstlichen Maschine in Verbindung zu setzen und somit Rückschlüsse auf die Lebendigkeit von Maschinen zu ziehen, deshalb werden die philosophischen Sichtweisen von Déscartes, La Mettrie und Leibniz zum künstlichen Menschen herausgestellt.
Schließlich wird der Fokus auf Hoffmanns Werk "Der Sandmann" gelegt, in welchem die Funktion und Wirkung des Automatenmädchens Olimpia auf den Protagonisten Nathanael untersucht wird. Zudem werden die konträren Weiblichkeitsbilder analysiert, da die Puppe Olimpia in extremem Gegensatz zu Clara steht und es zu klären gilt, was das Automatenmädchen in ihrem Wesen ausmacht, dass ihr der Protagonist letztendlich verfällt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Geschichte des Automaten in Technik und Literatur
- Philosophische Ansichten zum Automaten
- Das Automatenmotiv in E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann"
- Wirkung und Funktion des Automatenmädchens Olimpia
- Konträre Weiblichkeitsbilder: Clara und Olimpia
- Nathanael als Automat
- Das Automatenmotiv in E.T.A. Hoffmanns "Die Automate"
- Wirkung und Funktion des wahrsagenden Türken
- Künstlichkeit oder tatsächlich Lebendigkeit?
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Automatenmotiv in zwei Erzählungen von E.T.A. Hoffmann, "Der Sandmann" und "Die Automate", mit dem Fokus auf die Funktion und Wirkung der Androiden auf die Protagonisten. Sie analysiert insbesondere die Rolle der Puppe Olimpia als weibliche Figur und die psychologische Wirkung auf Nathanael in "Der Sandmann".
- Die historische und literarische Entwicklung des Automatenmotivs
- Philosophische Ansichten zum künstlichen Leben und zur Frage der Lebendigkeit von Maschinen
- Die Funktion und Wirkung von Androiden auf die Protagonisten in "Der Sandmann" und "Die Automate"
- Die Darstellung weiblicher Figuren als Automaten und die psychologische Wirkung auf den männlichen Protagonisten
- Die Mechanisierung des menschlichen Verhaltens und der Einfluss von Automaten auf das menschliche Bewusstsein
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet die historische und literarische Entwicklung des Automatenmotivs, beginnend mit der Renaissance und dem Aufstieg der Uhrwerktechnik. Es zeigt, wie Automaten zunehmend als Kunstwerke und Symbol für Ordnung und Harmonie betrachtet wurden und einen wichtigen Einfluss auf die Gesellschaft und die Literatur hatten.
Das dritte Kapitel befasst sich mit philosophischen Ansichten zum Automaten. Es präsentiert die Gedanken von Descartes, La Mettrie und Leibniz zum künstlichen Menschen und zur Frage, ob Maschinen denken und fühlen können.
Das vierte Kapitel analysiert das Automatenmotiv in "Der Sandmann". Es untersucht die Funktion und Wirkung des Automatenmädchens Olimpia auf den Protagonisten Nathanael, dessen Wahnsinn durch die Puppe verstärkt wird. Das Kapitel beleuchtet die konträren Weiblichkeitsbilder von Olimpia und Claras und analysiert, was Olimpia als Frauentyp ausmacht und warum Nathanael ihr verfallen ist.
Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf "Die Automate" und analysiert die Funktion und Wirkung des wahrsagenden Türken auf den Protagonisten. Es stellt die Frage nach der Künstlichkeit und Lebendigkeit des Automaten und untersucht, ob er sich einem dieser Bereiche zuordnen lässt.
Schlüsselwörter
Automatenmotiv, E.T.A. Hoffmann, "Der Sandmann", "Die Automate", Androiden, Künstliche Intelligenz, Philosophie, Descartes, La Mettrie, Leibniz, Weiblichkeitsbilder, Wahnsinn, Lebendigkeit, Mechanisierung, Mensch-Maschine-Verhältnis, Automatentheater
- Quote paper
- Ann Chef (Author), 2018, Das Automatenmotiv in E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann" und "Die Automate", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461366