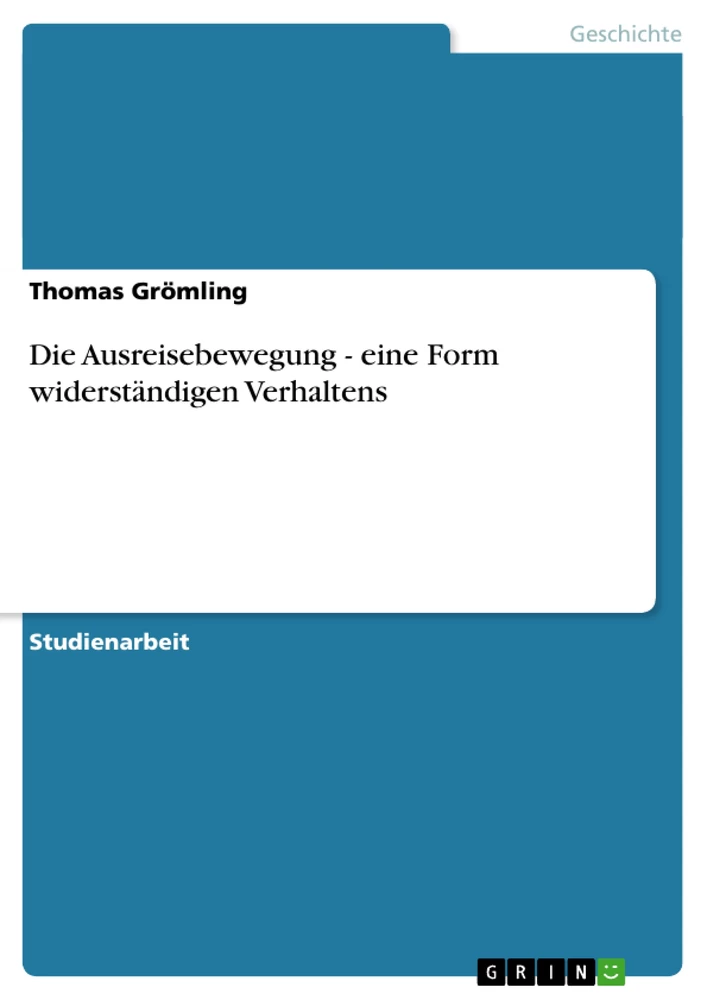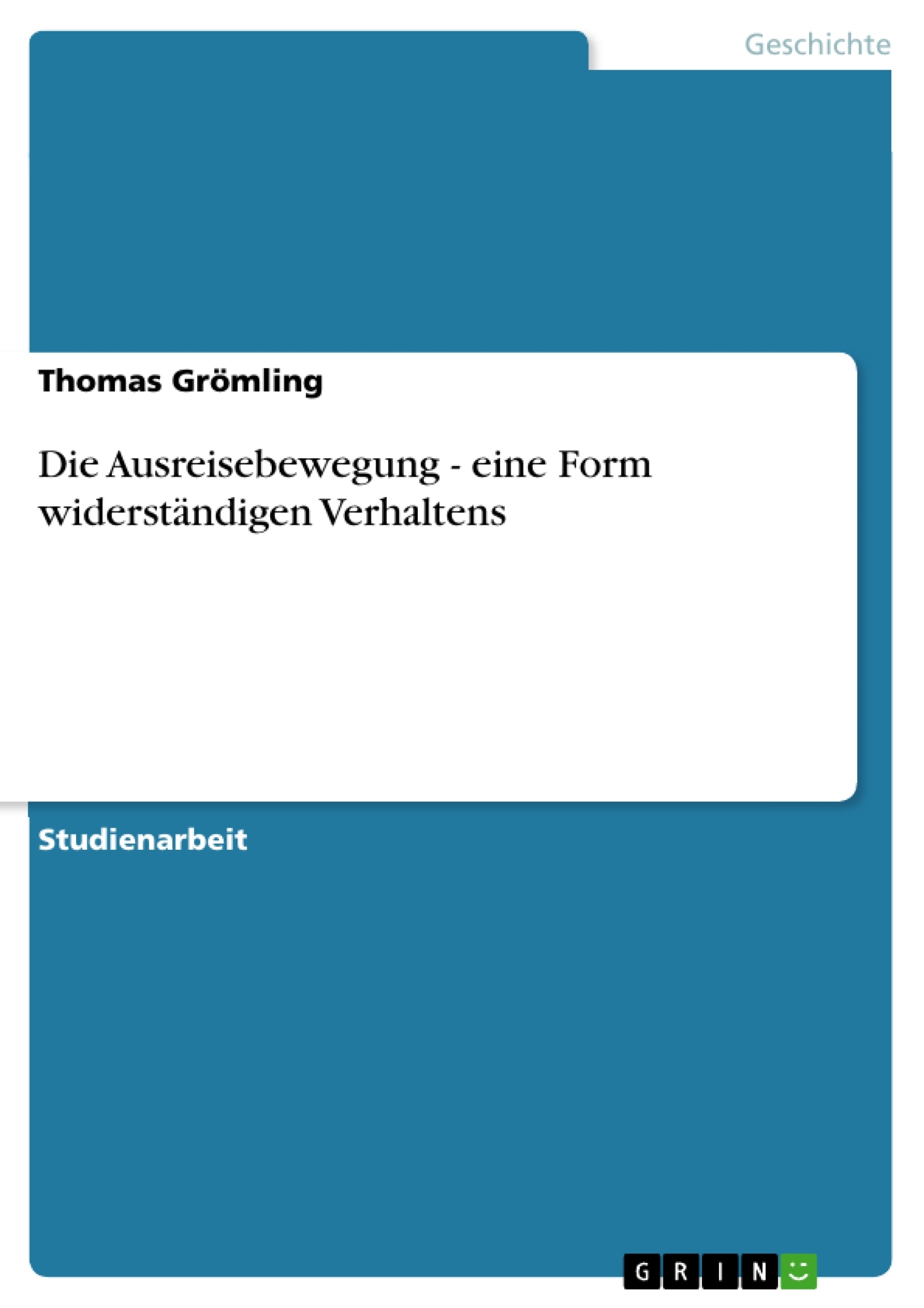„Mein Name ist Manfred Krug, ich bin Schauspieler und Sänger. Infolge der Scheidung meiner Eltern bin ich als Dreizehnjähriger aus Westdeutschland in die DDR gekommen, wo ich seither lebe. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder.
[...] Wie bekannt, verfaßten nach der Biermann Ausweisung 12 Schriftsteller einen Protest, den auch ich unterschrieb. Nachdem ich nicht bereit war, diese Unterschrift zurückzuziehen, hat sich mein Leben schlagartig verändert.
[...] Nach reiflichem Bedenken beantrage ich für meine Familie und mich die Ausreise aus der DDR in die BRD, wo meine Mutter und mein Bruder leben.“
Ebenso wie Manfred Krug haben viele Tausende in der DDR einen Ausreiseantrag gestellt, um in den Westen Deutschlands ausreisen zu können.
Auf den ersten Blick erscheint die Ausreisebewegung nicht das zu sein, was einem bei dem Schlagwort Widerstand in den Sinn kommt. Da denkt man eher an kritische Stimmen wie Wolf Biermann oder Menschen im Untergrund, die versuchen, durch spektakuläre Aktionen die Macht des Staates zu beeinträchtigen. In dieser Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, ob die Ausreisebewegung eine Form widerständigen Verhaltens war.
Zunächst möchte ich die rechtlichen und historischen Fakten des Ausreiseantrages in der DDR klären, um dann das Verfahren darzustellen. Davon ausgehend zeige ich die Entwicklung der Ausreisesituation in den 60er, 70er und 80er Jahren auf, um dann die Haltung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen zur Ausreise darzustellen. Hier interessiert vor allem die Motivstruktur der Antragsteller, die Haltung der Kirchen zu diesem Komplex, die Situation der Sachbearbeiter und letztlich die Aufnahme der Ausreiseproblematik durch die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) selbst. Danach werde ich zwei exemplarische Beispiele für die Zusammenschlüsse Ausreisewilliger in der DDR anführen und in einem weiteren Schritt die besondere Bedeutung der Rückverbindungen für die Ausreiseproblematik darlegen. Letztlich werde ich die Ausreisebewegung in den Kontext zweier Theorien über widerständiges Verhalten stellen und überprüfen, ob sie dem gerecht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung
- Der Ausreiseantrag
- Rechtliche und historische Entwicklung
- Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft
- Die Ausreisesituation von 1962 bis 1989
- Die 60er und 70er Jahre
- Situationswandel der 80er Jahre
- Haltungen zum Ausreiseantrag
- Motivstruktur der Antragsteller
- Kirche
- Sachbearbeiter
- SED
- Die Ausreisebewegung als Form widerständigen Verhaltens
- Beispiele widerständigen Verhaltens
- Rückverbindungen
- Einordnung
- Der Ausreiseantrag
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Ausreisebewegung in der DDR, um zu untersuchen, ob diese als eine Form des Widerstandes gegen den Staat verstanden werden kann. Ziel ist es, die rechtlichen und historischen Rahmenbedingungen der Ausreise und die Entwicklung der Ausreisesituation von den 1960er bis in die 1980er Jahre zu beleuchten.
- Die rechtlichen Grundlagen und die historische Entwicklung des Ausreiseantrags in der DDR
- Die Entwicklung der Ausreisesituation von den 1960er bis in die 1980er Jahre
- Die Haltungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen zur Ausreise, insbesondere die Motive der Antragsteller, die Haltung der Kirchen, die Situation der Sachbearbeiter und die Reaktion der SED.
- Die Einordnung der Ausreisebewegung in den Kontext von Theorien über widerständiges Verhalten
- Der Einfluss der Ausreisebewegung auf die DDR-Gesellschaft und die politische Situation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausreisebewegung als ein Thema vor, das bisher in der Forschung nur begrenzt untersucht wurde. Die Arbeit will anhand von historischen Fakten und Analysen der Haltungen verschiedener Akteure, die Ausreisebewegung als eine Form des Widerstands gegen den Staat darstellen.
Das Kapitel "Der Ausreiseantrag" beleuchtet die rechtlichen und historischen Grundlagen der Ausreise in der DDR. Es geht auf das Paßgesetz von 1957, das Personenstandsgesetz von 1956 und dessen Änderung im Jahr 1967 und die Umsetzung der KSZE-Beschlüsse von 1975 und 1983 in DDR-Recht ein.
Das Kapitel "Die Ausreisesituation von 1962 bis 1989" beschreibt die Entwicklung der Ausreisesituation in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren. Es zeichnet den Wandel der Ausreisepolitik der DDR und die veränderte Haltung der Staatsführung gegenüber Ausreisewilligen nach.
Das Kapitel "Haltungen zum Ausreiseantrag" untersucht die Motive der Antragsteller, die Haltung der Kirchen, die Situation der Sachbearbeiter und die Reaktion der SED auf die Ausreisebewegung. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und die Herausforderungen, die die Ausreisebewegung für die DDR-Gesellschaft darstellte.
Das Kapitel "Die Ausreisebewegung als Form widerständigen Verhaltens" analysiert die Ausreisebewegung als eine Form des Widerstandes. Es untersucht exemplarische Beispiele für Zusammenschlüsse Ausreisewilliger und die Bedeutung der Rückverbindungen für die Ausreiseproblematik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Aspekten der Ausreisebewegung in der DDR, insbesondere den rechtlichen Grundlagen, der historischen Entwicklung, den Motivationen der Antragsteller, der Haltung der Kirchen, der Rolle der SED und der Einordnung der Ausreisebewegung in den Kontext von Theorien über widerständiges Verhalten.
Häufig gestellte Fragen
War die Ausreisebewegung in der DDR eine Form von Widerstand?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und kommt zu dem Schluss, dass das Stellen eines Ausreiseantrags ein widerständiges Verhalten darstellte, da es die staatliche Autorität direkt herausforderte.
Welche Rolle spielte Manfred Krug bei der Ausreisebewegung?
Manfred Krug war ein prominentes Beispiel. Nachdem er gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns protestierte und seinen Ausreiseantrag stellte, änderte sich sein Leben in der DDR schlagartig.
Wie reagierte die SED auf Ausreiseanträge?
Die SED betrachtete Antragsteller oft als „Verräter“ und reagierte mit beruflichen Repressalien, Überwachung und gesellschaftlicher Ausgrenzung.
Welche Bedeutung hatten die KSZE-Beschlüsse für Ausreisewillige?
Die Schlussakte von Helsinki (1975) gab den Bürgern eine völkerrechtliche Basis, auf die sie sich bei ihren Anträgen auf Familienzusammenführung berufen konnten.
Wie verhielten sich die Kirchen zur Ausreiseproblematik?
Die Kirchen befanden sich in einem Dilemma: Sie versuchten einerseits, den Menschen beizustehen, wollten aber andererseits den Staat nicht offen provozieren, um ihre eigenen Spielräume nicht zu gefährden.
- Arbeit zitieren
- Thomas Grömling (Autor:in), 1998, Die Ausreisebewegung - eine Form widerständigen Verhaltens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4616