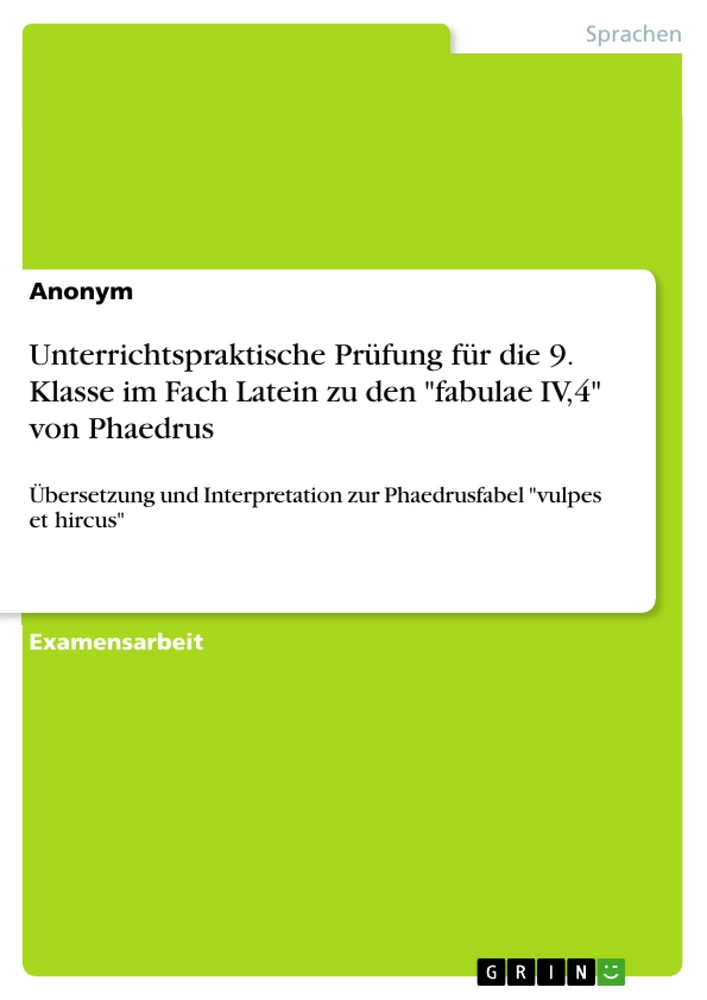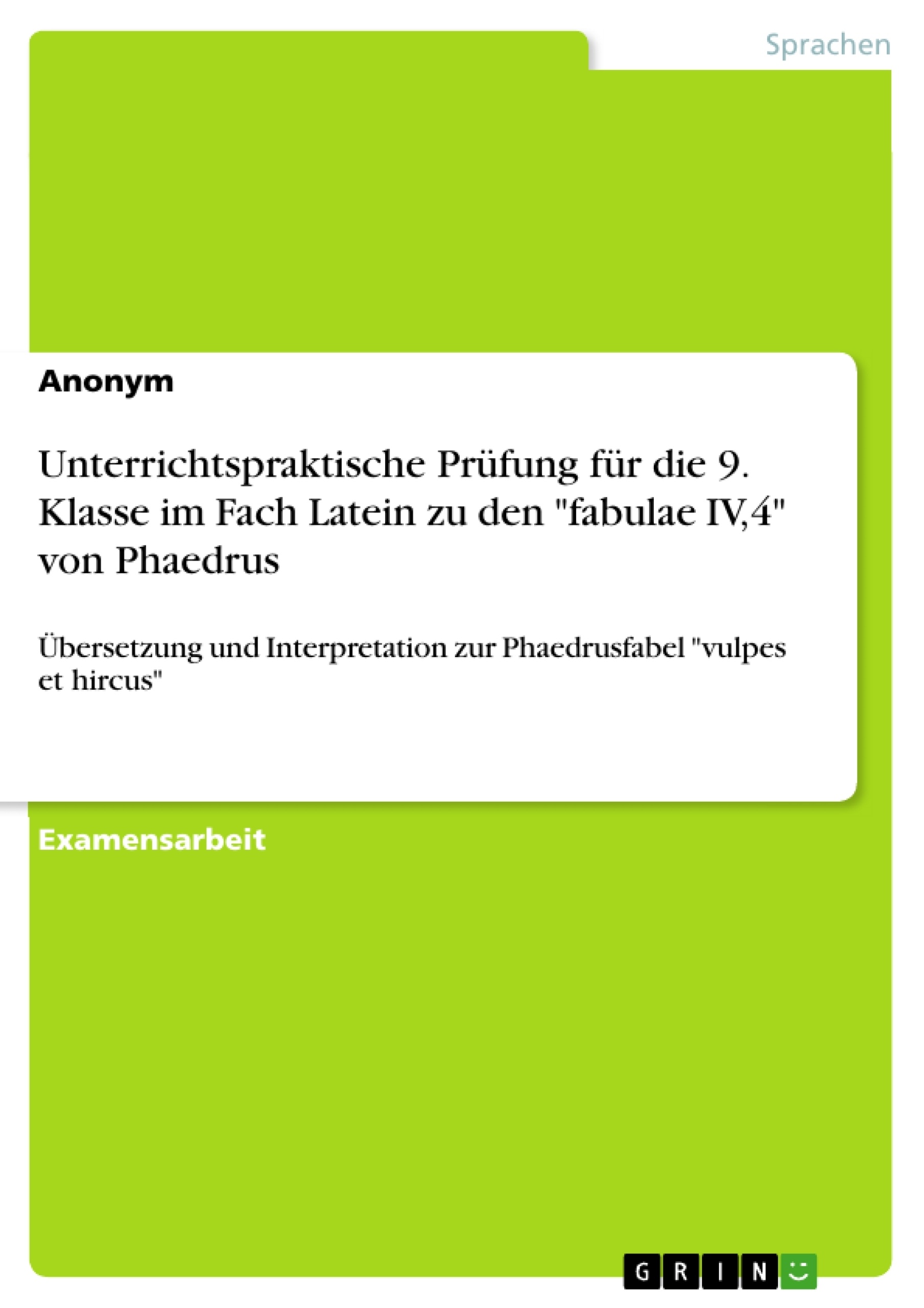Das Ziel dieser unterrichtspraktischen Prüfung im Fach Latein ist die Erschließung des Ausgangs der Phaedrusfabel "vulpes et hircus" ("Phaed." IV, 9; 10-12) und die Bewertung des Verhaltens der Fabeltiere im Spannungsverhältnis von Klugheit und Rücksichtslosigkeit sowie Hilfsbereitschaft und Naivität zur Steigerung der Text- und Kulturkompetenz. Dabei geht es um moralisches Lernen anhand ausgewählter "fabulae" des Phaedrus als Spiegel menschlicher und unmenschlicher Verhaltensweisen und eine Einführung in die Originallektüre.
Dabei gibt es mehrere Ziele: Die SuS können das Verhalten der Fabeltiere unter Berücksichtigung des Spannungsverhältnisses ihrer Charaktereigenschaften bewerten, indem sie den Ausgang der Fabel übersetzen und die Fabeltiere charakterisieren. Die SuS können anhand eines Bildimpulses sowie ihres Gattungswissens eine begründete Erwartungshaltung an den Ausgang der Fabel formulieren, indem sie anhand eines Bildimpulses den bereits erschlossenen Text rekapitulieren.
Die SuS können den Text textlinguistisch mithilfe des Lehrervortrags vorerschließen, indem sie Verben der Bewegung und die zugehörigen Handlungsträger markieren und so ihre Vorerwartungen mit ihrem ersten Textverständnis abgleichen. Die SuS können den Ausgang der Fabel erläutern, indem sie den Ausgang der Fabel rekodieren und ihre Übersetzung vergleichen. Die SuS können das Verhalten der Fabeltiere reflektieren, indem sie die Fabeltiere anhand ihrer Handlungen charakterisieren und auf der Grundlage dieser Charakterisierung beurteilen. Die SuS können die Fabel textimmanent interpretieren, indem sie das Zusammenwirken von inhaltlicher Aussage und sprachlicher Gestaltung in dem Textabschnitt untersuchen. Die SuS können die Fabel anhand eines existentiellen Transfers textübergreifend interpretieren, indem sie die beispielhafte Darstellung menschlichen Verhaltens reflektieren und so Parallelen in der Gegenwart finden.
Inhaltsverzeichnis
- Thema der Unterrichtsreihe
- Thema der Unterrichtsstunde
- Stundenziel
- Teilziele
- Verlaufsplan
- Tabellarische Darstellung der geplanten Unterrichtsreihe
- Begründung zentraler Aspekte der Unterrichtskonzeption
- Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsreihe zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern die Welt der Fabeln des Phaedrus näherzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, moralische Lektionen aus diesen Geschichten zu ziehen. Dabei soll der Fokus auf der Analyse und Interpretation der Fabeln liegen, um ein tieferes Verständnis für die menschlichen Verhaltensweisen und deren Darstellung in der Literatur zu entwickeln.
- Moralisches Lernen anhand von Fabeln
- Analyse von Charaktereigenschaften und deren Darstellung in Fabeln
- Interpretation von Fabeln im Kontext des Spannungsverhältnisses zwischen Klugheit und Rücksichtslosigkeit
- Entwicklung der Text- und Kulturkompetenz
- Einführung in die Originallektüre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Unterrichtsreihe beginnt mit einer Einführung in das Thema der Fabeln und ihrer moralischen Funktion. Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie die Fabeln als Spiegelbild menschlicher Verhaltensweisen dienen und wie sie als Mittel des moralischen Lernens eingesetzt werden können.
In der folgenden Unterrichtseinheit widmen sich die Schülerinnen und Schüler der Fabel "vulpes et hircus" (Phaed. IV, 9; 10-12). Sie analysieren den Verlauf der Fabel, die Charaktereigenschaften der beteiligten Tiere und die moralische Botschaft, die aus dieser Geschichte gezogen werden kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Unterrichtsreihe sind: Fabeln, Phaedrus, Moralisches Lernen, Textkompetenz, Kulturkompetenz, Charakterisierung, Klugheit, Rücksichtslosigkeit, Hilfsbereitschaft, Naivität, Verhaltensweisen, Originaltext, Interpretation.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Unterrichtspraktische Prüfung für die 9. Klasse im Fach Latein zu den "fabulae IV,4" von Phaedrus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461668