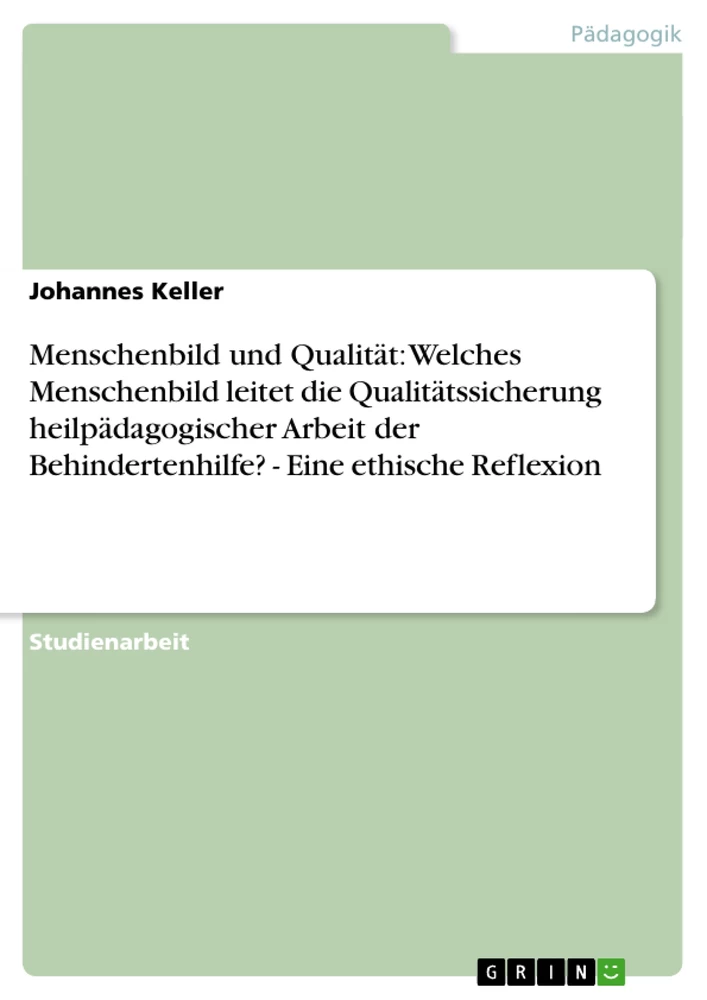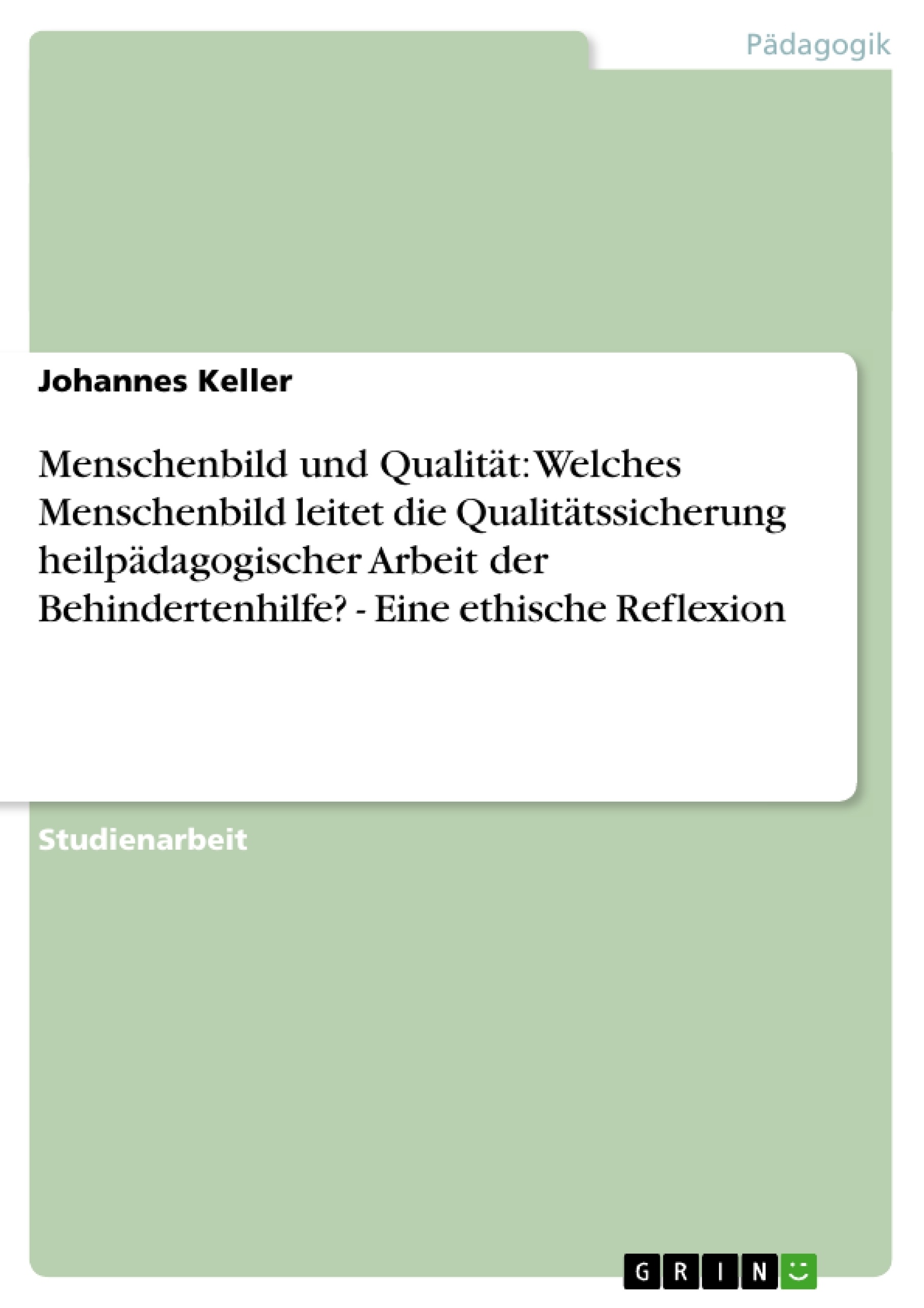Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Hausarbeit wird der Frage nachgegangen, welches Menschenbild die Qualitätssicherungsbemühungen in der heilpädagogischen Arbeit innerhalb der Behindertenhilfe aktuell leitet. Worin sich das Menschenbild von Qualitätssicherungssystemen und das Menschenbild der Heilpädagogik unterscheiden, wird aufgrund einer ethischen Reflexion genauer fokussiert. Vor diesem Hintergrund frage ich weiter nach notwendigen, hilfreichen und gültigen Folgerungen für die heilpädagogische und qualitätssichernde Arbeit.
Zunächst wird dargestellt, wie die Qualitätssicherung innerhalb eines allgemeinen Qualitätsmanagementsystems verortet ist: es wird beleuchtet, welche Herkunft und welches Ziel, welcher Qualitätsbegriff und welches Menschenbild hinter einem allgemeinen Qualitätsmanagementsystem stehen und dieses bestimmt. Schließlich wird aufgeführt, welche Instrumente der Qualitätssicherung aktuell in der Behindertenhilfe zum Einsatz kommen und welchen Einfluss sie in der heilpädagogischen Arbeit ausüben.
Demgegenüber wird die Herkunft und das Ziel der Heilpädagogik, sowie der Qualitätsbegriff und das Menschenbild der Heilpädagogik beleuchtet.
Erste daraus zu folgernde Kriterien zur Sicherung heilpädagogischer Qualität werden kurz skizziert.
Anschließend sollen zwei mögliche ethische Reflexionsebenen vorgestellt werden, aufgrund derer die Gegenüberstellung der Hintergründe des Menschenbilds von Qualitätssicherungssystemen und der Heilpädagogik verdichtet reflektiert werden soll : die utilitaristische, nach dem Nutzen fragende Ethik und die deontologische, nach den Werten innerhalb und außerhalb unseres Menschseins fragende Ethik. Diese zweite Ebene möchte ich, in der einer Hausarbeit gebotenen Kürze, mit einem kleinen Exkurs über die christozentrische Ethik Diedrich Bonhoeffers vertiefen.
Vor diesem Verständnis ethischer Reflexion soll quasi die Quintessenz des Unterschieds der gegenübergestellten Menschenbilder herausgearbeitet werden.
Abschließend möchte ich versuchen aufzuzeigen, welche Formen von Qualitätssicherung in der heilpädagogischen Arbeit der Behindertenhilfe notwendig und hilfreich sein können und der Gefahr des "Qualitätszirkus" (SPECK) entgegenwirken. Welche Qualitäts- bzw. Wertemaßstäbe für die Sicherung der Qualität heilpädagogischer Arbeit Gültigkeit haben und diese leiten sollten, möchte ich in Bezug zu den möglichen Formen und Kriterien hilfreicher heilpädagogischer Qualitätssicherung herausstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Qualitätssicherung - ein Instrument innerhalb eines Qualitätsmanagementsystems
- Definition und Herkunft von Qualitätsmanagement
- Zielstellung von Qualitätsmanagement (QM)
- Der „,Qualitätsbegriff“ von QM
- Das Menschenbild von QM
- Qualitätssicherungsinstrumente in der Behindertenhilfe und deren Einfluss auf die praktische Arbeit
- Heilpädagogik und „Qualität“
- Definition und Herkunft der Heilpädagogik
- Ziel der Heilpädagogik
- Der Qualitätsbegriff in der Heilpädagogik
- Das Menschenbild in der Heilpädagogik
- Erste Kriterien zur Sicherung heilpädagogischer Qualität
- Ethische Reflexion zur Qualitätssicherung heilpädagogischer Arbeit
- Begriffsklärung und zwei mögliche ethische Reflexionsebenen
- Utilitaristische Ethik
- Deontologische Ethik
- Exkurs: christozentrische Ethik Bonhoeffers
- Eine Gegenüberstellung der Menschenbilder von QM und Heilpädagogik
- Welche Ansätze und Formen von Qualitätssicherung sind notwendig in der heilpädagogischen Arbeit und dabei hilfreich?
- Welche ethischen Qualitäts-und Wertemaßstäbe sind für die Sicherung der Qualität heilpädagogischer Arbeit gültig und sollte diese dabei leiten?
- Begriffsklärung und zwei mögliche ethische Reflexionsebenen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht das Menschenbild, das den Qualitätsmanagementbemühungen in der heilpädagogischen Arbeit innerhalb der Behindertenhilfe zugrunde liegt. Es werden die Unterschiede zwischen dem Menschenbild der Qualitätssicherungssysteme und dem Menschenbild der Heilpädagogik im Kontext ethischer Reflexionen analysiert. Auf dieser Basis werden folgernde Schlussfolgerungen für die heilpädagogische und qualitätssichernde Arbeit untersucht.
- Die Einordnung der Qualitätssicherung innerhalb eines allgemeinen Qualitätsmanagementsystems
- Die Herleitung und das Ziel, der Qualitätsbegriff und das Menschenbild, die einem allgemeinen Qualitätsmanagementsystem zugrunde liegen.
- Die relevanten Instrumente der Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe und deren Einfluss auf die heilpädagogische Arbeit.
- Die Herleitung und das Ziel, der Qualitätsbegriff und das Menschenbild der Heilpädagogik.
- Die ethische Reflexion zur Qualitätssicherung heilpädagogischer Arbeit, im Hinblick auf die utilitaristische und deontologische Ethik.
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel erörtert die Entstehung des Begriffs „Qualitätsmanagement“ und beleuchtet die historische Entwicklung des Qualitätsbewusstseins von der Antike bis zur Industrialisierung. Es werden verschiedene Ansätze und Phasen der Qualitätskontrolle und -sicherung, z.B. im Handwerk, in der Industrie und im militärischen Kontext, vorgestellt.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition und Herkunft der Heilpädagogik, sowie mit dem Ziel und dem Qualitätsbegriff der Heilpädagogik. Es werden wichtige Kriterien für die Sicherung heilpädagogischer Qualität herausgestellt.
- Das dritte Kapitel analysiert zwei ethische Reflexionsebenen: die utilitaristische Ethik, die den Nutzen in den Vordergrund stellt, und die deontologische Ethik, die nach Werten fragt. Es werden die Unterschiede in den Menschenbildern von QM und Heilpädagogik anhand dieser ethischen Perspektiven beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Menschenbild, ethische Reflexion, Heilpädagogik, Behindertenhilfe, utilitaristische Ethik, deontologische Ethik und christozentrische Ethik.
Häufig gestellte Fragen
Welches Menschenbild liegt dem modernen Qualitätsmanagement (QM) zugrunde?
Das Menschenbild des QM wird in der Arbeit oft als utilitaristisch hinterfragt, wobei der Fokus auf Effizienz, Nutzen und messbaren Leistungen liegt, was im Kontrast zu pädagogischen Werten stehen kann.
Wie unterscheidet sich das Menschenbild der Heilpädagogik vom QM?
Die Heilpädagogik basiert auf einem ganzheitlichen, oft deontologischen Menschenbild, das die Würde und den Eigenwert des Individuums unabhängig von seiner wirtschaftlichen Verwertbarkeit in den Mittelpunkt stellt.
Was ist mit dem Begriff "Qualitätszirkus" nach Speck gemeint?
Dieser Begriff kritisiert eine übertriebene Bürokratisierung und Instrumentalisierung der Qualitätssicherung, die den eigentlichen Kern der pädagogischen Arbeit aus den Augen verliert.
Welche Rolle spielt die Ethik von Dietrich Bonhoeffer in der Arbeit?
In einem Exkurs wird Bonhoeffers christozentrische Ethik als vertiefende Perspektive der deontologischen Ethik herangezogen, um den Wert des Menschen jenseits von Nützlichkeitserwägungen zu begründen.
Welche Instrumente der Qualitätssicherung werden in der Behindertenhilfe genutzt?
Die Arbeit beleuchtet gängige QM-Systeme und Instrumente und untersucht deren praktischen Einfluss auf die tägliche heilpädagogische Arbeit.
Wie kann eine hilfreiche Qualitätssicherung in der Heilpädagogik aussehen?
Eine notwendige Qualitätssicherung sollte ethisch reflektiert sein und Wertemaßstäbe integrieren, die der Würde der betreuten Menschen und dem fachlichen Anspruch der Heilpädagogik gerecht werden.
- Quote paper
- Johannes Keller (Author), 2004, Menschenbild und Qualität: Welches Menschenbild leitet die Qualitätssicherung heilpädagogischer Arbeit der Behindertenhilfe? - Eine ethische Reflexion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46176